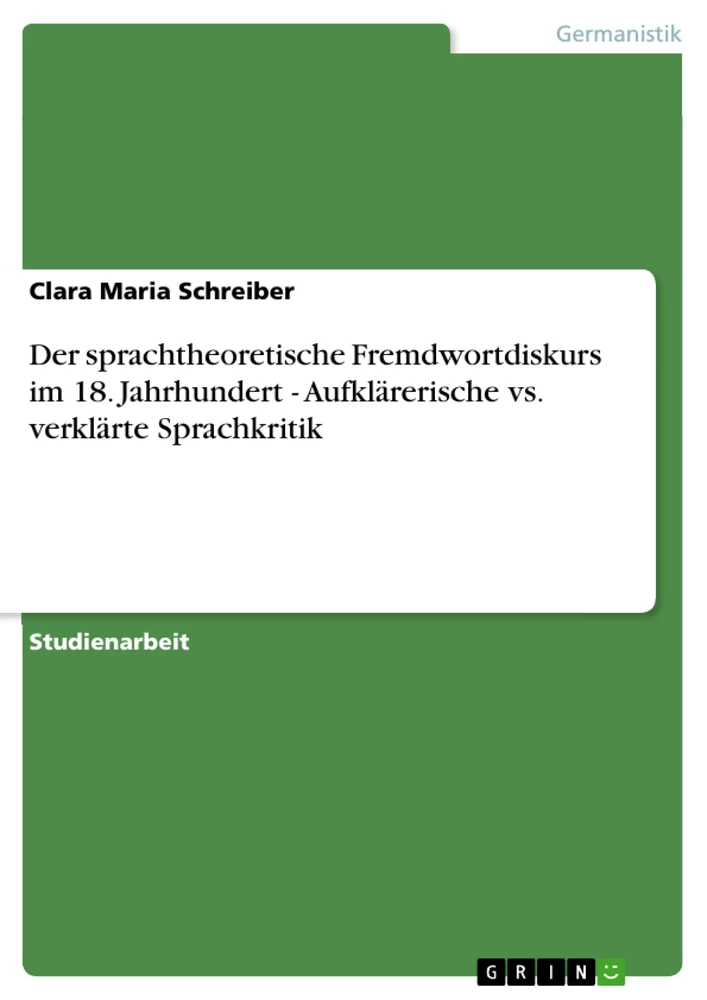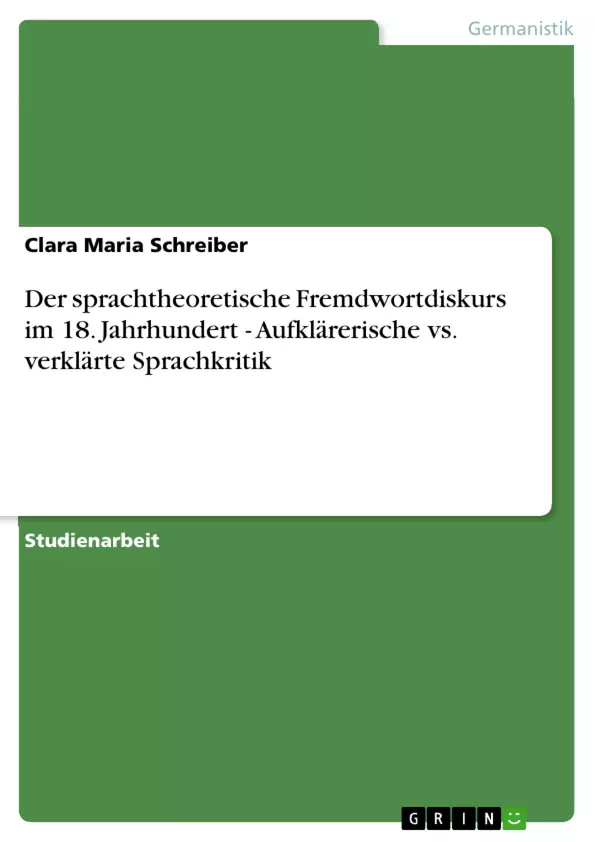Im Zentrum dieser Arbeit soll nicht eine Betrachtung von Fremdwörtern und Fremdwortgebrauch im 18. Jahrhundert stehen, sondern der metasprachliche Diskurs über diesen. Besonders für das 18. Jahrhundert (und das hier zudem berücksichtigte beginnende 19. Jahrhundert) ist eine bewusste Auseinandersetzung mit der Fremdwortfrage durch Grammatiker, Lexikographen, Sprachkritiker und -pfleger zu verzeichnen. Spannend bei der Betrachtung dieser Periode scheint die unterschiedliche Funktionalisierung der Sprache zu sein, die in den Antworten auf die Frage, ob, in welchem Maße und in welcher Form Fremdwörter zu gebrauchen seien, deutlich hervor scheint und zum Fundament der Argumentationen wird. Zudem ist die sprachwissenschaftliche Betrachtung des Diskurses über die Einflüsse fremder Sprachen auf das Deutsche interessant und wichtig, da die Beiträge ihrem Anspruch und ihrer Wirkung nach nicht nur deskriptiv, sondern vor allem normativ sind, d.h. dazu in der Lage,„das System zu beeinflussen und Sprachwirklichkeit zu schaffen.“
Die von Gardt unterschiedenen Idealtypen einer Argumentation lassen sich im Diskurs des 18. Jahrhunderts allesamt verfolgen. Die in dieser Arbeit untersuchten Argumentationen gegen einen (unmäßigen) Fremdwortgebrauch im 18. Jahrhundert spielen sich zunächst vor allem auf der Ebene eines sprachpädagogischen, bzw. -soziologischen Diskurses ab und sind in Verbindung mit den aufklärerischen Denkströmungen der Zeit zu sehen. Aufschlussreich sind hier vor allem sprachtheoretische und sprachkritische Schriften. Selbstverständlich kann in diesem Rahmen nur auf eine kleine Auswahl von Autoren eingegangen werden, die jedoch eine zentrale Rolle, vor allem in ihrer Wirkung auf die Nachwelt, spielen. So ist mit Leibniz der Beginn einer Fremdwortkritik, die der Frage der Volksaufklärung untersteht, zu setzen. Wolff geht einen Schritt weiter und dehnt die Kritik sogar auf die fachsprachliche Terminologie aus. In Campe ist zuletzt der Gipfel eines, von seinen Zeitgenossen allzu oft missverstandenen, Fremdwortpurismus mit aufklärerischem Ziel zu sehen, ihm wird in dieser Arbeit nicht ohne Grund der größte Raum zugesprochen werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fundament und Prämissen des Fremdwortdiskurses im 18. Jahrhundert
- Aufklärerische Absichten
- Leibniz' pädagogisches Interesse
- Geburt einer deutschen Wissenschaftssprache
- Campes Verdeutschungsprogramm
- Verklärte Einsichten
- Fichte als Mitbegründer nationalistischen Sprachdenkens
- Aufwertung des Deutschen durch Herabsetzung des Fremden
- Die Fremdwortfrage unter historistischer Perspektive
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den metasprachlichen Diskurs über Fremdwörter im 18. Jahrhundert. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Funktionalisierungen der Sprache und die damit verbundenen Argumente für oder gegen den Fremdwortgebrauch. Dabei werden sowohl aufklärerische als auch verklärte Sichtweisen auf die Fremdwortfrage beleuchtet, die den sprachtheoretischen und sprachkritischen Diskurs der Zeit widerspiegeln.
- Die Rolle des Fremdwortdiskurses in der sprachpädagogischen und -soziologischen Debatte des 18. Jahrhunderts
- Die Entwicklung einer deutschen Wissenschaftssprache und die damit verbundenen Herausforderungen durch Fremdwörter
- Die Verknüpfung der Fremdwortfrage mit nationalistischen und patriotischen Idealen im 18. Jahrhundert
- Die unterschiedlichen Argumentationslinien im Fremdwortdiskurs: von der aufklärerischen Sprachkritik bis zur Verklärung der deutschen Sprache
- Der Einfluss außersprachlicher und sprachwissenschaftlicher Hintergründe auf die Entwicklung des Fremdwortdiskurses
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den Fokus der Arbeit auf den metasprachlichen Diskurs über Fremdwörter im 18. Jahrhundert. Sie hebt die Relevanz dieser Thematik im Kontext der sprachlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Zeit hervor.
Kapitel 2 analysiert die Fundament und Prämissen des Fremdwortdiskurses im 18. Jahrhundert. Es beleuchtet die zunehmende Alphabetisierung der Bevölkerung, die Entstehung neuer medialer Möglichkeiten und die damit verbundene Auflösung der stabilen Diglossie von Mittellatein und Mittelhochdeutsch. Der Aufstieg der Volkssprache und die Verehrung des Neulateins als internationale Wissenschaftssprache werden als wichtige Faktoren für die Entwicklung des spezifisch deutschen Fremdwortbegriffs und -gebrauchs dargestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit den aufklärerischen Absichten im Fremdwortdiskurs. Es werden die Beiträge von Leibniz, Wolff und Campe analysiert, die die Fremdwortfrage in Verbindung mit der Volksaufklärung und der Entwicklung einer deutschen Wissenschaftssprache diskutieren. Campes Verdeutschungsprogramm wird als Höhepunkt des Fremdwortpurismus in dieser Epoche dargestellt.
Kapitel 4 untersucht die verklärten Einsichten im Fremdwortdiskurs. Es werden die Argumente von Fichte, Arndt und Grimm beleuchtet, die die Fremdwortfrage mit nationalistischen und patriotischen Idealen verknüpfen. Die Sprache wird als Spiegel und Stifter des Volksgeistes betrachtet, und das Fremde wird abgewertet, um das Deutsche aufzuwerten.
Das Kapitel 5 (Fazit und Ausblick) wurde nicht für diesen Preview berücksichtigt, da es die wesentlichen Schlussfolgerungen der Arbeit und weiterführende Forschungsfragen enthält.
Schlüsselwörter
Fremdwort, Fremdwortdiskurs, 18. Jahrhundert, Aufklärer, Sprachkritik, Sprachpädagogik, Sprachsoziologie, Wissenschaftssprache, Sprachideologie, Nationalismus, Patriotismus, Volksgeist, Sprachreinheit, Diglossie, Neulatein, Verdeutschung, Sprachgeschichte
Häufig gestellte Fragen
Was war der Fokus des Fremdwortdiskurses im 18. Jahrhundert?
Im Zentrum stand der metasprachliche Diskurs über den Gebrauch von Fremdwörtern, geführt von Grammatikern und Sprachpflegern, oft mit normativem Anspruch.
Welches Ziel verfolgte Leibniz mit seiner Sprachkritik?
Leibniz hatte ein pädagogisches Interesse; er wollte die deutsche Sprache als Medium der Volksaufklärung und Wissenschaft etablieren.
Was ist das Besondere an Campes Verdeutschungsprogramm?
Joachim Heinrich Campe vertrat einen radikalen Fremdwortpurismus mit dem Ziel, die Sprache für alle Volksschichten verständlich zu machen (Volksaufklärung).
Wie änderte sich der Diskurs im frühen 19. Jahrhundert bei Fichte?
Der Diskurs verschob sich hin zu nationalistischem Sprachdenken, bei dem das Deutsche als "Ur-Sprache" aufgewertet und Fremdeinflüsse als schädlich für den Volksgeist abgelehnt wurden.
Warum gilt die Sprachkritik dieser Zeit als normativ?
Die Beiträge wollten nicht nur den Ist-Zustand beschreiben, sondern aktiv das Sprachsystem beeinflussen und eine neue Sprachwirklichkeit schaffen.
- Citation du texte
- Clara Maria Schreiber (Auteur), 2006, Der sprachtheoretische Fremdwortdiskurs im 18. Jahrhundert - Aufklärerische vs. verklärte Sprachkritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58566