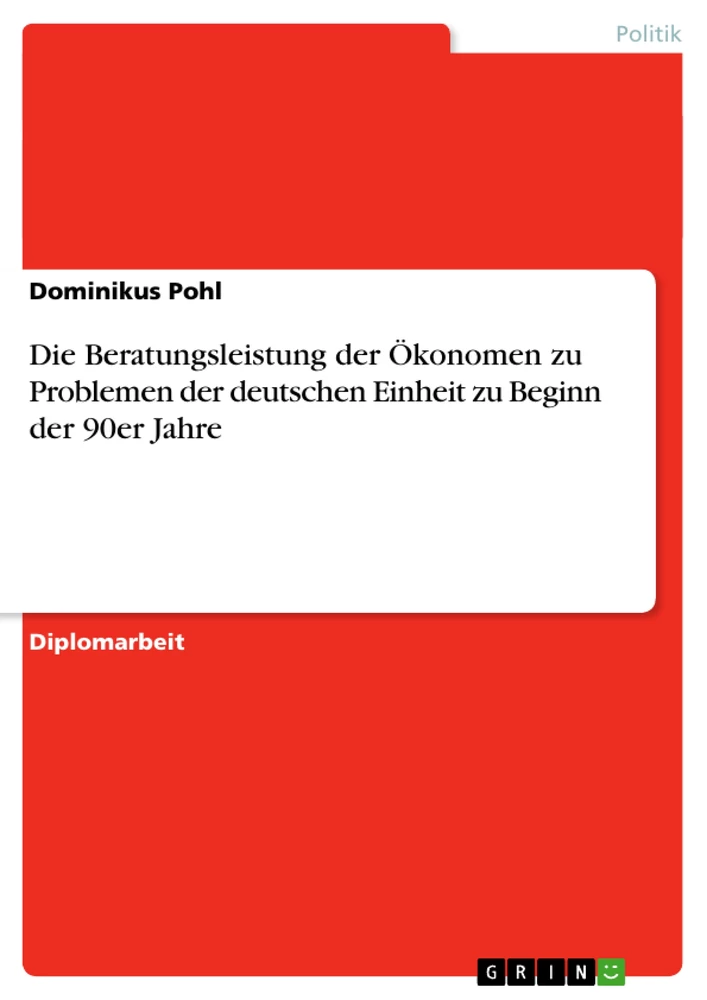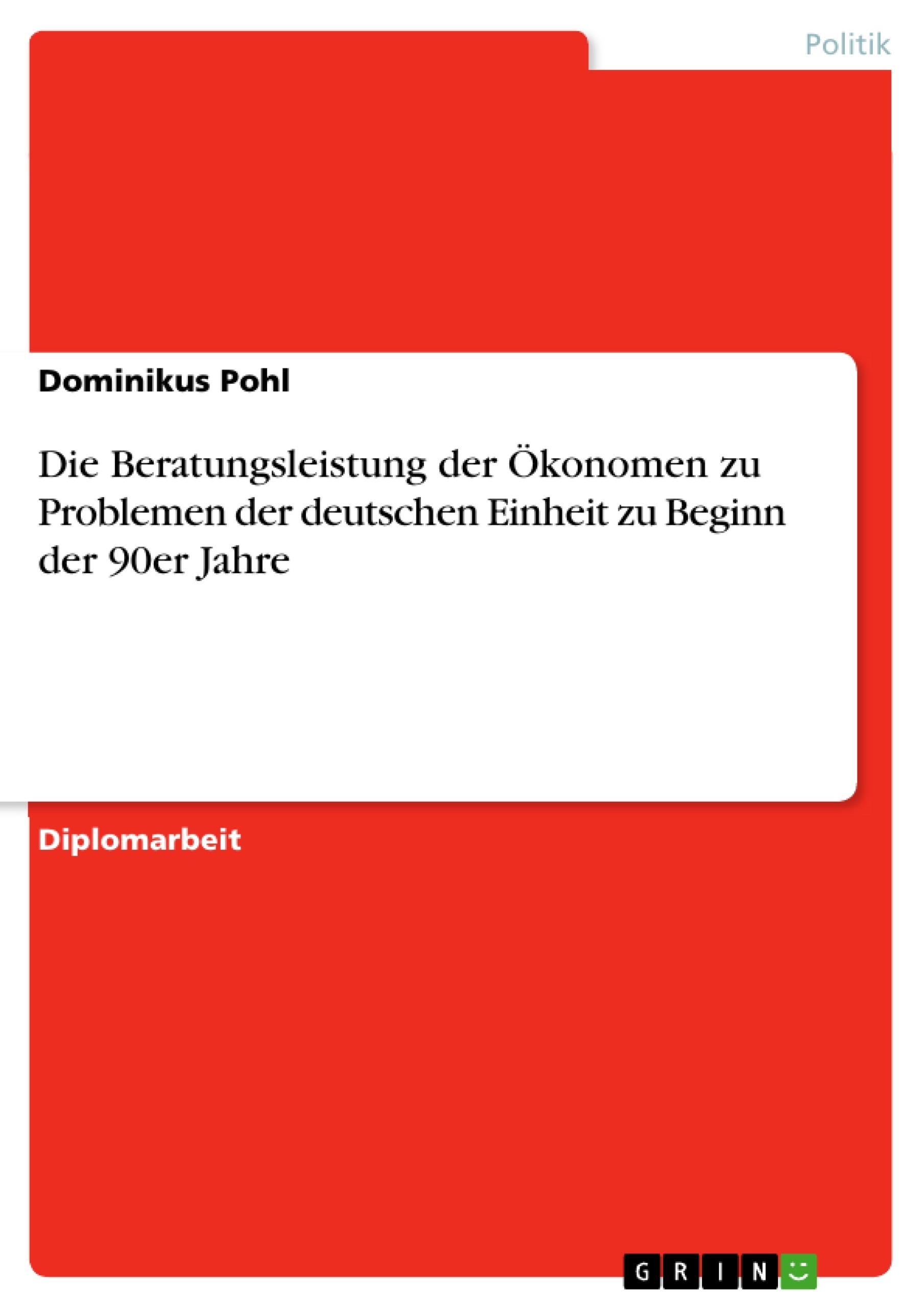Im Zuge dieser Arbeit gilt es demnach, die Problemfindungskompetenz der Ökonomen in verschiedenen Politikbereichen zu untersuchen. Dadurch soll erkannt werden, inwieweit Themen, welche sich aus heutiger Sicht als problematisch herauskristallisiert haben, zu Beginn der 90’er Jahre von Seiten der Politikberatung identifiziert, angesprochen und kritisiert wurden und damit eine Entscheidungsgrundlage für die Politik darstellen konnten.
Aufgrund dessen wird einem kurzen Überblick hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation der DDR im Jahr 1989 folgend, die grundsätzliche Problematik zwischen Politikern und ihren ökonomischen Beratern dargestellt sowie versucht, Gründe für das häufige Scheitern des Zusammenspiels beider Gruppen zu benennen.
Im Weiteren werden die Expertenmeinungen zu der am umstrittensten diskutierten Frage im Zuge der Wiedervereinigung – der Währungsunion – behandelt sowie die politische Realisierbarkeit eines aus dieser Diskussion resultierenden Politikvorschlags – sofern vorhanden – überprüft. Diesem folgend wird die Problematik der Arbeitsmarktpolitik dezidiert dargestellt und auch in diesem Bereich Ursachen für das missglückte Zusammenspiel zwischen Politikern und ihren Beratern hervorgehoben.
In Kapitel 4 werden die Fragen hinsichtlich einer Übertragung der sozialen Sicherungssysteme aufgegriffen, wobei hier zu erklären gilt, warum diese – im Vergleich zu anderen Themen – weit weniger stark im Blickfeld der politikberatenden Ökonomen lagen.
Darüber hinaus werden weitere wichtige Politikfelder im Einigungsprozess (Finanzierung der Einheit + Privatisierung) angesprochen und überprüft. Auch hier ist es das Ziel, eine „ökonomische Meinung“ herauszuarbeiten und diese zu bewerten. Im letzten Abschnitt der Arbeit gilt es, ein Fazit der Beratungsleistung der Ökonomen zu Problemen der deutschen Einheit zu Beginn der 90’er Jahre zu ziehen. Im Zuge dessen soll Klarheit darüber entstehen, ob insgesamt eher Beratungsresistenz auf Seiten der Politiker oder Beratungsinsuffizienz auf Seiten der Politikberater für das oftmals beschworene „wirtschaftliche Debakel“ der deutsch-deutschen Wirtschaftsintegration verantwortlich war.
Inhaltsverzeichnis
- Die generelle Beziehung von Politikern und Politikberatern
- Ziele und Restriktionen von Politikern
- Ziele und Restriktionen von Politikberatern
- Fazit
- Die deutsch-deutsche Währungsunion
- Das Tempo der Währungsunion
- Stichtagsregelung
- Stufenweise Einführung
- Kritische Würdigung der Beratungsleistung
- Die Höhe des Wechselkurses
- Wechselkurs 2:1
- Bestandsgrößen
- Stromgrößen
- Wechselkurs 1:1
- Bestandsgrößen
- Stromgrößen
- Kritische Würdigung der Beratungsleistung
- Fazit
- Die Arbeitsmarktpolitik
- Grundsätzliche Ausgestaltung der Lohnpolitik
- Differenzierung der Lohnentwicklung
- Implikationen der Tarifpolitik
- Kritische Bewertung der Beratungsleistung
- Interventionistische Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik
- Offene Lohnsubventionen
- Kapitalsubventionen
- ABS-Gesellschaften
- Kritische Würdigung der Beratungsleistung
- Fazit
- Ökonomische Bewertung der sozialen Sicherungssysteme
- Alterssicherung
- Ökonomische Bewertung
- Kritische Würdigung der Beratungsleistung
- Gesundheit
- Ökonomische Bewertung
- Kritische Würdigung der Beratungsleistung
- Fazit
- Die Finanzierung der Einheit und Privatisierung des Produktivvermögens
- Die Finanzierung der deutschen Wiedervereinigung
- Ökonomische Bewertung
- Kritische Würdigung der Beratungsleistung
- Privatisierung und Treuhandanstalt
- Ökonomische Bewertung
- Kritische Würdigung der Beratungsleistung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Beratungsleistung von Ökonomen zu Problemen der deutschen Einheit zu Beginn der 90er Jahre. Ziel ist es, die ökonomischen Beratungsansätze und deren Auswirkungen auf die Gestaltung der Währungsunion, der Arbeitsmarktpolitik und der Finanzierung der Einheit zu analysieren und kritisch zu bewerten.
- Wirtschaftspolitische Beratung während der deutschen Vereinigung
- Analyse der Währungsunion und des Wechselkurses
- Bewertung der Arbeitsmarktpolitik im Kontext der Einheit
- Ökonomische Aspekte der sozialen Sicherungssysteme
- Finanzierung der Wiedervereinigung und Privatisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die generelle Beziehung von Politikern und Politikberatern: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Arbeit, indem es die Ziele und Restriktionen sowohl von Politikern als auch von Politikberatern im Kontext der deutschen Wiedervereinigung beleuchtet. Es analysiert die jeweiligen Handlungsspielräume und die Wechselwirkungen zwischen beiden Akteursgruppen, was für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel über die konkrete wirtschaftspolitische Beratung essentiell ist. Die verschiedenen Interessenlagen und die daraus resultierenden Herausforderungen für eine effektive Politikgestaltung werden umfassend dargestellt.
Die deutsch-deutsche Währungsunion: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Währungsunion, einem zentralen Aspekt der deutschen Wiedervereinigung. Es untersucht die Debatte um das Tempo der Einführung (Stichtagsregelung vs. Stufenmodell) und die Festlegung des Wechselkurses (2:1 vs. 1:1). Die Analyse berücksichtigt sowohl Bestands- als auch Stromgrößen und bewertet kritisch die Beratungsleistung der Ökonomen in Bezug auf die getroffenen Entscheidungen und deren Folgen für die ostdeutsche Wirtschaft.
Die Arbeitsmarktpolitik: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Gestaltung der Lohnpolitik und den interventionistischen Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik im vereinten Deutschland. Es untersucht die Differenzierung der Lohnentwicklung zwischen Ost und West, die Implikationen der Tarifpolitik und die Rolle von Instrumenten wie offenen Lohnsubventionen und Kapitalsubventionen. Die kritische Würdigung der Beratungsleistung beleuchtet die Effektivität der gewählten Strategien und deren Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote und die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland.
Ökonomische Bewertung der sozialen Sicherungssysteme: Dieses Kapitel analysiert die ökonomischen Herausforderungen im Bereich der Alterssicherung und des Gesundheitswesens im Zuge der Wiedervereinigung. Es bewertet die bestehenden Systeme und deren Anpassung an die neuen Gegebenheiten. Die kritische Betrachtung der Beratungsleistungen fokussiert auf die langfristige Tragfähigkeit und die Verteilungsgerechtigkeit der sozialen Sicherungssysteme im vereinten Deutschland.
Die Finanzierung der Einheit und Privatisierung des Produktivvermögens: Das Kapitel widmet sich der Finanzierung der Wiedervereinigung und der Privatisierung der volkseigenen Betriebe durch die Treuhandanstalt. Es analysiert die ökonomischen Herausforderungen und bewertet die getroffenen Entscheidungen kritisch. Die Rolle der Treuhandanstalt und deren Auswirkungen auf die ostdeutsche Wirtschaft werden detailliert untersucht. Die langfristigen ökonomischen Folgen dieser Maßnahmen werden ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Deutsche Einheit, Währungsunion, Wechselkurs, Arbeitsmarktpolitik, Lohnpolitik, soziale Sicherungssysteme, Finanzierung der Wiedervereinigung, Privatisierung, Treuhandanstalt, Ökonomische Beratung, Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Wirtschaftspolitische Beratung während der deutschen Vereinigung
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert die wirtschaftspolitische Beratung während der deutschen Vereinigung zu Beginn der 1990er Jahre. Der Fokus liegt auf der Bewertung der ökonomischen Beratungsansätze und deren Auswirkungen auf die Gestaltung der Währungsunion, der Arbeitsmarktpolitik und der Finanzierung der Einheit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: die generelle Beziehung zwischen Politikern und Politikberatern, die deutsch-deutsche Währungsunion (einschließlich Tempo und Wechselkurs), die Arbeitsmarktpolitik (Lohnpolitik und interventionistische Maßnahmen), die ökonomische Bewertung der sozialen Sicherungssysteme (Alterssicherung und Gesundheit) sowie die Finanzierung der Einheit und die Privatisierung des Produktivvermögens.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Die generelle Beziehung von Politikern und Politikberatern; 2. Die deutsch-deutsche Währungsunion; 3. Die Arbeitsmarktpolitik; 4. Ökonomische Bewertung der sozialen Sicherungssysteme; 5. Die Finanzierung der Einheit und Privatisierung des Produktivvermögens. Jedes Kapitel beinhaltet eine kritische Würdigung der damaligen Beratungsleistung.
Welche Aspekte der Währungsunion werden untersucht?
Die Analyse der Währungsunion umfasst die Debatte um das Tempo der Einführung (Stichtagsregelung vs. Stufenmodell) und die Festlegung des Wechselkurses (2:1 vs. 1:1). Es werden sowohl Bestands- als auch Stromgrößen berücksichtigt.
Welche Aspekte der Arbeitsmarktpolitik werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Gestaltung der Lohnpolitik, interventionistische Maßnahmen wie offene und Kapitalsubventionen sowie die Implikationen der Tarifpolitik für Ostdeutschland. Die Effektivität der Strategien und deren Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote werden kritisch bewertet.
Welche sozialen Sicherungssysteme werden ökonomisch bewertet?
Die ökonomische Bewertung konzentriert sich auf die Alterssicherung und das Gesundheitswesen. Die Analyse untersucht die Anpassung der Systeme an die neuen Gegebenheiten der Wiedervereinigung und deren langfristige Tragfähigkeit.
Wie wird die Finanzierung der Wiedervereinigung behandelt?
Die Arbeit analysiert die Finanzierung der deutschen Wiedervereinigung und die Privatisierung der volkseigenen Betriebe durch die Treuhandanstalt. Die ökonomischen Herausforderungen und die langfristigen Folgen der getroffenen Entscheidungen werden detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Einheit, Währungsunion, Wechselkurs, Arbeitsmarktpolitik, Lohnpolitik, soziale Sicherungssysteme, Finanzierung der Wiedervereinigung, Privatisierung, Treuhandanstalt, Ökonomische Beratung, Wirtschaftspolitik.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen hervorhebt.
Was ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die ökonomischen Beratungsansätze während der deutschen Vereinigung zu analysieren und kritisch zu bewerten, um deren Auswirkungen auf die Gestaltung der Währungsunion, der Arbeitsmarktpolitik und der Finanzierung der Einheit zu verstehen.
- Citar trabajo
- Dominikus Pohl (Autor), 2006, Die Beratungsleistung der Ökonomen zu Problemen der deutschen Einheit zu Beginn der 90er Jahre, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58572