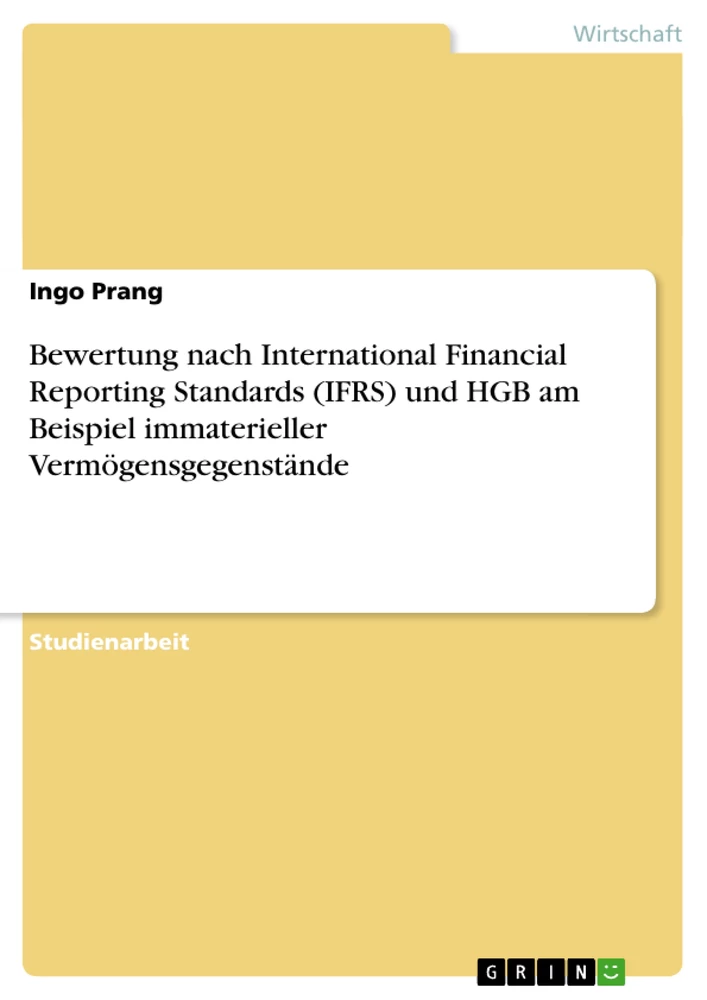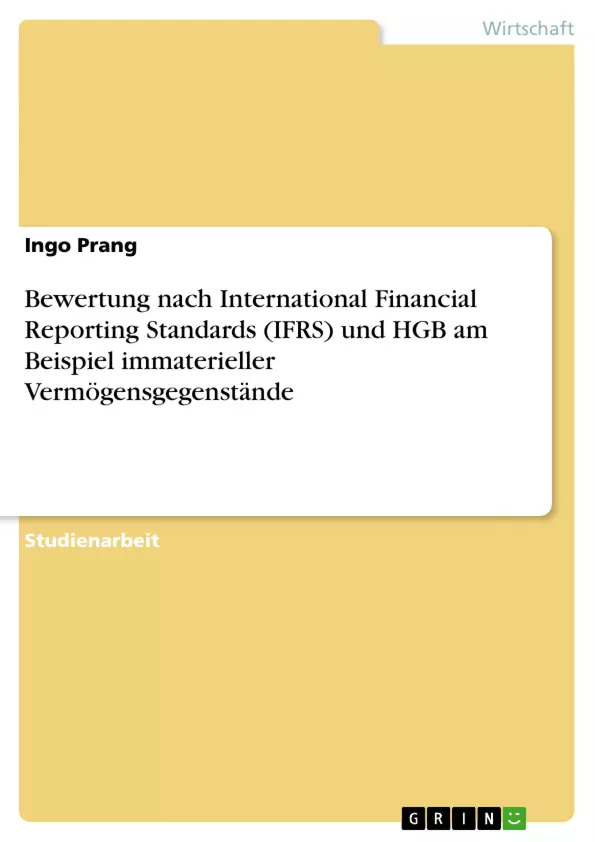Die „herkömmlichen“ Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital verlieren durch die Entwicklung hin zu einer Dienstleistungs- und Technologiegesellschaft immer mehr an Bedeutung. Auf der anderen Seite nimmt der Produktionsfaktor Wissen einen immer größeren Stellenwert ein. Vor diesem Hintergrund sind immateriellen Werte zu wichtigen Komponenten bei der Bestimmung des Unternehmenswertes geworden. Aufgrund des internationalen Wettbewerbes um Kapital ist die Behandlung (ob, ab wann, in welcher Höhe und bis zu welchem Zeitpunkt) von immateriellen Vermögenswerten in den verschiedenen Rechnungslegungssystemen immer wichtiger. Die folgende Arbeit setzt sich mit der Thematik der Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen nach Handelsrecht und International Financial Reporting Standards auseinander. Ist die Aktivierung eines immateriellen Vermögenswertes bzw. Vermögensgegenstandes in richtiger Weise erfolgt, ist in einem zweiten Schritt die Bewertung der vorliegenden immateriellen Werte vorzunehmen. Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten Bewertungsgrundsätze des Handelsgesetzbuches erläutert und ein Vergleich zum System der IFRS angestellt. Anschließend wird die Bewertung und Folgebewertung von immateriellen Werten nach HGB und IFRS beschrieben. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit, indem die wichtigsten Unterschiede der Bewertung nach HGB und IFRS zusammengefasst werden und ein Ausblick in die Zukunft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. Allgemeines
- 1.2. Verlauf der Arbeit
- 2. DIE WICHTIGSTEN BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
- 2.1. Grundsätze nach HGB
- 2.2. Vergleich mit dem System der IFRS
- 3. BEWERTUNG VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN NACH HGB
- 3.1. Begriffsbestimmung des Wortes „immaterieller Vermögensgegenstand“
- 3.2. Zugangsbewertung immaterieller Vermögensgegenstände
- 3.2.1. Die Anschaffungskosten als Bewertungsgrundlage und Ausgangspunkt
- 3.2.2. Anschaffungskosten
- 3.2.3. Herstellungskosten
- 3.2.4. Bewertungszeitpunkt
- 3.2.5. Der Bewertungsmaßstab „Zeitwert“
- 3.3. Folgebewertung von immateriellen Vermögensgegenständen
- 3.3.1. Allgemeines
- 3.3.2. Planmäßige Wertminderung
- 3.3.3. außerplanmäßige Wertminderung
- 3.3.4. Wertaufholungen
- 3.3.5. Sonderfall „Geschäfts- und Firmenwert“
- 4. BEWERTUNG VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN NACH IFRS
- 4.1. Definitionen des Begriffes „immaterieller Vermögenswert (intangible asset)“
- 4.2. Zugangsbewertung immaterieller Vermögensgegenstände
- 4.2.1 immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens
- 4.2.1.1. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten als Bewertungsmaßstab
- 4.2.1.2. Anschaffung eines immateriellen Vermögenswertes
- 4.2.1.3. Herstellungskosten
- 4.2.1.4. Bewertungszeitpunkt
- 4.2.1.5. nachträgliche Herstellungs- und Anschaffungskosten
- 4.2.1.6. Der beizulegender Zeitwert (fair value)
- 4.2.2. immaterielle Vermögenswerte des Umlaufvermögens
- 4.3. Folgebewertung von immateriellen Vermögensgegenständen
- 4.3.1. Allgemeines
- 4.3.2. Folgebewertung von immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens
- 4.3.2.1. Folgebewertung nach dem Anschaffungskostenmodell (Benchmark - Methode)
- 4.3.2.2. Folgebewertung nach dem Neubewertungsmodell
- 4.3.2.3. planmäßige Wertminderungen
- 4.3.2.4. außerplanmäßige Wertminderungen
- 4.3.2.5. Wertaufholung
- 4.3.2.6. Sonderfall: Geschäfts- und Firmenwert
- 4.3.3. Folgebewertung von immateriellen Vermögenswerten des Umlaufvermögens
- 5. FAZIT
- 5.1. Ergebnisse der Arbeit
- 5.2. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) und dem Handelsgesetzbuch (HGB). Sie analysiert die wichtigsten Bewertungsgrundsätze beider Systeme und vergleicht diese miteinander.
- Die Definition und Abgrenzung von immateriellen Vermögensgegenständen
- Die Bewertungsgrundsätze der Zugangs- und Folgebewertung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB und IFRS
- Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen nach HGB und IFRS
- Der Einfluss der unterschiedlichen Bewertungsgrundsätze auf die Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen
- Die Auswirkungen der Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen auf die Entscheidungsfindung von Unternehmen und Kapitalgebern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den Aufbau und die Struktur der Arbeit. In Kapitel 2 werden die wichtigsten Bewertungsgrundsätze nach HGB und IFRS dargestellt und miteinander verglichen. Kapitel 3 befasst sich mit der Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen nach HGB, wobei die Zugangsbewertung und die Folgebewertung im Detail beleuchtet werden. Kapitel 4 analysiert die Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände nach IFRS und stellt die Unterschiede zur HGB-Bewertung dar. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern der Bilanzierung und Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen. Sie analysiert die relevanten Bewertungsgrundsätze der IFRS und des HGB und befasst sich mit dem Vergleich der beiden Systeme.
- Quote paper
- Ingo Prang (Author), 2006, Bewertung nach International Financial Reporting Standards (IFRS) und HGB am Beispiel immaterieller Vermögensgegenstände, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58638