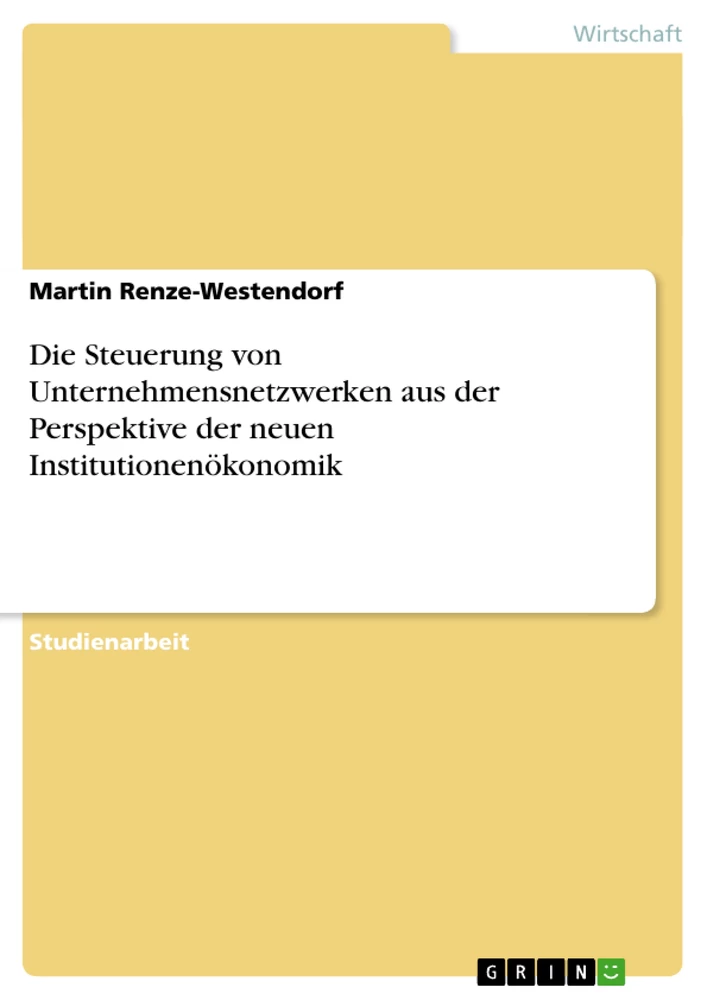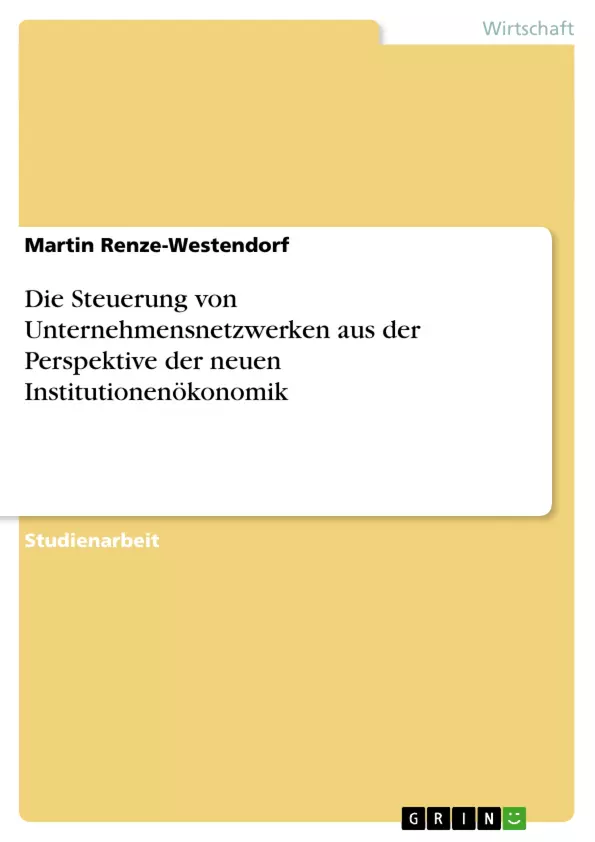Im Kern sind Kooperationen rechtlich selbständiger Unternehmen seit langem übliches Instrument in der betrieblichen Praxis. Doch auf Grund der sich immer schneller ändernden Umweltbedingungen und den daraus resultierenden stärkeren Anpassungszwängen setzte sich seit Anfang der 1980er Jahre das zwischenbetriebliche Netzwerk als Weg der (Quasi-)Externalisierung und (Quasi-)Internalisierung durch. Die klassischen Grenzen der Unternehmung werden zunehmend undeutlicher und beginnen sich aufzulösen. Als Folge aus dieser Entwicklung sieht sich das Management verglichen zu den traditionellen Steuerungskonzepten mit neuen und ungewohnten Herausforderungen konfrontiert. Die Aufgabe einer hierarchischen Ordnung, statischer Führungsbeziehungen und zentraler Entscheidungsgremien begründen die Fragestellung, wie netzwerkartige Kooperationen gesteuert werden können. Es ist fraglich, wie das Management in Unternehmensnetzwerken institutionalisiert werden kann, welche Aufgaben es erfüllen soll und wie es effektiv und effizient eingesetzt werden kann. Im Rahmen der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ), die die Auswirkungen von Institutionen auf menschliches Verhalten untersucht, werden Effizienzkriterien für die Bildung und Organisation von Institutionen aufgestellt. Aus diesen organisationstheoretischen Ansätzen lassen sich Implikationen auf die Entstehung und die Steuerung, die Gegens-tand dieser Untersuchung sein soll, von Unternehmensnetzwerken ableiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Grundlagen
- Die Neue Institutionenökonomik
- Interorganisationale Netzwerke
- Charakteristika interorganisationaler Netzwerke
- Formen von interorganisationalen Netzwerken
- Steuerung von Unternehmensnetzwerken
- Ansatzpunkte der Steuerung in Netzwerken
- Lösungsansätze
- Implikationen aus der Transaktionskostentheorie
- Implikationen aus der Principal-Agent-Theorie
- Kritische Würdigung – Grenzen der Steuerung
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Steuerung von Unternehmensnetzwerken aus der Perspektive der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ). Das Ziel ist es, die Implikationen der NIÖ für die Gestaltung von Kooperationsbeziehungen in Netzwerken zu untersuchen.
- Die Neue Institutionenökonomik und ihre Kernaussagen
- Charakteristika und Formen von interorganisationalen Netzwerken
- Ansatzpunkte und Lösungsansätze für die Steuerung von Netzwerken
- Kritische Würdigung und Grenzen der Steuerung in Netzwerken
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - stellt die Problemstellung der Steuerung von Unternehmensnetzwerken in der heutigen Wirtschaftswelt dar und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Grundlagen - gibt einen Überblick über die NIÖ, insbesondere die Transaktionskosten- und die Principal-Agent-Theorie. Es werden zudem die Charakteristika und Formen von interorganisationalen Netzwerken erläutert.
- Kapitel 3: Steuerung von Unternehmensnetzwerken - fokussiert sich auf die Ansatzpunkte der Steuerung in Netzwerken und präsentiert Lösungsansätze aus der Transaktionskosten- und der Principal-Agent-Theorie. Abschließend werden die Grenzen der Steuerung kritisch gewürdigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Neuen Institutionenökonomik, insbesondere der Transaktionskostentheorie und der Principal-Agent-Theorie, sowie mit der Gestaltung und Steuerung von Unternehmensnetzwerken. Weitere wichtige Begriffe sind: Interorganisationale Netzwerke, Kooperationen, Externalisierung, Internalisierung, Effizienz, Governance.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ)?
Die NIÖ untersucht, wie Institutionen und Regeln das menschliche Verhalten beeinflussen, wobei Konzepte wie Transaktionskosten und Informationsasymmetrien im Mittelpunkt stehen.
Warum sind Unternehmensnetzwerke heute so wichtig?
Aufgrund dynamischer Umweltbedingungen lösen sich klassische Unternehmensgrenzen auf. Netzwerke ermöglichen eine flexible (Quasi-)Internalisierung oder Externalisierung von Leistungen zur Effizienzsteigerung.
Wie hilft die Transaktionskostentheorie bei der Steuerung von Netzwerken?
Sie hilft zu entscheiden, welche Koordinationsform (Markt, Hierarchie oder Netzwerk) die geringsten Kosten bei der Abwicklung von Austauschbeziehungen verursacht.
Was erklärt die Principal-Agent-Theorie in Bezug auf Kooperationen?
Sie analysiert Kontroll- und Motivationsprobleme, wenn ein Partner (Agent) Aufgaben für einen anderen (Principal) übernimmt, und schlägt Lösungsmechanismen zur Überwindung von Interessenkonflikten vor.
Wo liegen die Grenzen der Steuerung in Netzwerken?
Die Steuerung stößt an Grenzen durch die rechtliche Selbstständigkeit der Partner, mangelnde zentrale Weisungsbefugnisse und das Risiko von opportunistischem Verhalten.
- Citar trabajo
- Martin Renze-Westendorf (Autor), 2004, Die Steuerung von Unternehmensnetzwerken aus der Perspektive der neuen Institutionenökonomik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58647