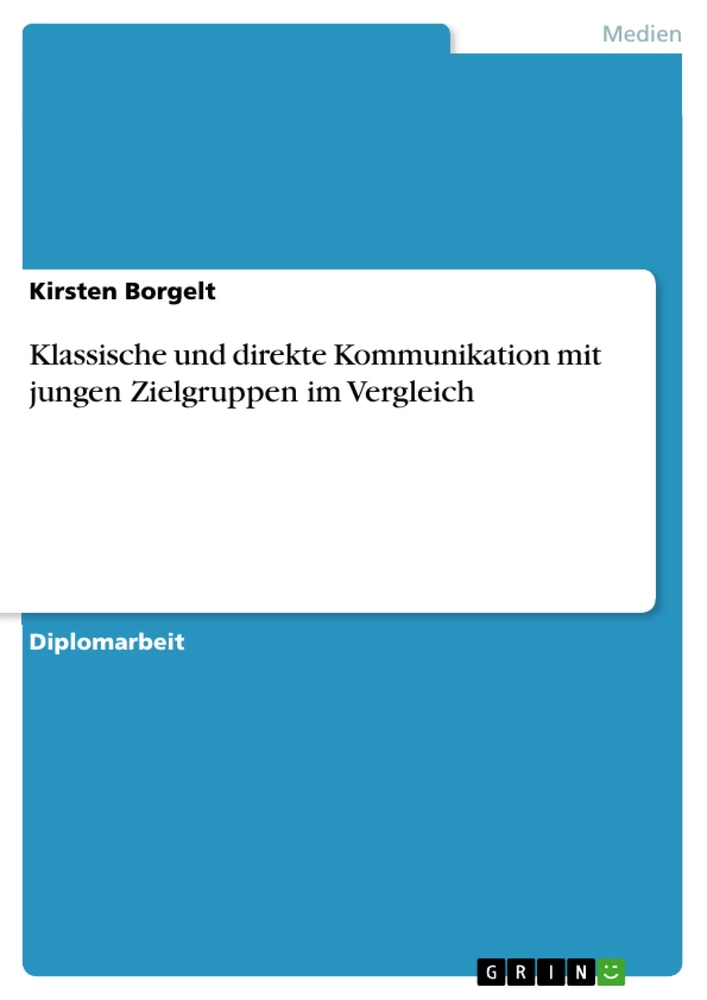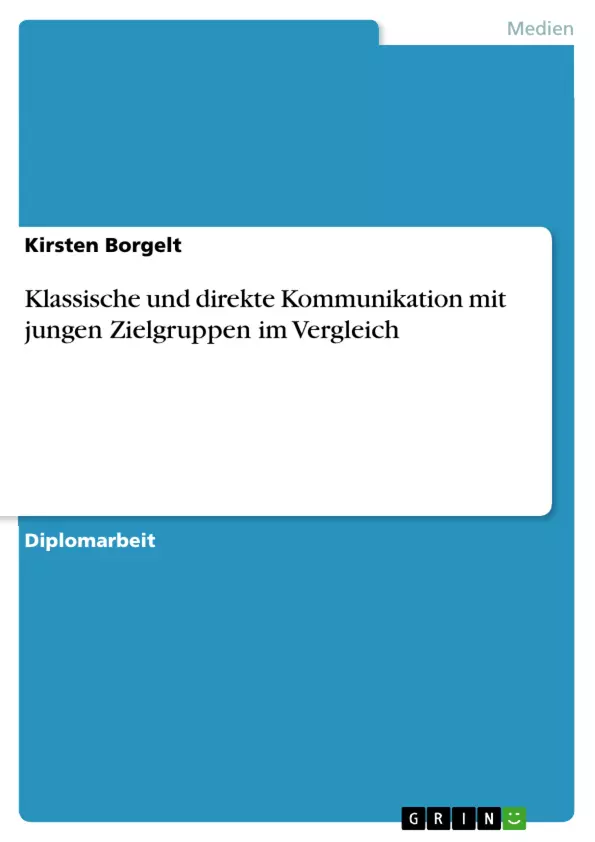In Zeiten gesättigter Märkte entdecken immer mehr Unternehmen, dass es neben den „erwachsenen“ Zielgruppen ein weiteres interessantes Segment zu entdecken gibt: Kinder. Kinder-Marketing wird immer interessanter, weil die „lieben Kleinen“ nicht nur im Trend der „Ein-Kind-Familie“ über ständig größere finanzielle Mittel verfügen, sondern auch einen erheblichen Einfluss auf Anschaffungen innerhalb der Familie haben. Außerdem werden sie die Kunden von Morgen sein und haben mit zwei Drittel der Produkte, die sie im Erwachsenenalter konsumieren, schon als Kind Kontakt. Das Marktpotenzial dieser Gruppe ist somit höher, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Besonders umfängliche Literatur gibt es trotzdem nicht. Selbst der Begriff „Kinder-Marketing“ wurde bisher nicht definiert. In dieser Arbeit sollen darunter alle Marketingaktivitäten verstanden werden, die auf die jungen Zielgruppen gerichtet sind. Vielleicht ist die Definierung deshalb unterblieben, da es sich bei den Kindern um keine homogene Gruppe handelt. Sowohl die Heterogenität, als auch wie ihr mit Marketingmaßnahmen entgegengetreten wird, soll hier untersucht werden. Diese Arbeit besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Der erste Teil widmet sich ganz des sehr komplexen Segments Kind und wird zeigen, dass esdieZielgruppe Kind gar nicht gibt. Vielmehr handelt es sich um viele junge Zielgruppen, wie der Titel dieser Arbeit schon vermuten lässt. Diese Unterscheidungen sind enorm wichtig, denn allein der soziodemografische Unterschied zwischen einem 5-jährigen Mädchen und einem 16-jährigen Jungen leuchtet unmittelbar ein. Außerdem werden weitere wichtige Einflussfaktoren wie die Peer-Groups und der rechtliche Rahmen behandelt. Auch die Verantwortung, Kindern frühzeitige Werbekompetenz mit auf dem Weg zu geben, wird diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Junge Zielgruppen
- 2.1 Segmentierung nach dem Alter
- 2.1.1 Besonderheiten in Abgrenzung zu erwachsenen Zielgruppen
- 2.1.2 Babys und Kleinkinder
- 2.1.3 Vorschulkinder
- 2.1.4 Schoolkids
- 2.1.5 Pre-Teens
- 2.1.6 Teens
- 2.2 Einflussfaktoren des Lifestyles
- 2.2.1 Familie
- 2.2.2 Schule
- 2.2.3 Peer-Groups
- 2.3 Marktpotenzial junger Konsumenten
- 2.3.1 Kinder als unmittelbarer Kaufentscheider
- 2.3.2 Kinder als Kaufbeeinflusser der Eltern
- 2.3.3 Kinder als Konsumenten von morgen
- 2.4 Schutz von Minderjährigen
- 2.4.1 Werbekompetenz
- 2.4.2 Rechtlicher Rahmen
- 3. Kommunikationsinstrumente
- 3.1 Klassische Kommunikation
- 3.1.1 TV
- 3.1.2 Print
- 3.1.3 Rundfunk
- 3.1.4 Kino
- 3.2 Direktmarketing
- 3.2.1 Werbesendungen
- 3.2.2 Telefon/Fax
- 3.2.3 Internet
- 3.2.4 E-Mail
- 3.2.5 Mobile
- 3.2.6 Clubs
- 3.2.7 Klassische Medien als Direktwerbemedien
- 3.3 Sonstige Below-the-line-Kommunikation
- 3.3.1 Event-Marketing
- 3.3.2 Public Relation
- 3.3.3 Point of Sale
- 3.3.4 Productplacement
- 3.3.5 Licensing
- 3.3.6 Sponsoring
- 4. Schlussbemerkung
- 4.1 Zusammenfassung
- 4.2 Ausblick
- Segmentierung von jungen Zielgruppen nach Alter und Lebenswelten
- Einflussfaktoren auf das Kaufverhalten von Kindern und Jugendlichen, wie Familie, Schule und Peer-Groups
- Marktpotenzial junger Konsumenten und deren Rolle als direkte Kaufentscheider, Kaufbeeinflusser und zukünftige Kunden
- Rechtliche Rahmenbedingungen und ethische Aspekte der Werbung für Kinder
- Vergleich klassischer und direkter Kommunikationsinstrumente und deren Einsatzmöglichkeiten im Kindermarketing
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit "Klassische und direkte Kommunikation mit jungen Zielgruppen im Vergleich" untersucht die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten der Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen in der heutigen Zeit. Sie beleuchtet die wachsende Bedeutung dieser Zielgruppe im Konsumverhalten und die Notwendigkeit, Kinder in der Werbung zu erreichen, aber gleichzeitig auch zu schützen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Stand des Kindermarketings und die Bedeutung der Zielgruppe "Kind" in der heutigen Zeit beleuchtet. Im zweiten Kapitel werden junge Zielgruppen nach Alter segmentiert und die Besonderheiten dieser Gruppen im Vergleich zu erwachsenen Zielgruppen herausgestellt. Dabei werden die unterschiedlichen Lebenswelten, Bedürfnisse und Einflussfaktoren der einzelnen Altersstufen analysiert. Das dritte Kapitel widmet sich den Kommunikationsinstrumenten. Es wird zwischen klassischer Kommunikation, Direktmarketing und anderen Below-the-line-Kommunikationsformen unterschieden. Die einzelnen Instrumente werden mit ihren spezifischen Stärken und Schwächen im Kontext des Kindermarketings vorgestellt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Schlussbemerkung und gibt einen Ausblick auf die Zukunft des Kindermarketings.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Aspekten des Kindermarketings und der Kommunikation mit jungen Zielgruppen. Dazu gehören Themen wie Segmentierung, Lifestyle, Marktpotenzial, Schutz von Minderjährigen, klassische und direkte Kommunikation, Werbekompetenz, rechtlicher Rahmen, below-the-line-Maßnahmen, Kinder als Konsumenten und die Bedeutung von Peer-Groups.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Kindermarketing für Unternehmen so attraktiv?
Kinder verfügen über eigene finanzielle Mittel, beeinflussen Kaufentscheidungen der Eltern erheblich und sind die loyalen Kunden von morgen.
Gibt es "die" Zielgruppe Kind?
Nein, die Gruppe ist sehr heterogen. Man unterscheidet nach Alter in Babys, Vorschulkinder, Schoolkids, Pre-Teens und Teens.
Was versteht man unter "Below-the-line-Kommunikation"?
Dazu zählen nicht-klassische Werbeformen wie Event-Marketing, Sponsoring, Product Placement oder Licensing.
Welchen Einfluss haben Peer-Groups auf junge Konsumenten?
Gleichaltrige (Peer-Groups) prägen den Lifestyle und die Markenpräferenzen von Kindern und Jugendlichen maßgeblich.
Wie werden Kinder vor unlauterer Werbung geschützt?
Es gibt rechtliche Rahmenbedingungen und die Forderung nach Förderung der Werbekompetenz, damit Kinder Werbeabsichten frühzeitig erkennen können.
- Citation du texte
- Kirsten Borgelt (Auteur), 2004, Klassische und direkte Kommunikation mit jungen Zielgruppen im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58669