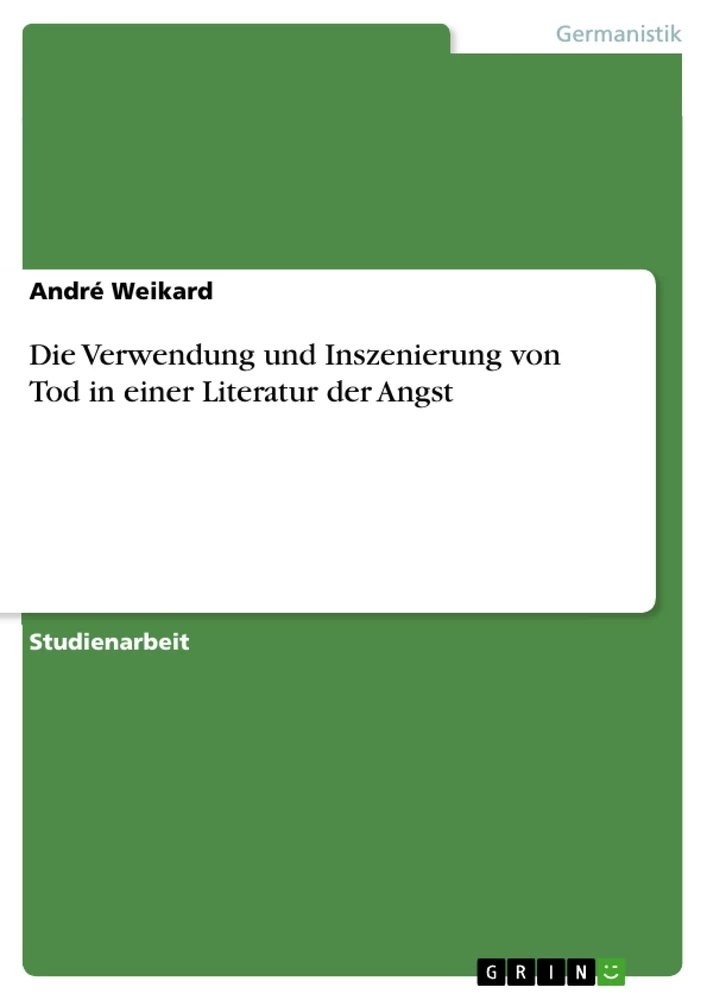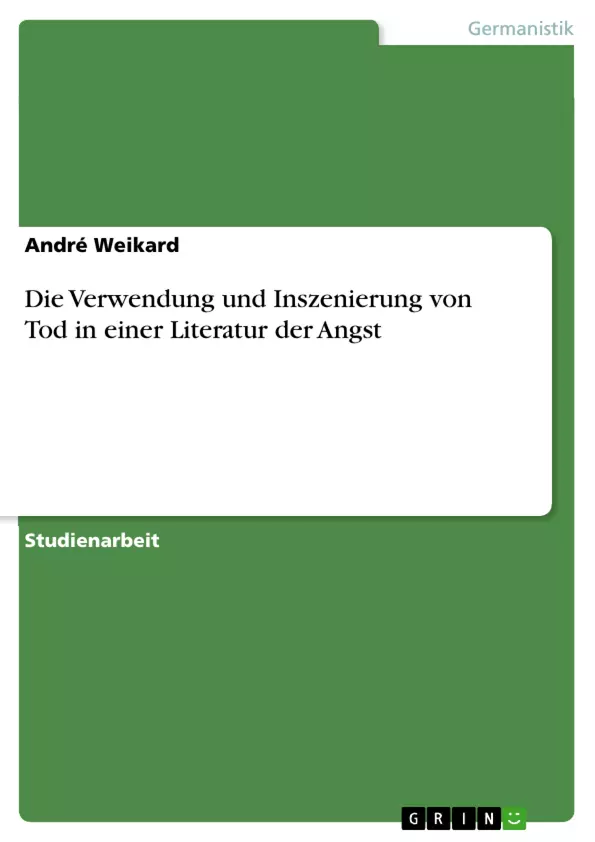Der Ansatz, dem sich diese Arbeit verpflichtet sieht, nämlich Literatur nach Gesichtspunkten der Text-Leser-Interaktion zu untersuchen, tut dies mit dem alles übergreifenden Ziel die emotionale Potenz von Texten zu erklären. Es geht darum, der kantschen Definition von Schönheit als dem, „was ohne Begriff allgemein gefällt“, das „ohne Begriff“ auszutreiben, indem das Gefallen untersucht wird. Gerade dem, was man gemeinhin für unerklärlich hält und was Literatur doch so trefflich vermag, diesem Schmerz „wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns“, soll näher gerückt werden. Es ist damit eine Zugangsweise zu Literatur gewählt, die sowohl die Grenzen des Faches sprengt als auch unsicheres Terrain betritt. Das Wagnis besteht dabei in der Komplexität und Divergenz der menschlichen Psyche und der damit einhergehenden Schwierigkeit, darüber zu gültigen Aussagen zu kommen. Auch diese Arbeit wird sich mit den skizzierten Schwierigkeiten konfrontiert sehen. Manches wird thesenhaft, vieles unentschieden und das Meiste unvollständig bleiben. Und doch erscheint das Ziel lohnend genug, diese Hindernisse in Kauf zu nehmen. Es soll sich mit Angst auseinandergesetzt werden. Mit der, die im Leser provoziert werden soll, also jener, die vom Autor intendiert ist und mit einem ihrer Mittel: dem Tod. Dabei wird zu untersuchen sein, welche Ängste der Tod auslöst. Es werden grundsätzliche Überlegungen anzustellen sein, zu welchem Zweck diese Ängste literarische Verwendung finden und mit welchen Mitteln sie gesteigert werden. Dazu sind verschiedene Arten der Darstellung und Interpretation von Tod durch den Autor, seine Position im Stück oder die Einbindung des Todes in bestimmte Kontexte, die motivgeschichtlich behandelt werden sollen, von Belang und einer eingehenderen Betrachtung wert.
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Tod als herausragender Gegenstand der Ängstigung
3. Ängste im Zusammenhang mit Tod
3.1 Angst vor dem Ende des Bewusstseins
3.2 Angst vor dem Jenseits
3.3 Die Angst um das Hinterbliebene
4. Darstellungen des Todes
4.1 Der einsame Tod
4.2 Der plötzliche Tod
4.3 Der grausame Tod
4.4 Der sanfte Tod
5. Tod als Konsequenz und Strafe
6. Tod und Lust
7. Tabuisierung
8. Tod als Vergleichsgröße
9. Die Personifizierung des Todes
10. Schlafes Bruder
11. Der eingetretene Tod
12. Schluss
13. Literaturverzeichnis
14. Verzeichnis der Abbildungen im Anhang
15. Anhang
1. Einleitung
Der Ansatz, dem sich diese Arbeit verpflichtet sieht, nämlich Literatur nach Gesichtspunkten der Text-Leser-Interaktion zu untersuchen, tut dies mit dem alles übergreifenden Ziel die emotionale Potenz von Texten zu erklären. Es geht darum, der kantschen Definition von Schönheit als dem, „was ohne Begriff allgemein gefällt“, das „ohne Begriff“ auszutreiben, indem das Gefallen untersucht wird.[1] Gerade dem, was man gemeinhin für unerklärlich hält und was Literatur doch so trefflich vermag, diesem Schmerz „wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns“[2], soll näher gerückt werden.
Es ist damit eine Zugangsweise zu Literatur gewählt, die sowohl die Grenzen des Faches sprengt als auch unsicheres Terrain betritt. Das Wagnis besteht dabei in der Komplexität und Divergenz der menschlichen Psyche und der damit einhergehenden Schwierigkeit, darüber zu gültigen Aussagen zu kommen. Auch diese Arbeit wird sich mit den skizzierten Schwierigkeiten konfrontiert sehen. Manches wird thesenhaft, vieles unentschieden und das Meiste unvollständig bleiben. Und doch erscheint das Ziel lohnend genug, diese Hindernisse in Kauf zu nehmen.
Es soll sich mit Angst auseinandergesetzt werden. Mit der, die im Leser provoziert werden soll, also jener, die vom Autor intendiert ist und mit einem ihrer Mittel: dem Tod. Dabei wird zu untersuchen sein, welche Ängste der Tod auslöst. Es werden grundsätzliche Überlegungen anzustellen sein, zu welchem Zweck diese Ängste literarische Verwendung finden und mit welchen Mitteln sie gesteigert werden. Dazu sind verschiedene Arten der Darstellung und Interpretation von Tod durch den Autor, seine Position im Stück oder die Einbindung des Todes in bestimmte Kontexte, die motivgeschichtlich behandelt werden sollen, von Belang und einer eingehenderen Betrachtung wert.
2. Der Tod als herausragender Gegenstand der Angst
Die Literatur wie auch die Malerei ist voll von Darstellungen des Todes. Ungleich mehr Bildzeugnisse haben in vielfältigen Variationen eine Kreuzigungsszene zum Thema als etwa die Auferstehung.[3] Vornehmlich das Drama bestückt die Bühne mit Ermordeten, Vergifteten und Selbstmördern. Man denke dabei nur an Shakespeare, an „Hamlet“. Warum nun aber diese gewaltige Präsenz des Todes, eines Gegenstandes, der dem Rezipienten Anteilnahme, Trauer, vor allem aber Furcht auslösen muss?
Eine der Antworten muss lauten: Weil er das effektivste, das wirkungsmächtigste der Mittel darstellt, über die der Künstler verfügt, um die gewünschten Affekte hervorzurufen. Nicht umsonst ist der aufzuspürende Täter in Kriminalromanen in der Regel ein Mörder und nicht der Beschuldigte eines beliebigen Verbrechens. Der Tod markiert das Ultimum menschlicher Ängste, er verabsolutiert Trennung, Strafe und Unrecht und das mit großer Verlässlichkeit, indem er, als das Schicksal eines jeden begriffen, ein unerreichtes identifikatorisches Potenzial entfaltet. Der Tod hat die Eigenschaften der Worte „immer“ und „nie“, ist in seiner Unumkehrbarkeit eine absolute Qualität.
3. Ängste im Zusammenhang mit Tod
Zu konstatieren, dass die Konfrontation mit Tod unterschiedlichste Ängste auslöst, erscheint banal. Und doch lohnt es, hier innezuhalten und sich in aller Kürze Klarheit darüber zu verschaffen, wie diese Ängste beschaffen sind. Ist doch die Angst vor dem Tod eine reichlich abstrakte, die zu konkretisieren und der sich anzunähern erforderlich erscheint, um den Grundlagen ihrer literarischen Anwendung näher zu kommen.
Es sind im wesentlichen drei Ängste, die in der einschlägigen Literatur mit dem Tod in Verbindung gebracht werden:[4] Die Angst vor dem Ende des Bewusstseins, die vor dem Jenseits und drittens die Sorge um die Welt, die zurückbleibt.
3.1 Angst vor dem Ende des Bewusstseins
Die erste der genannten Ängste ist dabei die elementarste. Der Tod bedeutet die Auslöschung der eigenen Zukunft. Und es scheint so, dass uns aus diesem Grund der frühe Tod mehr Schmerzen bereitet als der späte. Nicht umsonst ist es ein junger Hund, den Grenouille im „Parfum“ erschlägt, um seine Fähigkeiten das Leben in Gerüchen zu konservieren, auszubilden;[5] wie es auch später gerade die jungen, eben erst erblühten Mädchen sind, die seine Opfer werden. Im „Erlkönig“ bemächtigt sich der Tod in Person der unheimlichen Geistgestalt ausgerechnet eines Kindes und auch Gretchen im „Faust“ lädt vor allem durch ihren hilflosen Kindsmord Schuld auf sich. In all diesen Fällen wird die Ablehnung des Lesers gegen die Untat dadurch gesteigert, dass dem Opfer aufgrund seiner Jugend ein größerer Teil Leben vorenthalten wird, als es bei einem älteren der Fall wäre.
Indem er dem Fortbestand des Ichs entgegentritt, stellt der Tod die einzige unverrückbare Grenze individueller Selbstbestimmung dar. Eine Erfahrung, die unabhängig von vorigen Überlegungen, das auf Autonomie bedachte Selbst zutiefst erschüttern muss. Ein Paradebeispiel hierfür liefert der aufgezwungene Tod, der Mord und damit Süskinds „Parfum“. Dieser Roman hält seine Leser in beständiger Erwartung auf und Angst vor dem Tod, dem plötzlichen zumal. Ständig sterben Menschen in brutaler Verkürzung der Erzählzeit. Beinahe jeder verlässt die Erzählung durch seinen Tod, der durch die dauernde Ermahnung, dass jederzeit Tod sein kann, so allgegenwärtig, so folgerichtig wird.[6] Ein Exponat für den zwecklosen Widerstand gegen die Notwendigkeit des Romans ist Richis, der Vater eben jenes Mädchens, das der personifizierte Tod, Grenouille, sich als letztes Opfer erwählt hat und um das sich die Leichen der anderen bereits anordnen. Richis, in Passagen, die durchtränkt sind von expliziten Benennungen von Tod, Angst und Furcht, die dem Leser die enge Verknüpfung vor Augen halten,[7] dieser Richis nun, sieht den Mörder lauern und bemüht sich vergeblich, ihm entgegenzuwirken, ja befördert sogar, im Duktus der antiken Tragödie, indem er die Stadt verlässt, die Sache Grenouilles, indem er die Tochter aus dem Schutz des gut bewachten Hauses entfernt. Der Leser weiß längst, dass die Angst begründet ist, er sieht Grenouille schon lauern, wie der Zeck im Gebüsch, dieses permanent wiederholte Bild,[8] es ihm angekündigt hat. Der Leseeindruck der Ängstigung speist sich aus dem Zusammenspiel der Angst um das Opfer und dem quälenden Vorwissen, das der Anschlag gelingen wird. Im Übertragenen Sinne also aus der Furcht vor dem Tod und dem Wissen um seine Unabwendbarkeit.
3.2 Die Angst vor dem Jenseits
Die zweite der in Verbindung mit dem Tod auftretenden Ängste, die vor dem Jenseits, deutet bereits einen Schutzmechanismus des Geängstigten an: Seine Hoffnungen auf eine Weiterexistenz nach dem Tod. Der Psychologe Klaus Thomas verweist auf Studien, die belegen, dass „Tiefe“ der religiösen Einstellung negativ mit der Angst vor dem Jenseits korreliert.[9] So findet zum Beispiel Hoffmans Nathanael Trost in dem Gedanken, dass den Vater, den er in Gestalt des Coppelius mit dem Teufel im Bunde glaubte, „sein Bund mit dem teuflischen Coppelius [...] nicht ins ewige Verderben gestürzt haben könne“, weil er die Gesichtszüge des Vaters bei der Beerdigung „mild und sanft“ vorfindet.[10]
Und auch Emilia Galotti oder Gretchen in der Kerker-Szene übergeben sich leichter dem Tod, als sie Hoffnungen auf eine jenseitige Gerechtigkeit haben, die ihre Angst mildert. Dieser tröstende Aspekt des Jenseits ist dabei nur die Kehrseite einer Versagensangst vor den Kategorien, welche die Ängstigung hervorgerufen haben. Gemeint ist dabei das Wertekonstrukt auf der Grundlage einer verinnerlichten religiösen Weltsicht, das der modernen Literatur freilich fremd geworden ist. In ihr werden, wie etwa im „Parfum“ solche Versuche, den Tod höheren Mächten und damit indirekt der eigenen Beeinflussung zu unterwerfen, bestenfalls karikiert und lächerlich gemacht. Der Aktionismus, in den die Bürger von Grasse auf die Nachricht eines erneuten Mordes hin verfallen, hat in seiner Beliebigkeit der Methoden zwischen Okkultismus, übereifriger Religiosität und pseudowissenschaftlichen Anwendungen von Hypnose und Magnetismus keine Ähnlichkeit mehr mit dem Ernst, mit dem sich eine Emilia Galotti aus Angst vor jenseitiger Bestrafung dem Tod übergibt.[11]
3.3 Die Angst um das Hinterbliebene
Die Sorge um die zurückgelassene Welt, vornehmlich die Angehörigen exemplifiziert sich literarisch in einer Unmenge von Geistgestalten, denen die Seelenruhe verwährt wird, bis ihnen aus dem Reich der Lebenden, in das sie mit Appellen, Aufrufen und Mahnungen zurückkehren, Gerechtigkeit widerfährt, was zumeist eine ordnungsgemäße Bestattung verlangt. Im Falle Hamlets klagt der ermordete König seine Rache ein, der Prinz daneben auch die Trauer seiner Mutter. Gerade die verbittet sich im Märchen „Das Totenhemdchen“ der Gebrüder Grimm das Kind, weil es, solange das Totenhemdchen, nass von den Tränen der Mutter, nicht getrocknet sei, nicht ruhen könne.[12]
4. Darstellungen des Todes
So vielschichtig, wie sich uns die Ängste, die sich mit dem Ereignis Tod verbinden, präsentieren, so vielgestaltig ist auch seine Darstellung in der Literatur. So werden Teile des Affektbündels dem jeweiligen Zweck angepasst oder ausgeblendet, andere akzentuiert.
Es sollen im Folgenden einige wesentliche „Todesarten“ angedeutet werden.
4.1 Der einsame Tod
Ein wesentlicher Aspekt der Angst vor dem Tod ist es, in der Konfrontation mit ihm einer Erfahrung ausgesetzt zu werden, die keinem anderen nachvollziehbar gemacht werden kann und allein durchlitten werden muss. Eben diese Furcht thematisiert Goethes Ballade vom „Erlkönig“, wenn es die Perspektive des geängstigten Kindes annimmt.[13] Auf die dreifache Frage, ob denn der Vater die Bedrohung nicht wahrnehmen könne, antwortet jener ausweichend mit Beschwichtigungen und rationaler Verkleinerung der Gefahr zu harmlosen Erscheinungen. Das Kind, das deutet schon das wiederholte Fragen an, können diese Antworten nicht beruhigen, es bleibt dem Erlkönig und damit dem Tod allein ausgeliefert.
4.2 Der plötzliche Tod
Dem bereits mehrfach erwähnten „Parfum“ genügt es völlig, die Möglichkeit des plötzlichen Todes durch seine bloße Erwähnung immer wieder zu erneuern, während Grenouille mit zwei Ausnahmen, nicht bei seiner Tat beschrieben wird und auch in den beiden Fällen, nicht von Schmerz oder Widerstand der Opfer berichtet wird, sondern, in ersterem Fall, davon, wie der Mörder beinahe zärtlich-lustvoll die Hände um den Hals seines Opfers legt,[14] welches sich hingibt und im zweiten Fall von kaum mehr als dem Geräusch die Rede ist, das der tödliche Schlag verursacht.[15] Die Angst, die der Tod hier auslöst, speist sich nicht aus besonderer Brutalität, sondern daraus, dass der Tod überfallartig hereinbricht und damit eine dauernde Wachsamkeit des Lesers dieser stillen Gefahr gegenüber erzeugt wird. Dieses System wird programmatisch verkündet: „Die Objekte mußten ruhiggestellt werden, und zwar so plötzlich, daß sie gar nicht mehr dazu kamen, Angst zu haben oder sich zu widersetzen. Er mußte sie töten.“[16] Im Kontrast dazu wird das Ausbleiben von Tod im Leiden der verarmten Amme Grenouilles als besonderes Elend abgebildet.[17] Ganz anderen Regeln der Angsterzeugung folgen dagegen die Todesfälle im „Sandmann“ oder der Tod K.s in Kafkas „Prozess“.
[...]
[1] Kant: Kritik der Urteilskraft, S. 134.
[2] Aus einem Brief Kafkas an Oskar Pollak 1904, enthalten in: Gesammelte Werke. Briefe 1902-1924, S.27.
[3] Ulrich: Tod und Teufel, S.264ff.
[4] Wittkowski: Tod und Sterben, S.64.
[5] Süskind: Das Parfüm, S. 236.
[6] Macht man sich die Mühe, die Todesfälle zu zählen, kommt man auf nicht weniger als 35, darunter die 25 Mädchenmorde Grenouilles.
[7] Süskind: Das Parfum, S.257f.
[8] ebd., beispielsweise auf S.90, 168, 243, 244.
[9] Thomas: Warum Angst vor dem Sterben?, S.20.
[10] Hoffmann: Der Sandmann, S.31.
[11] Süskind: Das Parfum, S.252f, 283f.
[12] Grimm: Kinder- und Hausmärchen, S. 465f.
[13] Goethe: Werke. Bd.1, S.154.
[14] Süskind: Das Prafum, S.56.
[15] Süskind: Das Prafum , S. 275.
[16] ebd., S.236.
[17] ebd., S. 39f.
- Quote paper
- André Weikard (Author), 2005, Die Verwendung und Inszenierung von Tod in einer Literatur der Angst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58823