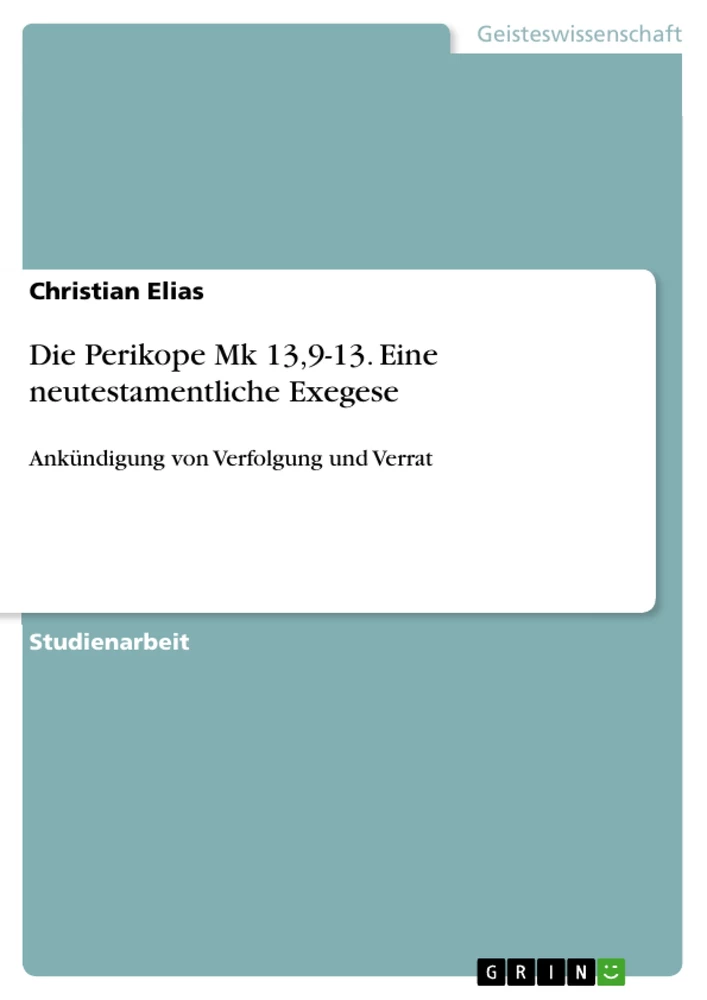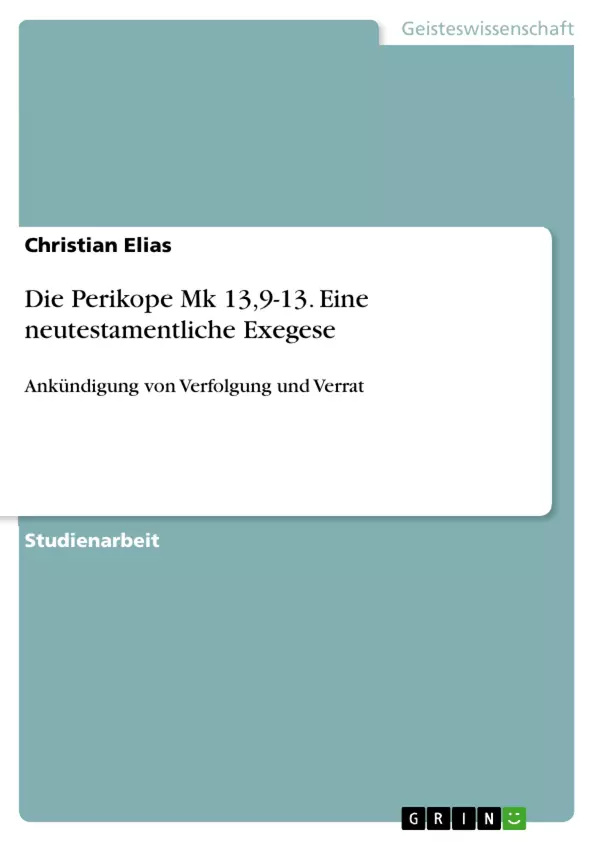Die Perikope Mk 13,9-13 soll hier im Rahmen einer neutestamentlichen Proseminararbeit exegetisiert werden. Gleich zu Beginn findet sich eine Arbeitsübersetzung, die schon zum Teil die erarbeiteten Ergebnisse vorwegnimmt. Es folgen zwei ausgewählte textkritische Probleme und anschließend die klassischen Arbeitsschritte einer Exegese, die sich jedoch nicht strikt voneinander trennen lassen, sondern sich gegenseitig, wie Schnittmengen eines Ganzen, vervollständigen. Dabei wird auf Kontext und Kohärenz als auch linguistische Analysen in Bezug auf Grammatik, Semantik, Syntax und Stil eingegangen. Auf eine abschließende Betrachtung dieses Ganzen soll nicht verzichtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung und Inhalt
- Teil I: Arbeitsübersetzung
- Teil II: Zwei textkritische Probleme
- II. 1. Problem in Vers 9b
- II. 2. Problem in Vers 10
- Teil III: Literarische Analyse
- III.1. Kontext und Kohärenz
- III.2. Linguistische Analysen (Grammatik, Semantik, Syntax, Stil)
- Teil IV: Literarkritik
- IV.1. Aufnahme durch Matthäus 10,17-22 und 24,9-14
- IV.2. Aufnahme durch Lukas in 12,11f. und 21,12-19
- Teil V: Formgeschichte
- V.1. Gattungskritik
- V.2. „Sitz im Leben“
- V.3. Genese der Perikope
- Teil VI: Redaktionsgeschichte
- VI.1. Komposition durch Markus
- VI.2. Aufnahme durch Matthäus
- VI.3. Aufnahme durch Lukas
- Teil VII: Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit befasst sich mit der Exegese der Perikope Mk 13,9-13. Die Arbeit analysiert den Text unter verschiedenen Gesichtspunkten, einschließlich textkritischer Probleme, literarischer und literarkritischer Aspekte, Formgeschichte und Redaktionsgeschichte. Das Ziel ist es, ein tieferes Verständnis des Textes und seiner Bedeutung zu erlangen.
- Textkritik und Variantenanalyse
- Literarische Analyse und Kontextualisierung
- Formgeschichte und Gattungskritik
- Redaktionsgeschichte und Überlieferung
- Theologie der Verfolgung und des Zeugnisses
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I: Arbeitsübersetzung
Die Arbeitsübersetzung des Textes stellt die Grundlage für die weitere Analyse dar und beinhaltet die Interpretationen des Autors.
Teil II: Zwei textkritische Probleme
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit zwei textkritischen Problemen in Vers 9b und Vers 10. Der Autor analysiert die verschiedenen Lesarten und argumentiert für die wahrscheinlichste Lesart anhand von äußeren und inneren Kriterien.
Teil III: Literarische Analyse
Die literarische Analyse untersucht den Text unter verschiedenen Aspekten wie Kontext, Kohärenz, Grammatik, Semantik, Syntax und Stil.
Teil IV: Literarkritik
Dieser Teil analysiert die Verwendung des Textes in den anderen Synoptischen Evangelien (Matthäus und Lukas). Der Autor untersucht, wie die anderen Evangelisten den Text aufgenommen und interpretiert haben.
Teil V: Formgeschichte
Die Formgeschichte beschäftigt sich mit der Entstehung und Überlieferung des Textes. Der Autor untersucht die Gattung des Textes, seinen „Sitz im Leben“ und die Genese der Perikope.
Teil VI: Redaktionsgeschichte
Dieser Teil der Arbeit analysiert die Komposition des Textes durch Markus und untersucht, wie er den Text in sein Evangelium integriert hat. Außerdem wird die Aufnahme des Textes durch Matthäus und Lukas betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die exegetische Analyse des Textes Mk 13,9-13. Die wichtigsten Themen sind Textkritik, literarische Analyse, Formgeschichte, Redaktionsgeschichte, Verfolgung, Zeugnis und der Heilige Geist.
- Quote paper
- Christian Elias (Author), 2004, Die Perikope Mk 13,9-13. Eine neutestamentliche Exegese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/588422