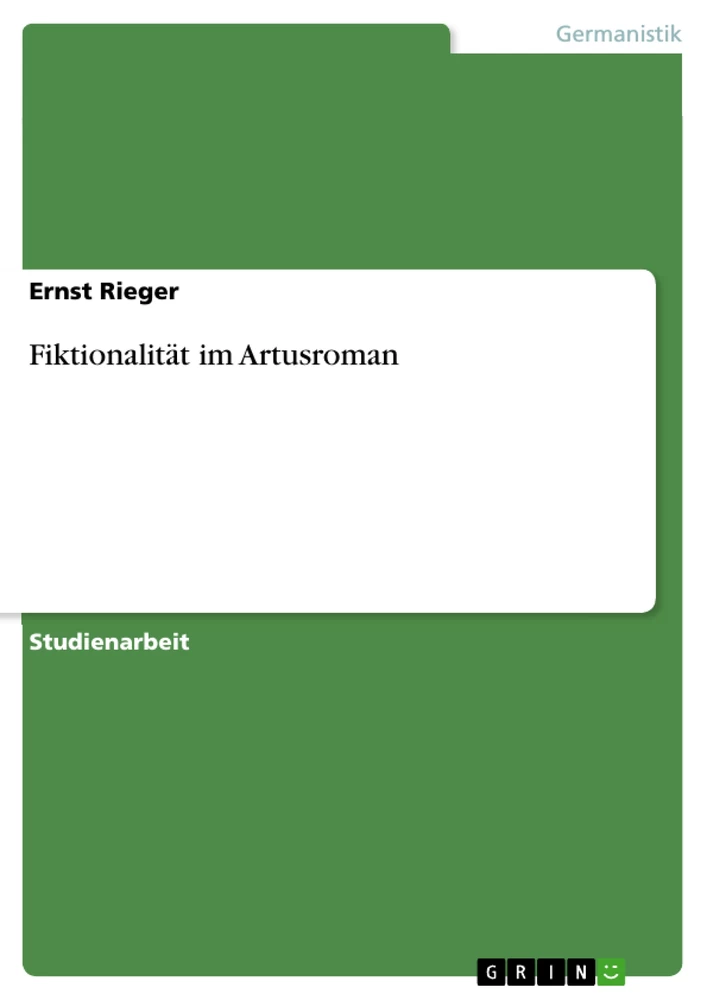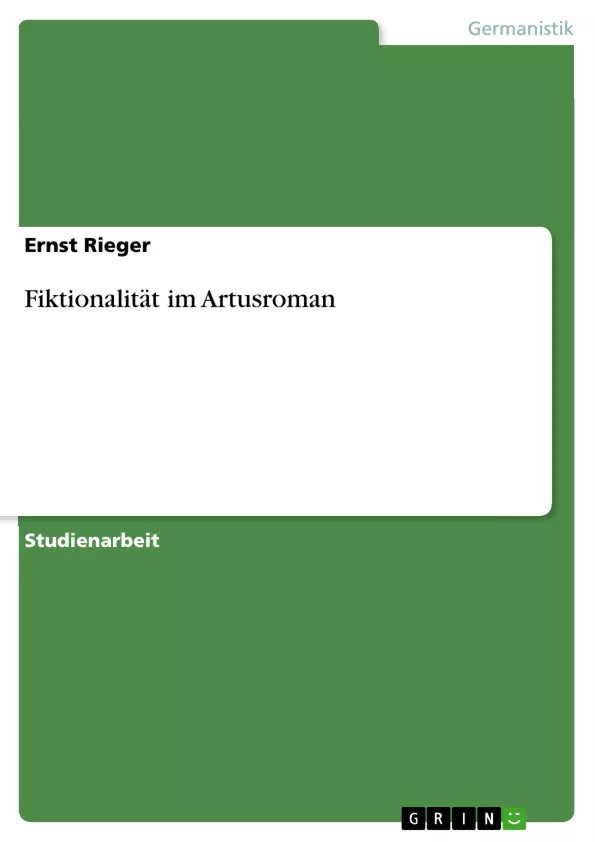Einleitung
Thema dieser Hausarbeit ist die Untersuchung zur Fiktionalität im Artusroman. Platons Diktum der Lüge veranlasste viele Autoren höfischer Romane durch Verweise auf historische Quellen sich in die historisch verbürgte Überlieferung einzureihen. Andere wiederum verwendeten das historisch ausgewiesene Stoffmaterial und veränderten es in der Darstellung (Sinkonstitution etc.)
Auf Grund dessen gibt es noch keine systematische literarische Theorienbildung. Also müssen sich literaturtheoretische Reflexionen in Prologen, Epilogen und sonstigen Erzählerkommentaren finden lassen. Dort verpacken jene ihre Ansprüche an Literatur. Auch sollten sich dort gegebenenfalls Kriterien finden lassen an denen die Fiktionalität des Romans und eine Reflexion über eben diese zu finden ist. Der Artusroman wurde bisher hinsichtlich seines märchenhaften Stoffes, seines strukturellen Entwurf und in neuerer Zeit hinsichtlich einer kommunikativen Dimension von Fiktionalität untersucht.
Meine Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Als Textgrundlage dienen Hartmann von Aues „Erec“1 und Chrétien de Troyes „Erec et Enide“2. Im ersten Teil gebe ich eine Definition literarischer Fiktionalität auf Basis sprechakttheoretischer Untersuchungen und setze sie Verbindung mit der Erzählung im „Erec“. Im zweiten Teil thematisiere ich dann die kommunikative Dimension von Fiktionalität allgemein im „Erec“ und speziell an der Pferde- und Sattelepisode auf der Burg Penefrec. Dabei geht es vor allem um die literarische Inszenierung der Erzählinstanz als Reflexion über Fiktionalität und der Hervorhebung der Autorität des Autors sowie um die Inszenierung des Erzählaktes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Definition literarischer Fiktionalität
- Kommunikative Dimension von Fiktionalität im „Erec“
- Die Projizierung des Autors in die Erzählfigur und die fingierte Aufführungssituation
- Der Begriff der „molt bele conjointure“
- Die Pferde- und Sattelepisode in Hartmann von Aues „Erec“
- Der ästhetische und fiktionale Charakter der Pferde- und Sattelepisode
- Hartmanns Herausstellung seiner Autorschaft und sein Fiktionsbewusstsein
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Fiktionalität im Artusroman, insbesondere im Kontext von Hartmanns „Erec“. Sie untersucht, wie Autoren höfischer Romane die Fiktionalität ihrer Werke durch Verweise auf historische Quellen und eine kommunikative Dimension des Erzählens gestalten. Die Arbeit analysiert die literarische Inszenierung der Erzählinstanz und die Reflexion über Fiktionalität in Hartmanns „Erec“, sowie die Verwendung von sprechakttheoretischen Ansätzen zur Definition von Fiktionalität.
- Die Rolle von Fiktionalität im Artusroman und die Verbindung zu historischen Quellen
- Die Inszenierung der Erzählinstanz und des Erzählaktes in Hartmanns „Erec“
- Die Definition von Fiktionalität durch sprechakttheoretische Ansätze
- Die kommunikatve Dimension von Fiktionalität, insbesondere der „molt bele conjointure“
- Die ästhetische und fiktionale Gestaltung der Pferde- und Sattelepisode
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Fiktionalität im Artusroman ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung von Hartmanns „Erec“. Das erste Kapitel definiert Fiktionalität anhand sprechakttheoretischer Ansätze, insbesondere anhand der Arbeit von J.R. Searle, und setzt diese Definition mit der Erzählung im „Erec“ in Verbindung.
Das zweite Kapitel untersucht die kommunikative Dimension von Fiktionalität in Hartmanns „Erec“. Dabei werden die literarische Inszenierung der Erzählinstanz und des Erzählaktes analysiert. Die Projizierung des Autors in die Erzählfigur und die fingierte Aufführungssituation werden beleuchtet, um die Absicht Hartmanns zu verstehen, eine reale Aufführungssituation zu imitieren und die Autorität des Autors hervorzuheben.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der Pferde- und Sattelepisode in Hartmanns „Erec“. Die Episode wird als Beispiel für die ästhetische und fiktionale Gestaltung im Roman analysiert. Der Fokus liegt auf der Herausstellung von Hartmanns Autorschaft und seinem Fiktionsbewusstsein.
Schlüsselwörter
Artusroman, Fiktionalität, Sprechakttheorie, Kommunikative Dimension, Erzählinstanz, Erzählakt, „Erec“, Hartmann von Aue, Chrétien de Troyes, „molt bele conjointure“, Pferde- und Sattelepisode, Authentizität, Autorität, Fiktionsbewusstsein, Inszenierung, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Untersuchung zum Artusroman?
Die Arbeit untersucht die Fiktionalität im Artusroman, speziell am Beispiel von Hartmann von Aues „Erec“ und Chrétien de Troyes „Erec et Enide“.
Wie wird Fiktionalität in der Arbeit definiert?
Die Definition basiert auf sprechakttheoretischen Untersuchungen, die literarische Fiktion als spezifische Form der Kommunikation zwischen Autor und Leser begreifen.
Was bedeutet der Begriff „molt bele conjointure“?
Es bezeichnet die „sehr schöne Verbindung“ von Stoff und Form, ein zentrales ästhetisches Prinzip in der höfischen Dichtung Chrétien de Troyes.
Welche Rolle spielt die Pferde- und Sattelepisode im „Erec“?
Diese Episode dient als Beispiel für die literarische Inszenierung und Reflexion über Fiktionalität sowie zur Hervorhebung der Autorität des Autors.
Warum verwiesen Autoren oft auf historische Quellen?
Um dem Vorwurf der „Lüge“ (nach Platon) zu entgehen, versuchten Autoren, ihre fiktionalen Erzählungen durch historische Verbürgtheit zu legitimieren.
Was ist die „kommunikative Dimension“ von Fiktionalität?
Sie beschreibt die Inszenierung des Erzählaktes, bei der die Erzählinstanz aktiv mit dem Publikum interagiert und so das Bewusstsein für das Fiktionale schafft.
- Citar trabajo
- Ernst Rieger (Autor), 2005, Fiktionalität im Artusroman, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58912