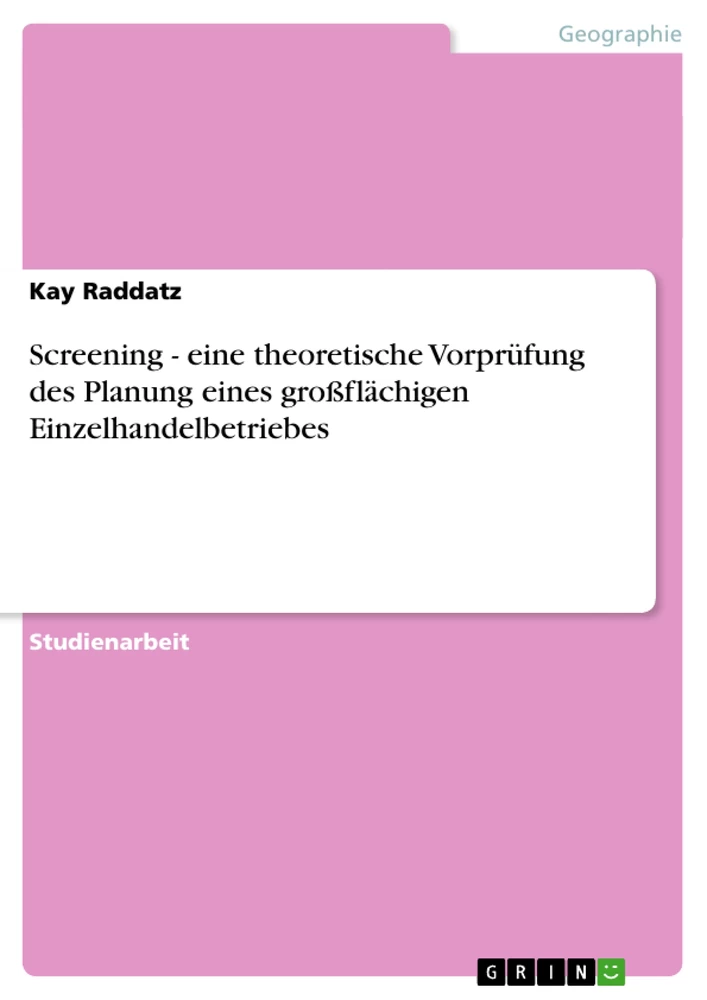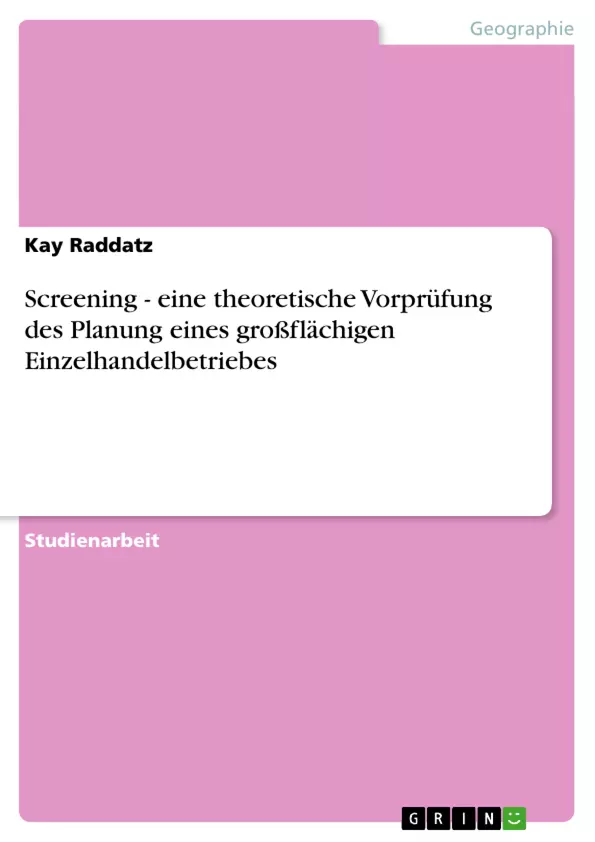Mit zunehmendem Erkenntnisgewinn über die ökologische n Zusammenhänge in Natur und Landschaft und deren Auswirkungen auf eine nachhaltige Raumentwicklung, fand auch auf politischer Seite eine verstärkte Berücksichtigung dieses Themenkomplexes statt. Vor allem die von der europäischen Union ausgehenden Entwicklungen der letzten Jahre bewirken eine forcierter betriebene Beachtung ökologischer Bela nge im Planungsalltag. Hier seien exemplarisch die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie der EU genannt. Für die hiernach klassifizierten Gebiete bestehen für die Planung erhebliche Einschnitte, eine bauliche Nutzung und Beplanung ist, von Einzelfällen abgesehen, geradezu ausgeschlossen. Dies drückt den gewachsenen Stellenwert deutlich aus. Es muss jedoch betont werden, dass ökologische Ausschlussgründe nicht automatisch zu einer Verhinderung der Planung kommen. Viel mehr wird durch die Vorgaben den Umweltschutz stärker zu beachten eine Prüfung auf sinnvolle alternative Standorte betrieben, die die angestrebte Nutzung an einem anderen Platz umweltverträglicher darstellt. Das Stichwort derUmweltverträglichkeitleitet zum eigentlichen Thema der Arbeit über. Von Seiten der EU wurden nicht nur Richtlinien erlassen, die eine Ausweisung bestimmter schützenswerter Gebiete bewirken. Die gemeinhin als Projekt-UVP Richtlinie bekannte Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, war ein erster Schritt gesetzlich legitimierte Verfahren in den einzelnen Mitgliedssaaten einzuführen nach denen eine Beurteilung über die Umweltauswirkungen bestimmter Projekte stattzufinden habe. In Deutschland äußerte sich dies durch die Verabschiedung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Darin werden in Anhang eins zum UVPG Schwellenwerte festgelegt, die eine Prüfpflicht auslösen können (Spalte eins des Anhanges zum UVPG). Dabei wurde für Vorhaben, die die Schwellenwerte zur UVP-Pflicht unterschreiten ein weiterer Wert eingeführt, der eine Vorprüfung (sog. Screening?§ 3c UVPG) mit sich bringt. Diese lassen sich der zweiten Spalte des Anha nges eins entnehmen. Durch die Vorprüfung wird eine eventuelle UVP-Pflicht festgestellt. „Das Screeningverfahren bildet einen Teilschritt im Prüfkonzept der §§ 3a-f UVPG zur Feststellung der UVP-Pflicht“ dabei „handelt es sich um eine Überschlägige Prüfung“ nach den Kriterien der Anlage zwei zum UVPG. [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ZIEL DER ARBEIT
- UNTERSUCHUNGSRAUM
- SCREENING
- ABLAUF
- BEISPIELVORHABEN - ERFASSUNG DER MERKMALE
- Ist ein Vorhaben nach Anlage 1 UVPG vorhanden?
- Werden die Schwellenwerte zur Auslösung einer Prüfpflicht überschritten?
- Sind physische Auswirkungen des Standortes in Bezug auf die Schutzgüter zu erwarten?
- Finden durch das Vorhaben Veränderungen des Orts- und Landschaftsbildes statt?
- Welche Abfallarten und -mengen fallen durch die Realisierung an?
- Werden durch das Vorhaben schädliche oder störende Emissionen (Umweltverschmutzung) erzeugt?
- Besteht durch das Vorhaben ein erhöhtes Unfallrisiko mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt?
- Befindet sich das Vorhaben an einem Standort, der durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt wird?
- ERFASSUNG DES STANDORTES
- Befinden sich auf dem Standort oder in der Umgebung des Vorhabens bestimmte anthropogene schutzbedürftige Nutzungen, die beeinträchtigt werden können?
- Befinden sich am Standort oder in der Umgebung des Vorhabens anthropogene Nutzungen, die eine Beeinträchtigung des Vorhabens bewirken können?
- Kann durch das Vorhaben am Standort oder in der Umgebung eine Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes stattfinden?
- Befinden sich am Standort oder in der Umgebung des Vorhabens rechtsverbindlich ausgewiesene Schutzgebiete, die beeinträchtigt werden können?
- Befindet sich das Vorhaben in einem Gebiet, in dem Immissionsvorbelastungen bestehen und werden diese durch das Vorhaben zusätzlich erhöht?
- Befindet sich das Vorhaben in einem Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte?
- Können durch das Vorhaben am Standort oder in der Umgebung Kulturdenkmäler beeinträchtigt werden?
- Können durch das Vorhaben in Verbindung mit anderen Vorhaben Auswirkungen entstehen, die zu Beeinträchtigungen in einem gemeinsamen Einwirkungsbereich führen?
- ERHEBLICHKEIT
- ANAHNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der theoretischen Vorprüfung der Planung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes in Wermelskirchen im Rahmen des Screening-Verfahrens. Das Ziel ist es, die Bedeutung und Anwendung des Screening-Verfahrens im Umweltrecht zu erläutern und anhand eines Beispielvorhabens die relevanten Kriterien und Abläufe aufzuzeigen.
- Relevanz des Screening-Verfahrens im Umweltrecht
- Anwendung des Screening-Verfahrens in der Praxis
- Kriterien und Abläufe des Screening-Verfahrens
- Einfluss von kummulierenden Vorhaben auf das Screening-Verfahren
- Bewertung von Umweltauswirkungen im Rahmen des Screening-Verfahrens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert den wachsenden Stellenwert des Umweltschutzes in der Raumplanung und beleuchtet die Bedeutung der europäischen Richtlinien für die Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Dabei wird insbesondere die Bedeutung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) hervorgehoben, das ein Screening-Verfahren zur Vorprüfung der Umweltauswirkungen von Projekten vorschreibt.
- Screening: Dieses Kapitel erläutert das Screening-Verfahren als ein Teilschritt im Prüfkonzept der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Es werden die Kriterien und Abläufe des Verfahrens dargestellt, die auf einer überschlägigen Bewertung der Umweltauswirkungen basieren.
- Beispielvorhaben - Erfassung der Merkmale: Dieser Abschnitt widmet sich der konkreten Anwendung des Screening-Verfahrens anhand eines Beispielvorhabens, dem Bau eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes in Wermelskirchen. Es werden die relevanten Merkmale des Vorhabens im Hinblick auf die Screening-Kriterien erfasst.
- Erfassung des Standortes: Dieser Abschnitt analysiert den Standort des geplanten Einzelhandelsbetriebes im Hinblick auf potenzielle Umweltauswirkungen. Dabei werden Kriterien wie Schutzgebiete, anthropogene Nutzungen, Immissionsvorbelastungen und die Bevölkerungsdichte berücksichtigt.
- Erheblichkeit: In diesem Abschnitt wird die Frage der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen im Rahmen des Screening-Verfahrens behandelt. Es wird festgestellt, ob die Umweltauswirkungen des Vorhabens so bedeutend sind, dass eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Screening-Verfahren im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), den Kriterien und Abläufen dieses Verfahrens sowie der Anwendung in der Praxis anhand eines Beispielvorhabens. Dabei werden relevante Themenfelder wie Umweltauswirkungen, Schutzgüter, Schwellenwerte, kummulierende Vorhaben und die Beurteilung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen behandelt.
- Quote paper
- Kay Raddatz (Author), 2005, Screening - eine theoretische Vorprüfung des Planung eines großflächigen Einzelhandelbetriebes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58936