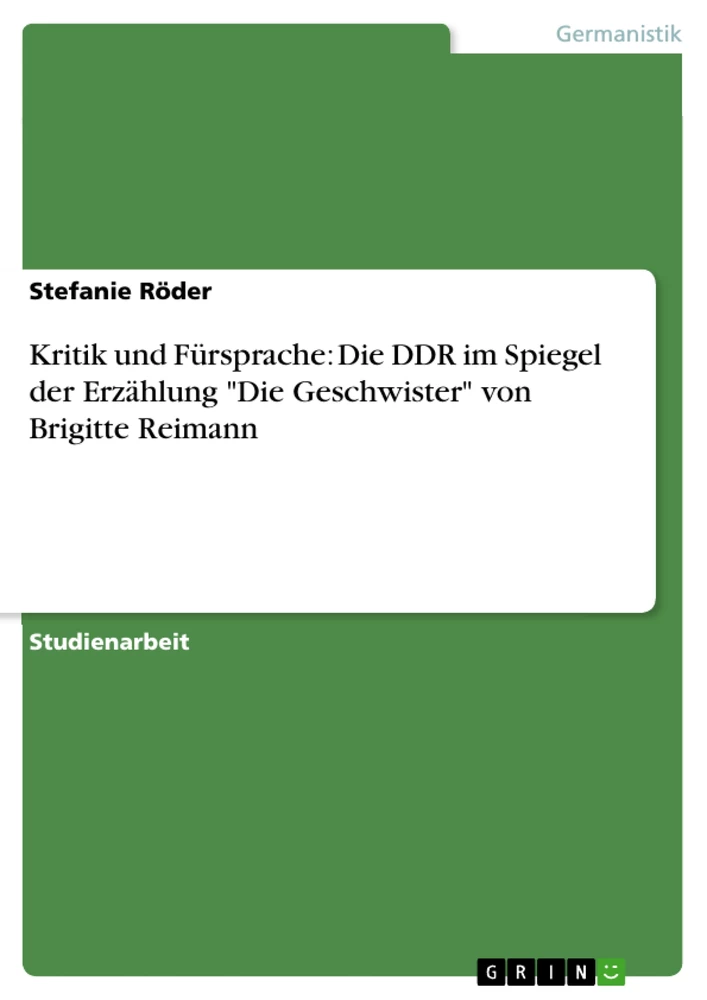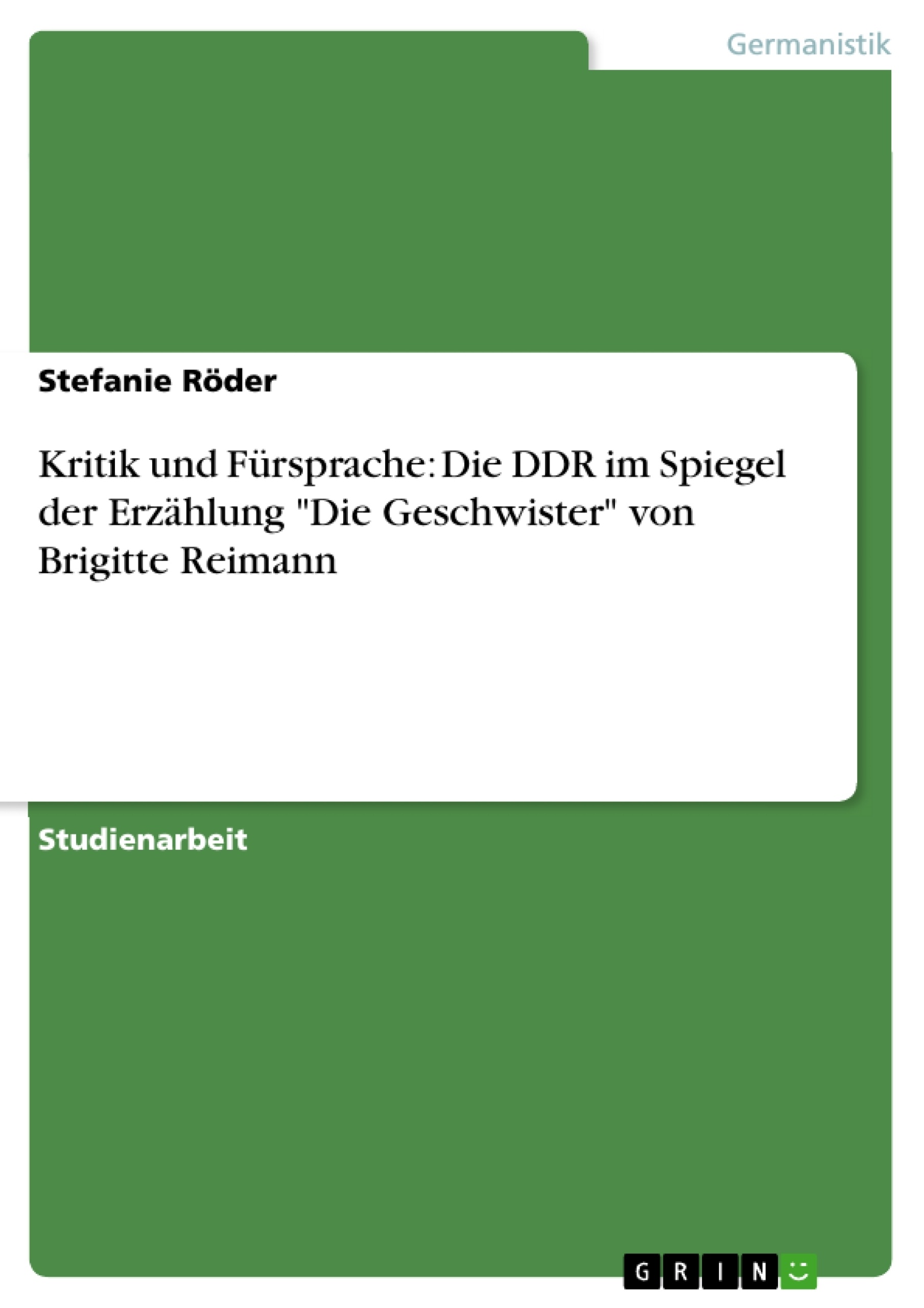Brigitte Reimanns Erzählung Die Geschwister erschien 1964, drei Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer, zu einer Zeit, als „der ständige, die wirtschaftliche Entwicklung in der DDR lähmende und sich allmählich zur Katastrophe ausweitende Aderlass durch die Massenflucht der Bevölkerung gestoppt worden [war]“ und sich im ganzen Land tausendfach die Tragödie von schmerzhaften Familienteilungen abgespielt hatte und noch abspielen sollte. Neben Christa Wolfs RomanDer geteilte HimmelstellteDie Geschwisterdamals eine der bedeutendsten literarischen Umsetzungen dieses Problems dar und traf damit den Nerv der Zeit. Brigitte Reimann schöpfte den Stoff für ihre literarische Arbeit überwiegend aus ihrem eigenen Leben und ihren Erfahrungen. So setzen sich auch die beiden in Die Geschwister miteinander verwobenen Geschichten - die der Schwester Elisabeth und die der Künstlerin Elisabeth - mit Problemen auseinander, die unmittelbar den Lebenserfahrungen der Autorin entstammen. Es soll der Versuch unternommen werden, den verschiedenen Motiven und Figuren der Erzählung reale Ereignisse und Personen aus Brigitte Reimanns Leben zuzuordnen. Als Quellen hierfür werden hauptsächlich Tagebuchaufzeichungen der Autorin sowie eine Biographie von Dorothea von Törne herangezogen. Um diesen biographischen Ansatz zu begründen, werde ich in Kapitel 1 kurz auf das Leben der Autorin und den Charakter ihres literarischen Schaffens eingehen. Den theoretischen Hintergrund hierzu werden Werke von Christa Wolf und Anna Maria Weise bilden. In den beiden folgenden großen Kapiteln -Die Hauptfigur Elisabeth und Bruder und Schwester - wird versucht, Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen der Erzählung und den Erfahrungen der Autorin herauszuarbeiten. Im Wesentlichen soll das in getrennten Abschnitten (Erzählung/ Leben der Autorin) geschehen, aufgrund der komplexen Verflechtungen der beiden Bereiche wird es jedoch zwangsläufig zu Überschneidungen und Vermischungen kommen. Im zweiten Kapitel soll auf die Figur Elisabeth eingegangen werden. Zunächst wird das Augenmerk auf ihre Persönlichkeit und auf evtl. Ähnlichkeiten mit Brigitte Reimann gerichtet. Im Hinblick auf die Tatsache, dass Elisabeth als Malerin in einem Kombinat lebt und arbeitet, werde ich dann auf die wichtigsten Punkte des kulturpolitischen ProgrammsBitterfelder Wegeingehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Person und Werk Brigitte Reimanns
- Leben als Materialquelle zum Schreiben
- Christa Wolfs Konzept der Subjektiven Authentizität bei Brigitte Reimann
- Die Künstlerin Elisabeth
- Die Figur Elisabeth und ihre Parallelen zu Brigitte Reimann
- Elisabeth auf dem Bitterfelder Weg
- Das kulturpolitische Programm ,,Bitterfelder Weg"
- Elisabeths Leben als Künstlerin unter Werktätigen
- Brigitte Reimann auf dem Bitterfelder Weg
- Elisabeths Kunstverständnis im Zusammenhang mit Subjektiver Authentizität
- Begegnungen mit dem Ministerium für Staatssicherheit
- Bruder und Schwester
- Die Geschwister in der Erzählung
- Die Geschwister von Brigitte Reimann und ihr Einfluss auf die Erzählung
- Kritik am System der DDR: Gründe für Ulis Fluchtwunsch
- Bürokratie und Planwirtschaft
- Ulis Verhältnis zur Partei
- Politische Müdigkeit und mangelnder Idealismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Brigitte Reimanns Erzählung „Die Geschwister“ im Kontext ihrer Biografie und des historischen Hintergrundes der DDR in den frühen 1960er Jahren. Der Fokus liegt darauf, die Verbindung zwischen Reimanns Leben und ihrem Schreiben aufzuzeigen, insbesondere im Hinblick auf die Darstellung von Flucht und Grenzerfahrungen in der Erzählung.
- Die Verbindung zwischen Biografie und Literatur: Wie spiegelt sich Reimanns eigenes Leben in „Die Geschwister“ wider?
- Die Darstellung von Flucht und Grenzerfahrungen in der DDR: Wie werden die Ursachen für Ulis Fluchtwunsch dargestellt?
- Der „Bitterfelder Weg“ und seine Auswirkungen auf Künstler in der DDR: Wie reflektiert die Erzählung die kulturpolitischen Vorgaben der DDR?
- Die Rolle der Subjektiven Authentizität in Reimanns Werk: Wie lässt sich die Figur Elisabeth im Zusammenhang mit Christa Wolfs Konzept der Subjektiven Authentizität interpretieren?
- Die Begegnung mit der Stasi: Wie werden die Auswirkungen des Überwachungsapparates in der Erzählung dargestellt?
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die literarische Bedeutung von „Die Geschwister“ im Kontext der DDR in den frühen 1960er Jahren dar. Sie skizziert den biographischen Hintergrund von Brigitte Reimann und die Quellen, die für die Analyse genutzt werden.
Kapitel 1 beleuchtet Reimanns Leben und literarisches Schaffen. Es wird auf die Verbindung zwischen ihrem eigenen Leben und ihren literarischen Werken, sowie auf Christa Wolfs Konzept der Subjektiven Authentizität im Zusammenhang mit Reimanns Werk eingegangen.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Figur Elisabeth in „Die Geschwister“. Es werden die Parallelen zwischen der Figur und Brigitte Reimann untersucht, sowie Elisabeths Erfahrungen als Künstlerin unter dem „Bitterfelder Weg“. Das Kapitel beleuchtet auch die Begegnungen Elisabeths mit dem Ministerium für Staatssicherheit und Reimanns literarische Auseinandersetzung mit der Stasi.
Kapitel 3 fokussiert auf das Verhältnis zwischen Elisabeth und ihrem Bruder Uli, insbesondere auf die Gründe für Ulis Fluchtwunsch. Es wird die Darstellung von Bürokratie und Planwirtschaft, Ulis Verhältnis zur Partei sowie die politische Müdigkeit und mangelnder Idealismus in der Erzählung analysiert.
Schlüsselwörter
Brigitte Reimann, Die Geschwister, DDR, Flucht, Grenzerfahrung, Bitterfelder Weg, Subjektive Authentizität, Stasi, Kulturpolitik, Planwirtschaft, Bürokratie.
Häufig gestellte Fragen
Wovon handelt Brigitte Reimanns Erzählung "Die Geschwister"?
Die Erzählung thematisiert die drohende Flucht des Bruders Uli aus der DDR in den Westen und den Versuch seiner Schwester Elisabeth, ihn zum Bleiben zu bewegen.
Was versteht man unter "Subjektiver Authentizität"?
Ein von Christa Wolf geprägtes Konzept, das die enge Verbindung zwischen dem eigenen Erleben der Autorin und ihrer literarischen Gestaltung beschreibt.
Was war der "Bitterfelder Weg" in der DDR-Kulturpolitik?
Ein Programm, das Künstler dazu aufrief, in Betrieben zu arbeiten, und Arbeiter ermutigte, selbst literarisch tätig zu werden ("Greif zur Feder, Kumpel!").
Welche realen biographischen Bezüge gibt es in der Erzählung?
Brigitte Reimann verarbeitete in "Die Geschwister" eigene Erfahrungen mit der Flucht ihrer Brüder und ihr Leben als Künstlerin in einem Kombinat.
Warum will die Figur Uli die DDR verlassen?
Gründe sind die lähmende Bürokratie, die Planwirtschaft, Konflikte mit der Partei und ein allgemeiner Mangel an Idealismus im System.
Wie wird das Ministerium für Staatssicherheit in der Erzählung dargestellt?
Die Erzählung reflektiert die bedrückende Atmosphäre der Überwachung und die Begegnungen der Protagonistin mit dem Staatsapparat.
- Quote paper
- Stefanie Röder (Author), 2005, Kritik und Fürsprache: Die DDR im Spiegel der Erzählung "Die Geschwister" von Brigitte Reimann , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58937