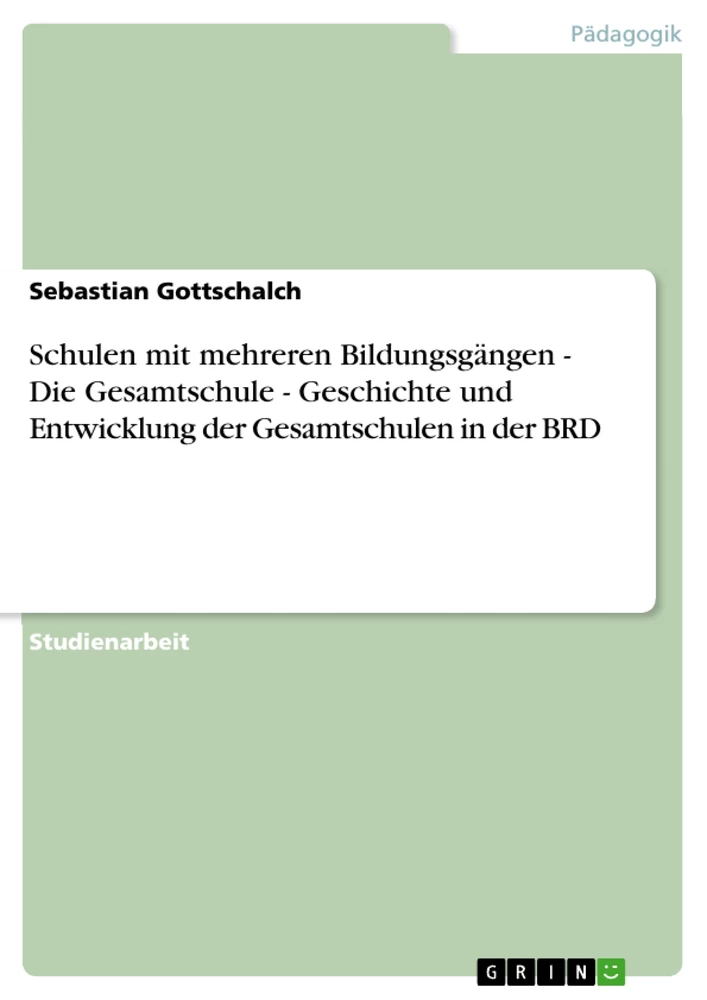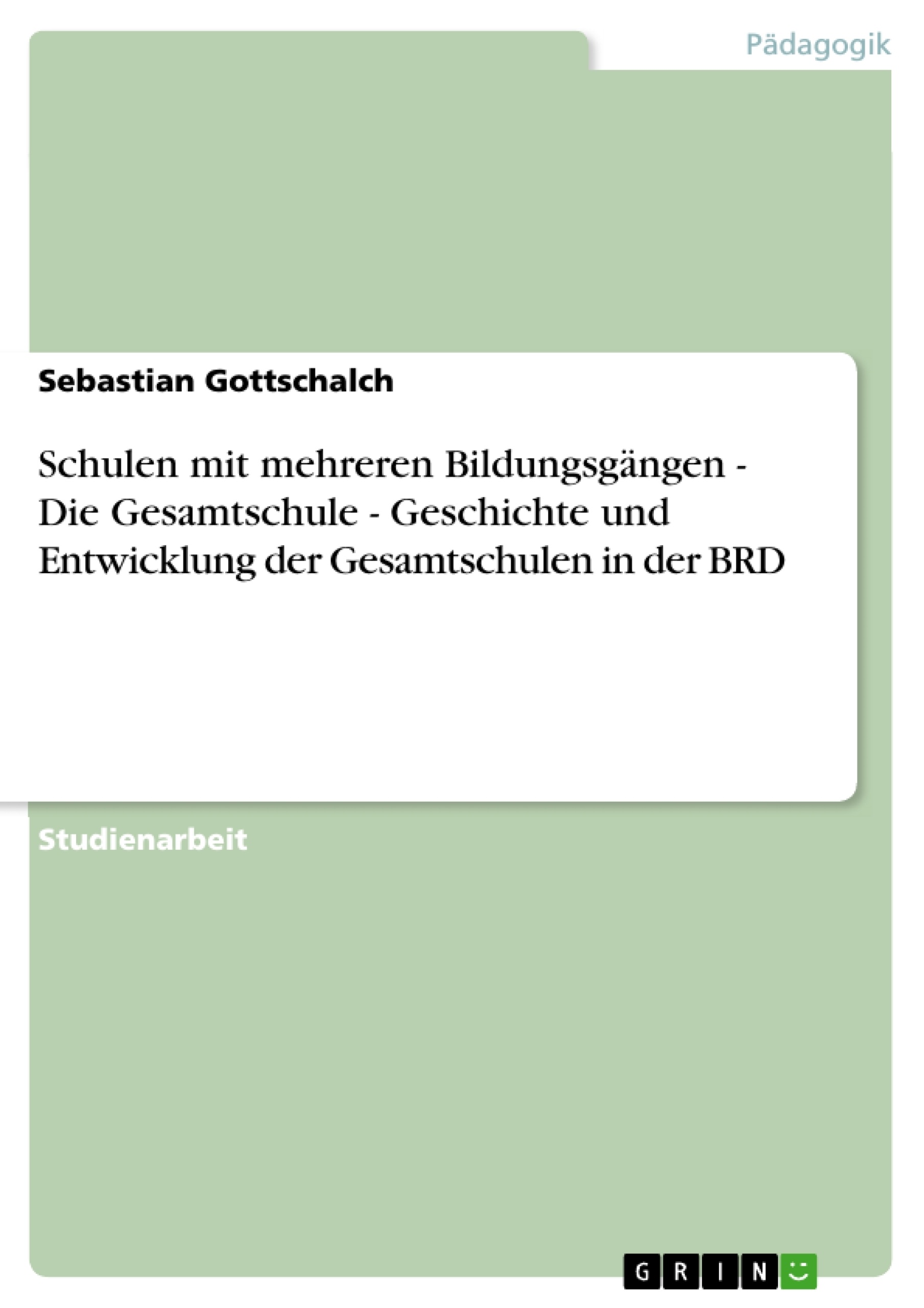„Die integrierte Gesamtschule ersetzt die drei traditionellen Schulformen. Sie führt die Jahrgangsstufen 5-10, oftmals auch eine eigenen gymnasiale Oberstufe. An die Stelle der starren Gliederung nach Schulformen tritt in der Sekundarstufe I eine vielfältige und flexible Unterrichtsform innerhalb einer Schule. Als Organisationsform des Unterrichts ergänzen sich dabei die Jahrgangsklasse, der Unterricht in Fachleistungskursen, Wahlpflichtveranstaltungen und Wahlangebote. Dagegen bleiben in der kooperativen Gesamtschule die drei traditionellen Schulformen bestehen. Sie werden jedoch in einem Schulzentrum zusammengefasst, organisatorische und curriculare Abstimmungen sollen den Wechsel zwischen den Schulformen erleichtern.“
Diese Arbeit bezieht sich meist auf die integrierte Gesamtschule, da die kooperative nicht mehr viele von der ursprünglichen Idee der Gesamtschule erkennen lässt. Sie zeigt die Geschichte und Entwicklung der Gesamtschulen in der Bundesrepublik Deutschland sowie die Grundzüge ihres Bildungsprogramms auf, um sich abschließend mit der Frage auseinanderzusetzen: Hat die Gesamtschule in unserem Land eine Zukunft?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung und Entwicklung
- Die heutige Situation
- Grundzüge des Bildungsprogramms
- Organisation des Unterrichts
- Fachleistungsdifferenzierung
- Flexible Differenzierung
- Wahlpflicht und Wahldifferenzierung
- Die Gesamtschul-Oberstufe
- Ursprüngliche Konzepte für die Gesamtschul-Oberstufe
- Die neue gymnasiale Oberstufe
- Die Profiloberstufe - Ein Weg aus der Krise
- Die Zukunft der Gesamtschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte und Entwicklung der Gesamtschulen in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere der integrierten Gesamtschule. Ziel ist es, die Entstehung, Entwicklung und den aktuellen Stand der Gesamtschulen zu beleuchten und die Herausforderungen zu analysieren, denen diese Schulform gegenübersteht.
- Entwicklung der Gesamtschule im Kontext der Bildungsreformbestrebungen
- Vergleich integrierte vs. kooperative Gesamtschulen
- Differenzierung des Unterrichts an Gesamtschulen
- Gesamtschule im Wettbewerb mit dem gegliederten Schulsystem
- Zukunftsperspektiven der Gesamtschule
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit konzentriert sich auf die integrierte Gesamtschule und deren Entwicklung im Vergleich zum kooperativen Modell. Es wird der Unterschied zwischen den beiden Modellen herausgestellt und die integrierte Gesamtschule als Ersatz für die traditionellen Schulformen vorgestellt. Die einführende Darstellung legt den Fokus auf die Organisationsformen des Unterrichts innerhalb der integrierten Gesamtschule und hebt deren Flexibilität hervor.
Entstehung und Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext der Entstehung der Gesamtschule, ausgehend von der Forderung nach mehr Chancengleichheit und Durchlässigkeit im Bildungssystem. Der Einfluss von Wilhelm von Humboldt und die Entwicklungen in anderen Ländern werden diskutiert. Der Text beschreibt die unterschiedlichen Entwicklungen in Ost- und Westdeutschland und die Herausforderungen bei der Umsetzung des Gesamtschulmodells in der BRD. Die unterschiedlichen Ansätze und Umsetzungen der Gesamtschulversuche in den einzelnen Bundesländern werden detailliert dargestellt, von der anfänglichen Euphorie bis zur späteren Kompromisslösung der Kultusministerkonferenz von 1982. Der Abschnitt hebt die unterschiedlichen Interpretationen und Umsetzungen des Gesamtschulmodells in den einzelnen Bundesländern hervor und beleuchtet die Herausforderungen und den politischen Kontext der Entwicklung.
Die heutige Situation: Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Stand der Gesamtschulen nach der Einführungs- und Etablierungsphase. Es wird die Akzeptanz der Gesamtschule als Wahlalternative, aber auch die Ernüchterung über ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit diskutiert. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Situationen, in denen sich Gesamtschulen befinden können: als Einzelschule in einem vielfältigen Schulangebot, als Teil der schulischen Basisversorgung einer Kommune und unter Konkurrenzdruck. Die Rolle der Grundschullehrerberatung im Schulwechselprozess und die Herausforderungen im Wettbewerb mit dem gegliederten Schulsystem werden ebenfalls thematisiert. Die Herausforderungen für Gesamtschulen im Wettbewerb mit dem gegliederten System und die Veränderungen, die im gegliederten System selbst stattgefunden haben, werden detailliert betrachtet.
Schlüsselwörter
Gesamtschule, integrierte Gesamtschule, kooperative Gesamtschule, Chancengleichheit, Bildungssystem, Schulreform, dreigliedriges Schulsystem, Differenzierung, Unterrichtsorganisation, Schulentwicklung, Bildungspolitik, Bundesländer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gesamtschule in der Bundesrepublik Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Gesamtschule in der Bundesrepublik Deutschland. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der integrierten Gesamtschule und deren Entwicklung im Vergleich zum kooperativen Modell. Die Arbeit untersucht Entstehung, Entwicklung, den aktuellen Stand und die Herausforderungen dieser Schulform.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Entstehung der Gesamtschule im Kontext von Bildungsreformbestrebungen, einen Vergleich zwischen integrierten und kooperativen Gesamtschulen, die Unterrichtsdifferenzierung an Gesamtschulen, den Wettbewerb der Gesamtschule mit dem gegliederten Schulsystem und die Zukunftsperspektiven der Gesamtschule. Die historische Entwicklung, inklusive der Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland und der Rolle der Kultusministerkonferenz, wird ebenso detailliert dargestellt wie die aktuelle Situation der Gesamtschulen, einschließlich der Herausforderungen im Wettbewerb mit dem gegliederten System.
Welche Arten von Gesamtschulen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht hauptsächlich die integrierte und die kooperative Gesamtschule. Es wird der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen herausgestellt und die integrierte Gesamtschule als Alternative zu traditionellen Schulformen vorgestellt.
Wie wird die Unterrichtsorganisation an Gesamtschulen beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Organisationsformen des Unterrichts innerhalb der integrierten Gesamtschule und hebt deren Flexibilität hervor. Konkrete Aspekte wie Fachleistungsdifferenzierung, flexible Differenzierung und Wahlpflicht/Wahldifferenzierung werden behandelt.
Welche Herausforderungen werden für die Gesamtschule genannt?
Die Arbeit analysiert verschiedene Herausforderungen, denen Gesamtschulen gegenüberstehen. Dazu gehören der Wettbewerb mit dem gegliederten Schulsystem, die Akzeptanz als Wahlalternative, die Beurteilung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit und die unterschiedlichen Situationen, in denen sich Gesamtschulen befinden können (z.B. als Einzelschule oder Teil der schulischen Basisversorgung einer Kommune).
Welche Rolle spielt die Geschichte der Gesamtschule in dieser Arbeit?
Die historische Entwicklung der Gesamtschule wird ausführlich dargestellt. Die Arbeit beleuchtet den Kontext der Entstehung ausgehend von der Forderung nach mehr Chancengleichheit und Durchlässigkeit im Bildungssystem, den Einfluss von Wilhelm von Humboldt und die Entwicklungen in anderen Ländern. Die unterschiedlichen Entwicklungen in Ost- und Westdeutschland und die Herausforderungen bei der Umsetzung des Gesamtschulmodells in der BRD werden detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit beschreiben, sind: Gesamtschule, integrierte Gesamtschule, kooperative Gesamtschule, Chancengleichheit, Bildungssystem, Schulreform, dreigliedriges Schulsystem, Differenzierung, Unterrichtsorganisation, Schulentwicklung, Bildungspolitik, Bundesländer.
- Quote paper
- Sebastian Gottschalch (Author), 2005, Schulen mit mehreren Bildungsgängen - Die Gesamtschule - Geschichte und Entwicklung der Gesamtschulen in der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58956