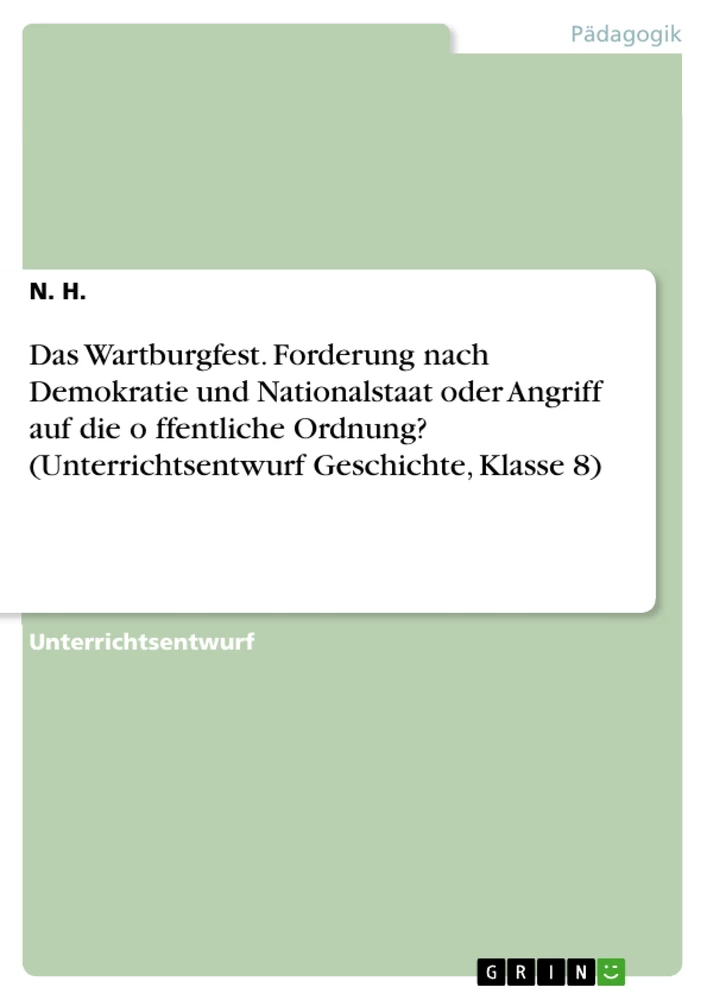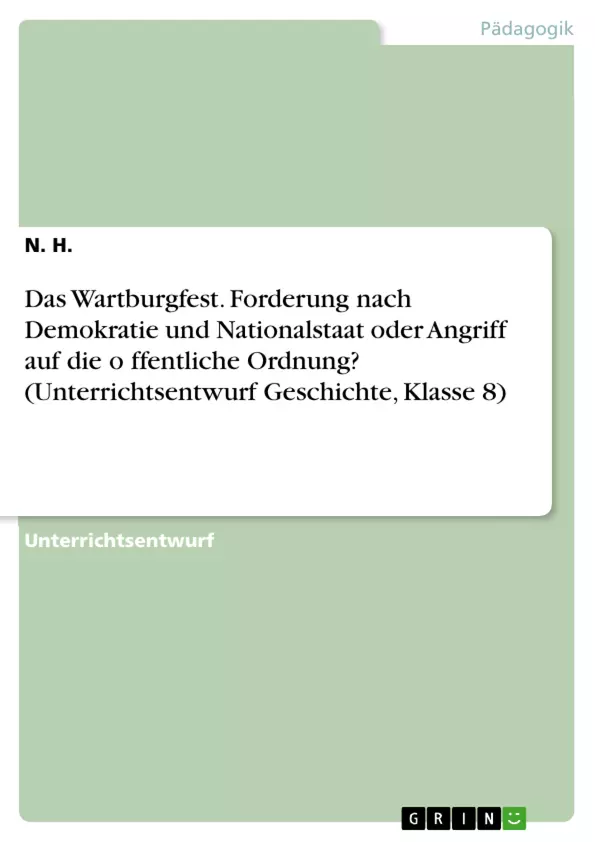Es handelt sich um einen Unterrichtsentwurf im Fach Geschichte (Klasse 8) zur Thematik Wartburgfest und der Forderung nach Demokratie. Die SuS sollen die Bedeutung des Wartburgfestes in Bezug auf die nationale und liberale Bewegung erläutern und erklären können, ob das Wartburgfest die Forderung nach Demokratie und Nationalstaat oder einen Angriff auf die öffentliche Ordnung war. Außerdem sollen sie erkennen, dass eine Radikalisierung der Studenten bezüglich der Durchsetzung ihrer Forderungen möglich war und sie sollen beurteilen können, welche Gefahr die Forderungen für die Obrigkeit bedeutete
Das 19. Jahrhundert stellt ein Themenfeld dar, das in der Geschichtswissenschaft stets besondere Aufmerksamkeit findet. So bezeichnet Ralf Pröve den Betrachtungszeitraum als „‘Epoche des Übergangs‘, als ‚zentrale Passage der deutschen Geschichte auf dem Weg von der staatlichen Vielfalt des Alten Reiches zur nationalstaatlich-demokratischen Ordnung des Staates‘ […]“. Charakteristisch für die Zeit waren revolutionäre Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik. Betroffen von den Umwälzungen waren weiterhin das Militär- und Kriegswesen, welche im sogenannten langen 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielen sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Großer Unterrichtsentwurf
- Lerngruppenanalyse
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Methodische Analyse
- Lernzielformulierung
- Bibliographie
- Anhang
- 1.1 Lerngruppenanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Unterrichtsentwurf beschäftigt sich mit dem Wartburgfest im Kontext des 19. Jahrhunderts. Die Stunde soll den Schülerinnen und Schülern das Ereignis als einen Ausdruck des Strebens nach Demokratie und Nationalstaatlichkeit näher bringen und gleichzeitig die Kritik an den möglichen Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung beleuchten.
- Das Wartburgfest als Ausdruck des deutschen Nationalismus und des Strebens nach Einheit
- Der Zusammenhang zwischen dem Wartburgfest und der Forderung nach Demokratie und einem Nationalstaat
- Kritik am Wartburgfest als Angriff auf die öffentliche Ordnung und die bestehenden Machtverhältnisse
- Die Rolle des Bürgertums als "Träger" und "Spiegel" nationaler und liberaler Bestrebungen
- Die Bedeutung des Wartburgfestes im Kontext der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
- Großer Unterrichtsentwurf: Dieser Teil des Textes enthält eine umfassende Analyse der Lerngruppe, der Sachanalyse, der didaktischen Analyse, der methodischen Analyse, der Lernzielformulierung, der Bibliografie und des Anhangs.
- Lerngruppenanalyse: Dieser Abschnitt bietet einen detaillierten Einblick in die Zusammensetzung und das Lernverhalten der Klasse 8. Er beleuchtet die Schüler-Lehrer-Beziehung, das Leistungsvermögen und die Arbeitshaltung der Schüler. Der Text zeigt die vorhandenen Stärken und Schwächen der Lerngruppe auf und identifiziert wichtige Aspekte für die Unterrichtsplanung.
- Sachanalyse: Der Text analysiert das 19. Jahrhundert als Epoche des Wandels und des Übergangs. Er beleuchtet die revolutionären Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik und die Rolle des Bürgertums als "Träger" und "Spiegel" nationaler und liberaler Bestrebungen. Der Abschnitt beschreibt die Entstehung der deutschen Nationalbewegung und die Bedeutung von Ereignissen wie dem Wartburgfest.
Schlüsselwörter
Der Text behandelt zentrale Themen und Konzepte wie das Wartburgfest, deutscher Nationalismus, Demokratie, Nationalstaat, öffentliche Ordnung, Bürgertum, liberale Bestrebungen, politische Partizipation, Herrschaftsanspruch, 19. Jahrhundert, Epoche des Übergangs, revolutionäre Veränderungsprozesse, Individualisierung, Emanzipation, industrielle Revolution, historisches-sozialer Kontinuitätsbruch, Nationalgefühl, studentische Burschenschaften, Deutscher Bund.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Wartburgfest von 1817?
Das Wartburgfest war eine Versammlung von etwa 500 Studenten, die anlässlich des 300. Jubiläums der Reformation und des vierten Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig für nationale Einheit und Freiheit demonstrierten.
Welche politischen Forderungen wurden auf dem Wartburgfest erhoben?
Die Teilnehmer forderten die Überwindung der Kleinstaaterei zugunsten eines deutschen Nationalstaates sowie liberale Bürgerrechte und eine demokratische Verfassung.
Warum sah die Obrigkeit im Wartburgfest einen Angriff auf die öffentliche Ordnung?
Die radikalen Reden und die symbolische Verbrennung von „reaktionären“ Schriften wurden als Bedrohung für die bestehenden Machtverhältnisse des Deutschen Bundes und die monarchische Souveränität wahrgenommen.
Welche Rolle spielten die studentischen Burschenschaften?
Die Burschenschaften waren die treibende Kraft hinter dem Fest. Sie verkörperten den wachsenden deutschen Nationalismus und das Streben des Bürgertums nach politischer Partizipation.
Wie wird das 19. Jahrhundert in diesem Kontext beschrieben?
Es wird als „Epoche des Übergangs“ bezeichnet, in der revolutionäre Veränderungsprozesse in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik den Weg von der staatlichen Vielfalt zur nationalstaatlichen Ordnung ebneten.
Was sollen Schüler in diesem Unterrichtsentwurf lernen?
Die SuS sollen die nationale und liberale Bedeutung des Festes erläutern, die Gefahr für die damalige Obrigkeit beurteilen und die Radikalisierungstendenzen innerhalb der Studentenbewegung kritisch hinterfragen.
- Quote paper
- N. H. (Author), 2011, Das Wartburgfest. Forderung nach Demokratie und Nationalstaat oder Angriff auf die öffentliche Ordnung? (Unterrichtsentwurf Geschichte, Klasse 8), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/590604