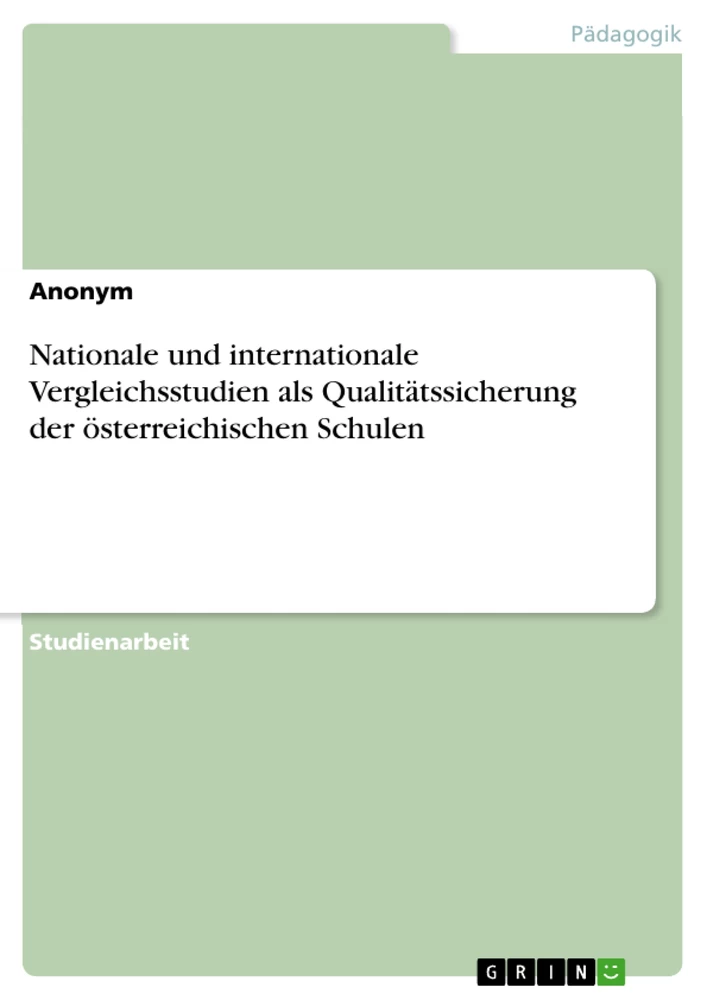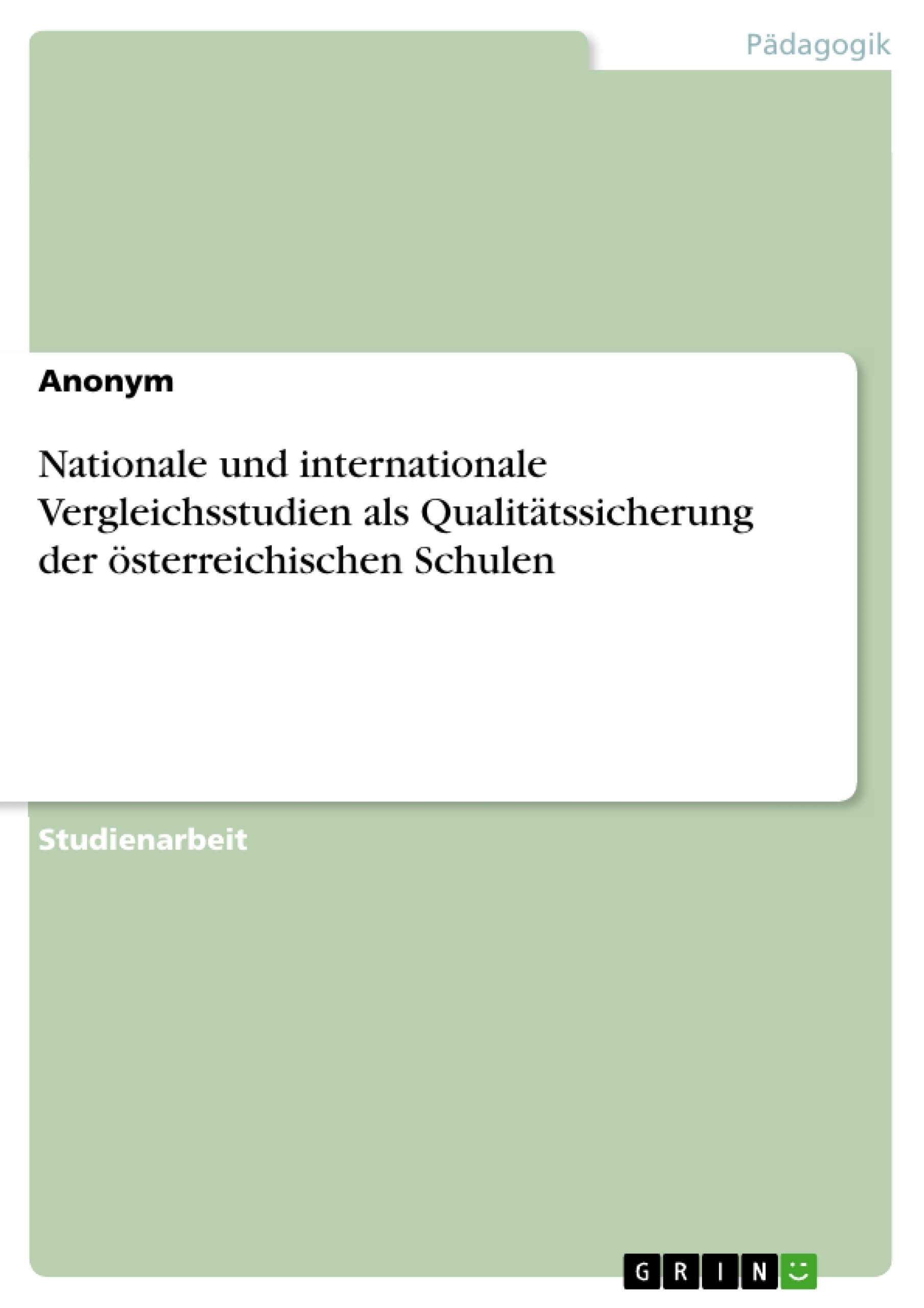Das Bildungssystem in Österreich steht immer wieder vor einigen Herausforderungen. Eine Rolle spielt dabei die Unterrichts- und Schulqualität, die nach Altrichter, Helm und Kanape-Willingshofer (2016) aus sechs großen Qualitätsbereichen besteht: Lernerfahrungen und Lernergebnisse, Lernen und Lehrer, Lebensraum Klasse und Schule, Führung und Schulmanagement, Professionalität und Personalentwicklung und letztlich Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen. Doch wie wird die Unterrichts- und Schulqualität gemessen und ihre Qualität gesichert? In Österreich gibt es beispielsweise die so genannten Bildungsstandards, die aus den Lehrplänen abgeleitet werden und im Rahmen der Bildungsstandardsüberprüfungen als nationaler Messstab dienen. Um die österreichischen Leistungen mit anderen Ländern zu vergleichen, gibt es internationale Vergleichsstudien: Zu den Bekannten gehören dabei zum einen die Studien PISA und TALIS, zum anderen die Studien PIRLS und TIMSS (Eder & Altrichter, 2009).
Die vorliegende Arbeit soll näher auf das Thema der Unterrichts- und Schulqualität eingehen und sich dabei auf die Qualitätssicherung beziehen, zu dessen Instrumenten auch nationale und internationale Vergleichsstudien zählen. Diese sollen im Zuge der Arbeit besonders in Hinblick auf das österreichische Bildungssystem beleuchtet werden. Daraus ergibt sich folgende
Forschungsfrage: „Inwiefern tragen nationale und internationale Vergleichsstudien im Kontext Schulleistungen zur Qualitätssicherung des österreichischen Bildungssystems bei?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nationale Vergleichsstudien
- Kompetenzorientierung und Bildungsstandards
- IKM
- Internationale Vergleichsstudien
- PISA
- TALIS
- TIMSS
- PIRLS
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle nationaler und internationaler Vergleichsstudien bei der Qualitätssicherung des österreichischen Bildungssystems. Sie analysiert, inwieweit diese Studien zur Verbesserung der Unterrichts- und Schulqualität beitragen.
- Qualitätssicherung im österreichischen Bildungssystem
- Nationale Vergleichsstudien (Bildungsstandards, IKM)
- Internationale Vergleichsstudien (PISA, TALIS, TIMSS, PIRLS)
- Kompetenzorientierung und deren Messung
- Einflussfaktoren auf die Schul- und Unterrichtsqualität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Qualitätssicherung im österreichischen Bildungssystem ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Beitrag nationaler und internationaler Vergleichsstudien zur Qualitätssicherung. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Qualitätssicherung im Schulwesen, von der Bildungsexpansion der 1960er/70er Jahre über die Fokussierung auf Schulautonomie bis hin zur datengestützten Outputsteuerung der Gegenwart. Der Abschnitt betont die Bedeutung von Lernerfahrungen und -ergebnissen, sowie den Einfluss von Faktoren wie Lebensraum Schule, Führung, Personalentwicklung und Schulpartnerschaft auf die Unterrichtsqualität. Es werden verschiedene Definitionen von Schul- und Unterrichtsqualität skizziert und der Kontext der Arbeit eingegrenzt.
Nationale Vergleichsstudien: Dieses Kapitel befasst sich mit nationalen Instrumenten der Qualitätssicherung. Es erläutert den Begriff der Kompetenzorientierung und die Rolle der Bildungsstandards als nationale Messlatte für Lernergebnisse. Die Bildungsstandards werden als Orientierungs-, Förderungs- und Evaluationsinstrument beschrieben, deren Implementierung und Anwendung in der Praxis (z.B. Bildungsstandardsüberprüfungen in der 4. und 8. Schulstufe) detailliert dargestellt wird. Der Abschnitt hebt die Bedeutung der Akzeptanz und Beteiligung der Schulen hervor. Weiterhin wird die Informelle Kompetenzmessung (IKM) als freiwilliges Instrument zur Ermittlung des Kompetenzstandes von Schülerinnen und Schülern und zur Unterstützung der Lehrkräfte vorgestellt. Die Durchführung und Auswertung der IKM in der Volksschule und der Sekundarstufe werden beschrieben, wobei die unterschiedlichen Vorgehensweisen und die zur Verfügung stehenden Fächer hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Qualitätssicherung, österreichisches Bildungssystem, nationale Vergleichsstudien, internationale Vergleichsstudien, Bildungsstandards, Kompetenzorientierung, IKM, PISA, TALIS, TIMSS, PIRLS, Schulqualität, Unterrichtsqualität, Lernergebnisse.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Dokument: Analyse nationaler und internationaler Vergleichsstudien im österreichischen Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle nationaler und internationaler Vergleichsstudien bei der Qualitätssicherung des österreichischen Bildungssystems und analysiert deren Beitrag zur Verbesserung der Unterrichts- und Schulqualität.
Welche nationalen Vergleichsstudien werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Kompetenzorientierung und den Bildungsstandards als nationale Messlatte für Lernergebnisse. Im Detail wird die Implementierung und Anwendung der Bildungsstandards (z.B. Überprüfungen in der 4. und 8. Schulstufe) sowie die Informelle Kompetenzmessung (IKM) als freiwilliges Instrument zur Ermittlung des Kompetenzstandes von Schülerinnen und Schülern erläutert.
Welche internationalen Vergleichsstudien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die internationalen Vergleichsstudien PISA, TALIS, TIMSS und PIRLS hinsichtlich ihres Beitrags zur Qualitätssicherung im österreichischen Bildungssystem.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Qualitätssicherung im österreichischen Bildungssystem, nationale und internationale Vergleichsstudien, Kompetenzorientierung und deren Messung, sowie Einflussfaktoren auf die Schul- und Unterrichtsqualität.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu nationalen und internationalen Vergleichsstudien und eine abschließende Diskussion. Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage. Die Kapitel zu den Vergleichsstudien beschreiben die jeweiligen Methoden und Ergebnisse. Die Diskussion fasst die Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Qualitätssicherung, österreichisches Bildungssystem, nationale Vergleichsstudien, internationale Vergleichsstudien, Bildungsstandards, Kompetenzorientierung, IKM, PISA, TALIS, TIMSS, PIRLS, Schulqualität, Unterrichtsqualität, Lernergebnisse.
Welche Kapitelzusammenfassung wird angeboten?
Es werden Zusammenfassungen der Einleitung und des Kapitels zu den nationalen Vergleichsstudien bereitgestellt. Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, die Bedeutung von Lernerfahrungen und -ergebnissen und verschiedene Definitionen von Schul- und Unterrichtsqualität. Das Kapitel zu den nationalen Vergleichsstudien erläutert Kompetenzorientierung, Bildungsstandards und die Informelle Kompetenzmessung (IKM).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Beitrag nationaler und internationaler Vergleichsstudien zur Qualitätssicherung im österreichischen Bildungssystem zu untersuchen und zu analysieren, inwieweit diese Studien zur Verbesserung der Unterrichts- und Schulqualität beitragen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Nationale und internationale Vergleichsstudien als Qualitätssicherung der österreichischen Schulen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/590730