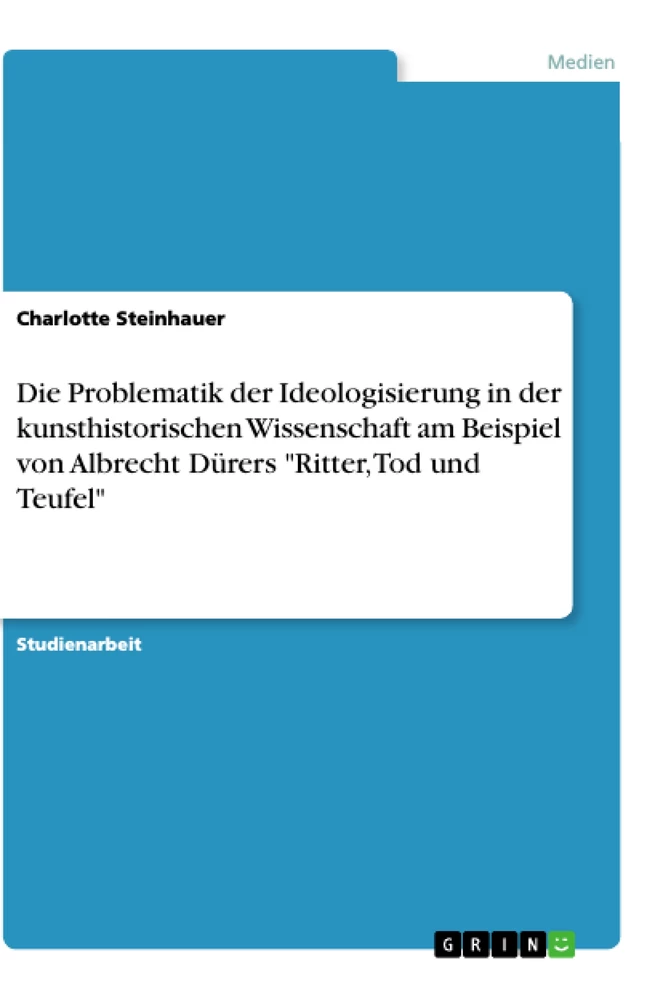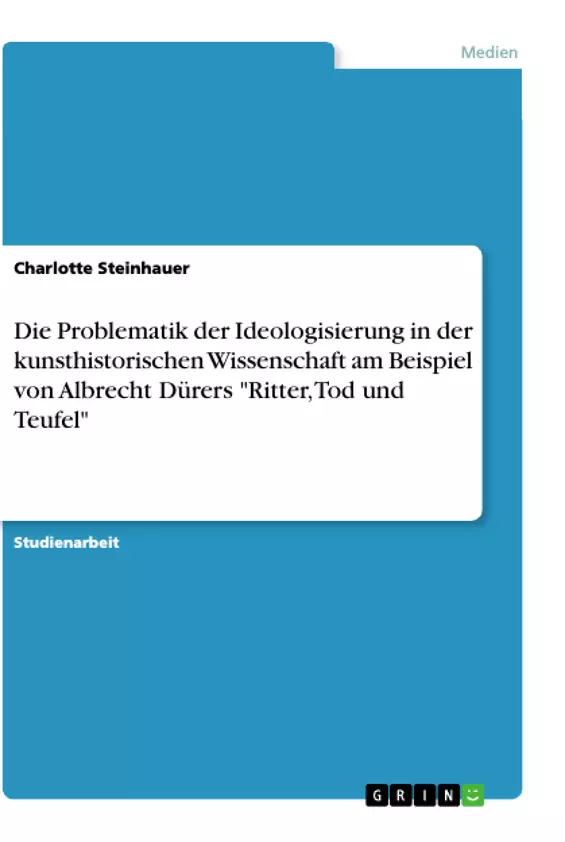Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem der Ideologisierung in der Kunstgeschichte. Kunsthistorische Interpretationen sind nicht frei von Objektivität und können unbewusst vom subjektiven Eindruck des Autors oder bewusst, z.B. als politisches Propagandamittel, beeinflusst sein. Die Arbeit erläutert diese Problematik anhand eines Streits über die Reiterdarstellung auf einem der drei sogenannten Meisterstiche Albrecht Dürers (zumeist unter dem Titel) "Ritter, Tod und Teufel".
Der Kupferstich von Albrecht Dürer aus dem Jahre 1513 kann wohl als eines seiner bekanntesten Werke bezeichnet werden. Das Werk, das zum "Meisterstich" proklamiert wurde, beschäftigte die kunsthistorische Forschung schon früh und in der vielfältigsten Weise. Die Tatsache, dass das Pferd im Stich nach den Regeln der Proportionslehre konstruiert wurde und, dass Leonardos Skizzen von eben dieser Lehre sowie von seinem Sforza-Denkmal als Vorbilder dienten, ebenso wie die italienischen Reiterdenkmäler des 15. Jahrhunderts, war schon den Kunsthistorikern des vorangegangenen Jahrhunderts bekannt.
Die Suche nach dem "wahren Charakter" des Bildes und dem "wahren Wesen" des Künstlers – des "Künstlergenies" – beschäftigte diese jedoch so intensiv, dass der Blick für die Bedeutung dessen, was wirklich über den Kupferstich ausgesagt werden kann, hinter den zahlreichen oft sehr subjektiven Ausdeutungen der einzelnen Symbole und Details zurückblieb. Vor allem die Identität des Reiters stand meistens im Vordergrund und trieb ungeahnte Blüten, was bereits Heinrich Theissing bemerkte.
Der Mann auf dem Pferd wurde zum christlichen Ritter, zum idealisierten Symbol des Rittertums sowie zum genauen Gegenteil stilisiert. Auch ideologisch wurde der Stich vereinnahmt; von nationalsozialistischer Seite ebenso wie in der Nachkriegszeit aus einer marxistisch-sozialistischen Weltsicht heraus motiviert. So, dass Hans Schwerte bemüht war die verschiedenen Deutungen zu dem Stich im Kontexts ihres zeitlichen Ursprungs zu verstehen und die Formulierung von Matthias Mende treffend erscheint: "Jede Zeit macht sich Dürer dienstbar".
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINFÜHRUNG
- 2 RITTER ODER REUTER? EIN REITER
- 2.1 DAS PFERD ALS PROPORTIONSSTUDIE
- 2.2 DER EINFLUSS LEONARDOS UND DIE FRAGE NACH DER BEINSTELLUNG DES PFERDES
- 2.3 DER „ITALIENISCHE CHARAKTER“ DES PFERDES – ANTIKE STATUEN UND ITALIENISCHE REITERDENKMÄLER
- 3 VON VERGLEICHEN UND WETTKÄMPFEN – DER REITER ALS PARAGONE
- 3.1 DER REITER ALS TEIL DES PARAGONE-DISPUTS
- 3.2 ANTIKE VORBILDER
- 3.3 DER WETTSTREIT MIT LEONARDO – EIN WETTSTREIT MIT ITALIEN?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Albrecht Dürers Kupferstich „Ritter, Tod und Teufel“ aus dem Jahre 1513, um dessen Entstehungsprozess und die dahinterliegende künstlerische Konzeption aufzudecken. Dabei soll untersucht werden, inwiefern Dürers Darstellung des Reiters und seines Pferdes auf die Anwendung der Proportionslehre sowie auf Vorbilder wie Leonardos Skizzen zum Sforza-Denkmal und italienische Reiterstandbilder zurückzuführen ist. Darüber hinaus soll der Stich im Kontext des Paragone-Diskurses analysiert werden, der den Vergleich zwischen den verschiedenen Gattungen der Künste, den Medien der bildenden Künste und der Konkurrenz zwischen Künstlern thematisiert.
- Dürers Anwendung der Proportionslehre und die Konstruktion des idealen Pferdes
- Der Einfluss Leonardos und italienischer Reiterstandbilder auf Dürers Werk
- Die Bedeutung des Paragone-Diskurses für die Kunsttheorie der frühen Neuzeit
- Dürers Positionierung als „deutscher Künstler“ im Kontext des italienischen Einflusses
- Der Wettstreit zwischen Dürer und seinen italienischen Vorbildern im Sinne des Paragone
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird eine Einführung in die Thematik des Kupferstichs „Ritter, Tod und Teufel“ gegeben und die Rezeptionsgeschichte des Werks beleuchtet. Das zweite Kapitel befasst sich mit Dürers Darstellung des Pferdes als Proportionsstudie und analysiert den Einfluss Leonardos sowie antiker Statuen und italienischer Reiterdenkmäler auf Dürers Werk. Im dritten Kapitel wird der Reiter im Kontext des Paragone-Diskurses betrachtet und die Bedeutung des Vergleichs zwischen den Gattungen der Künste, den Medien der bildenden Künste und der Konkurrenz zwischen Künstlern für Dürers Werk erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Proportionslehre, Paragone, italienische Reiterdenkmäler, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, „Ritter, Tod und Teufel“, konstruierte Darstellung, antike Vorbilder, nationale Dimension, künstlerischer Wettstreit, Druckgraphik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Problem der Ideologisierung in der Kunstgeschichte?
Kunstinterpretationen sind oft nicht objektiv, sondern werden durch subjektive Eindrücke oder politische Propaganda (z.B. Nationalsozialismus oder Marxismus) beeinflusst.
Welche Rolle spielt die Proportionslehre in Dürers Kupferstich?
Dürer konstruierte das Pferd im Stich „Ritter, Tod und Teufel“ streng nach den Regeln der Proportionslehre, wobei er sich an italienischen Vorbildern orientierte.
Inwiefern beeinflusste Leonardo da Vinci Dürers Werk?
Leonardos Skizzen zum Sforza-Denkmal und italienische Reiterdenkmäler des 15. Jahrhunderts dienten Dürer als direkte Vorbilder für die Darstellung des Reiters.
Was bedeutet der Begriff „Paragone“ in diesem Zusammenhang?
Der Paragone-Diskurs beschreibt den Wettstreit zwischen verschiedenen Kunstgattungen und Künstlern, in dem sich Dürer als „deutscher Künstler“ gegenüber italienischen Einflüssen positionierte.
Wie wurde die Identität des Reiters im Laufe der Zeit gedeutet?
Der Reiter wurde je nach Epoche als christlicher Ritter, idealisiertes Symbol des Rittertums oder sogar als dessen genaues Gegenteil stilisiert.
- Quote paper
- Charlotte Steinhauer (Author), 2017, Die Problematik der Ideologisierung in der kunsthistorischen Wissenschaft am Beispiel von Albrecht Dürers "Ritter, Tod und Teufel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/590989