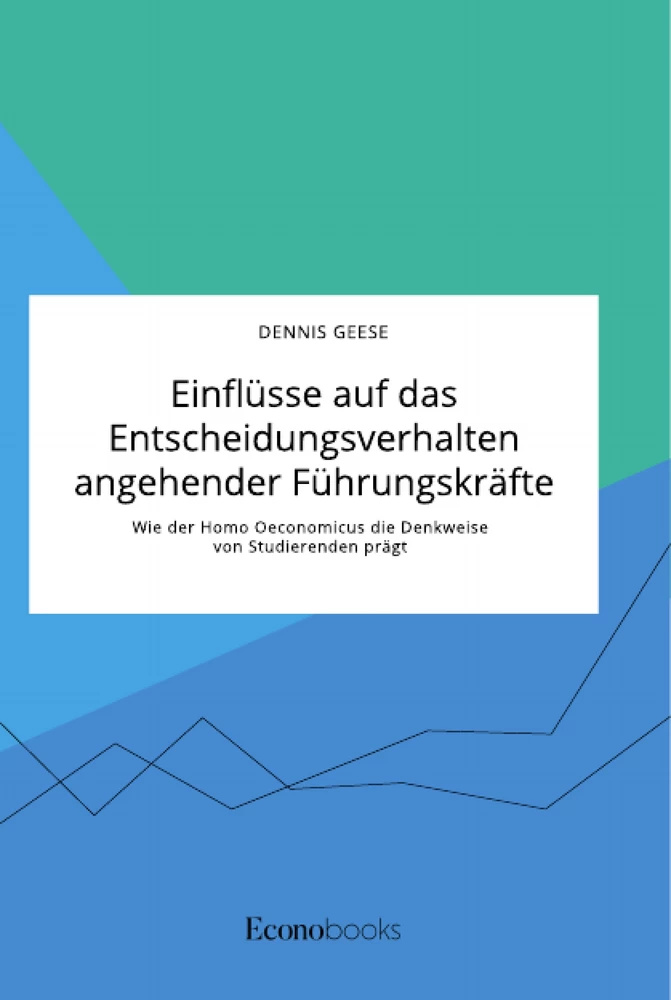Das Modell des Homo Oeconomicus prägt die Denkweise von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften nachhaltig. Viele orientieren sich an diesem rational-ökonomischen Menschenbild, obwohl es seit längerem unter Verdacht steht, Veränderungen und agile Konzepte in Unternehmen zu unterbinden.
Welchen Einfluss hat das Modell Homo Oeconomicus auf Studierende der Wirtschaftswissenschaften? Wie wirkt sich dieses Modell auf deren Entscheidungsverhalten aus? Und können interdisziplinäre Kurse den Einfluss des Homo Oeconomicus reduzieren?
Der Autor Dennis Geese erläutert das Modell des Homo Oeconomicus und legt dar, wie weit diese Denkweise bei Studierenden der Wirtschaftswissenschaften verbreitet ist. Dabei untersucht Geese, wie das rationale und eigennützige Verhalten entsteht und welche Auswirkungen es auf das Entscheidungsverhalten von angehenden Führungskräften hat.
Aus dem Inhalt:
- Unternehmensführung;
- Veränderungsprozess;
- neoklassische Theorie;
- Leadership;
- Organisationsform
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz des Themas
- Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- Struktur der Arbeit
- Theoretischer Hintergrund
- Menschenbilder
- Einfluss von Menschenbildern auf die Unternehmensführung
- Homo Oeconomicus
- Homo Oeconomicus als Menschenbild
- Forschungshypothesen
- Empirische Untersuchung
- Methode
- Ergebnisse
- Deskriptivstatistische Datenauswertung
- Inferenzstatistische Prüfung der Hypothesen
- Explorative Analyse
- Diskussion
- Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- Praktische Implikationen
- Limitationen und zukünftige Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss des Homo Oeconomicus-Modells auf das Entscheidungsverhalten angehender Führungskräfte, insbesondere auf das von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften. Sie zielt darauf ab, herauszufinden, ob und inwiefern das Homo Oeconomicus-Modell das Menschenbild von Studierenden prägt und ob dies zu einem rationaleren und eigennützigerem Entscheidungsverhalten in spieltheoretischen Situationen führt.
- Einfluss des Homo Oeconomicus-Modells auf das Entscheidungsverhalten von Studierenden
- Untersuchung des Verhaltens von Studierenden in spieltheoretischen Situationen
- Analyse, ob und wie interdisziplinäre Kurse den Einfluss des Homo Oeconomicus-Modells reduzieren können
- Bewertung, ob das rationale und eigennützige Verhalten im Verlauf des Studiums entsteht oder von den Studierenden mitgebracht wird
- Bedeutung sozialer Präferenzen in spieltheoretischen Situationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Kapitel erläutert die Relevanz des Themas und die Problemstellung, die der Untersuchung zugrunde liegt. Sie präsentiert die Zielsetzung der Arbeit und die Struktur der kommenden Kapitel.
- Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Menschenbildern im Allgemeinen und insbesondere des Homo Oeconomicus-Modells. Es untersucht den Einfluss des Modells auf die Unternehmensführung und stellt die Forschungshypothesen der Arbeit vor.
- Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung, die in der Arbeit durchgeführt wurde.
- Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, sowohl die deskriptivstatistischen als auch die inferenzstatistischen Auswertungen. Es beinhaltet außerdem eine explorative Analyse der gewonnenen Daten.
- Diskussion: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und interpretiert sie im Hinblick auf die Forschungshypothesen. Es diskutiert die praktischen Implikationen der Ergebnisse und betrachtet Limitationen der Untersuchung sowie Möglichkeiten für zukünftige Forschung.
Schlüsselwörter
Homo Oeconomicus, Entscheidungsverhalten, Spieltheorie, Menschenbild, Studierende, Wirtschaftswissenschaften, Reziprozität, Fairness, interdisziplinäre Kurse, empirische Untersuchung, Verhaltensexperiment.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Modell des Homo Oeconomicus?
Es beschreibt den Menschen als rein rational handelndes Wesen, das stets auf die Maximierung seines eigenen Nutzens bedacht ist.
Wie beeinflusst dieses Modell Studierende der Wirtschaftswissenschaften?
Die Arbeit untersucht, ob das Studium dieses Menschenbildes dazu führt, dass angehende Führungskräfte eigennütziger und weniger sozial orientiert entscheiden.
Können interdisziplinäre Kurse das rationale Denken verändern?
Es wird analysiert, ob Kurse außerhalb der reinen Ökonomie den Einfluss des Homo Oeconomicus reduzieren und soziale Präferenzen wie Fairness stärken können.
Was ist Reziprozität im Entscheidungsverhalten?
Reziprozität bedeutet die Erwiderung von Handlungen (wie du mir, so ich dir) und steht oft im Widerspruch zum rein eigennützigen Homo Oeconomicus.
Welche Auswirkungen hat das Modell auf die Unternehmensführung?
Ein zu starkes Festhalten an diesem rationalen Bild kann agile Konzepte und den Wandel in modernen Organisationen behindern.
- Quote paper
- Dennis Geese (Author), 2020, Einflüsse auf das Entscheidungsverhalten angehender Führungskräfte. Wie der Homo Oeconomicus die Denkweise von Studierenden prägt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/591178