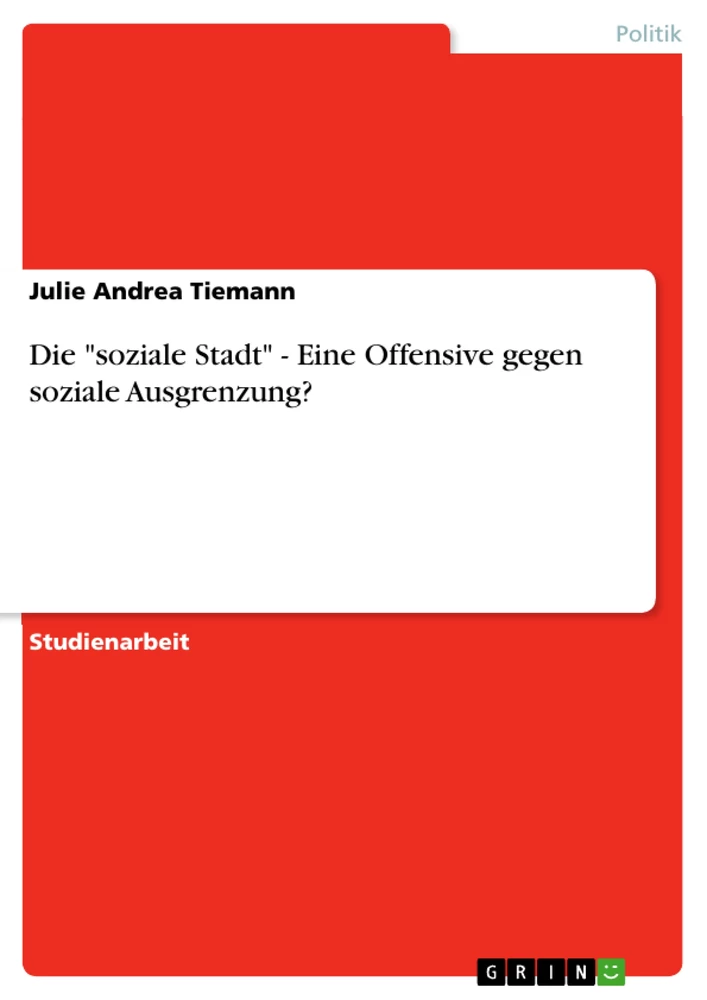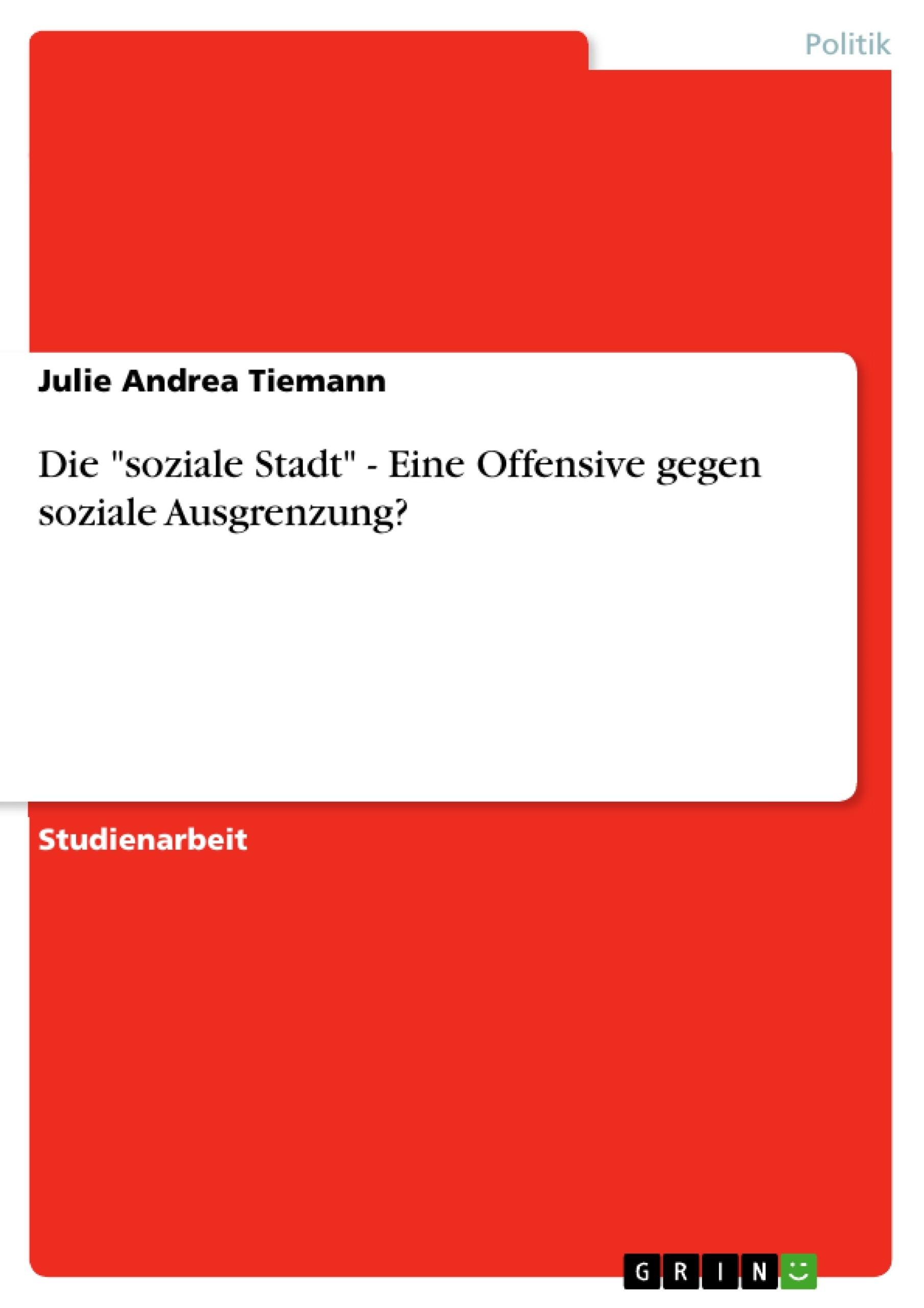In dieser Seminararbeit geht es um die kommunale Sozialpolitik in deutschen Großstädten. Im Mittelpunkt stehen das Problem der sozialen Ausgrenzung und das Gemeinschaftsprogramm die „soziale Stadt“ als Versuch einer Lösung. Die Probleme soziale Ausgrenzung, Polarisierung und Segregation in der Stadt haben in den letzten Jahre in der Forschung stark an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Autoren Alisch, Häußermann, Becker und Löhr haben sich intensiv mit den Problemen auseinandergesetzt. Auch das Programm die „soziale Stadt“ ist in der Forschung auf große Resonanz gestoßen. Aus diesem Grund ist es lohnenswert, das Thema in Form einer Seminararbeit zu behandeln. „Nach dem Sozialstaatspostulat im Grundgesetz und der Gemeindeverfassung ist es Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, in den Kommunen für gleichwertige und einheitliche Lebensverhältnisse und damit für sozialen Ausgleich zu sorgen.“ Dies bedeutet, daß die Kommunen jegliche Form sozialer Ausgrenzung verhindern sollen. Aufgrund des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandels in Deutschland stehen nicht mehr nur behinderte, chronisch kranke und alte Menschen im Blickfeld sozialer Ausgrenzung, sondern, ganz allgemein gesprochen, alle diejenigen, die mit dem Modernisierungsprozeß nicht mithalten konnten. Darüber hinaus spielt die Armut ebenfalls eine bedeutende Rolle im Prozeß der sozialen Ausgrenzung. Von nicht minderer Relevanz ist auch die sozialpolitische Aufgabe der Integration von Ausländern in den Kommunen. Kommunale Sozialpolitik beschäftigt sich also mit verschiedensten Formen sozialer Integration. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Bundesrepublik und der damit ver-bundenen Mittelknappheit der Kommunen, stehen besonders die großen Städte vor immensen Integrationsproblemen. Vielerorts kommt es zu einer Polarisierung einzelner Bevölkerungsgruppen in bestimmten Stadtteilen und nicht selten entstehen daraus „soziale Brennpunkte“, die eine Segregation des Stadtteils nach sich ziehen können. Um eine solche Entwicklung und die damit verbundene Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen zu verhindern und bereits abgerutschte Stadtteile wieder zu integrieren, wurde 1996 von der Ministerkonferenz der ARGEBAU die Bund-Länder Gemeinschaftsinitiative die „soziale Stadt“ beschlossen. Dieses Förderprogramm richtet sich an bestimmte „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“ und läuft seit 1999 in allen Bundesländern. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die „soziale Stadt“
- 1.1 „Stadt- und Ortsteile mit Entwicklungspriorität“
- 1.2 Ziele und Maßnahmen
- 2. Probleme in der Großstadt
- 2.1 Arbeitslosigkeit
- 2.2 Armut
- 2.3 Integration von Ausländern
- 2.4 Zwischenbilanz
- 3. Entstehung „sozialer Brennpunkte“
- 3.1 Polarisierung von Bevölkerungsgruppen
- 3.2 Segregation von Stadtteilen und Bevölkerungsgruppen
- 4. Re-Integration benachteiligter Stadtteile am Beispiel Galgenhof-Steinbühl in Nürnberg
- 4.1 Projekte in Galgenhof-Steinbühl
- 4.2 Fazit
- 5. Die „soziale Stadt“ – eine Zwischenbilanz
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der kommunalen Sozialpolitik in deutschen Großstädten, insbesondere mit dem Problem der sozialen Ausgrenzung und dem Gemeinschaftsprogramm „soziale Stadt“ als Lösungsansatz. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Auswirkungen sozialer Ausgrenzung, Polarisierung und Segregation in Städten und analysiert die Effektivität des Programms „soziale Stadt“ in der Re-Integration benachteiligter Stadtteile.
- Soziale Ausgrenzung und Segregation in deutschen Großstädten
- Das Gemeinschaftsprogramm „soziale Stadt“ als Versuch einer Lösung
- Die Herausforderungen der sozialen Integration in Großstädten
- Analyse der Effektivität des Programms „soziale Stadt“ am Beispiel eines Nürnberger Stadtteils
- Die Bedeutung der kommunalen Sozialpolitik für den sozialen Ausgleich
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Problem der sozialen Ausgrenzung in deutschen Großstädten dar und erläutert den Fokus auf das Programm „soziale Stadt“ als Lösungsansatz. Die Bedeutung des Themas in der Forschung wird hervorgehoben.
- 1. Die „soziale Stadt“: Dieses Kapitel beschreibt das Gemeinschaftsprogramm „soziale Stadt“, seine Ziele, Maßnahmen und Finanzierungsquellen. Es werden die verschiedenen Typen von betroffenen Stadtteilen vorgestellt und die Hintergründe für die Entstehung des Programms beleuchtet.
- 2. Probleme in der Großstadt: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Facetten der sozialen Ausgrenzung in Großstädten, wie Arbeitslosigkeit, Armut und Integration von Ausländern. Die Situation in Großstädten aufgrund des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels wird dargestellt.
- 3. Entstehung „sozialer Brennpunkte“: Dieses Kapitel geht auf die Entstehung und Auswirkungen von „sozialen Brennpunkten“ ein, die durch die Polarisierung von Bevölkerungsgruppen und die Segregation von Stadtteilen entstehen können.
- 4. Re-Integration benachteiligter Stadtteile am Beispiel Galgenhof-Steinbühl in Nürnberg: Dieses Kapitel analysiert die Effektivität des Programms „soziale Stadt“ in der Praxis anhand des Beispiels von Galgenhof-Steinbühl in Nürnberg. Es werden Projekte und Maßnahmen vorgestellt und die erzielten Ergebnisse bewertet.
- 5. Die „soziale Stadt“ – eine Zwischenbilanz: Dieses Kapitel fasst die Entwicklung des Programms „soziale Stadt“ und die bisher erzielten Ergebnisse zusammen. Es werden Chancen und Herausforderungen für die Zukunft des Programms beleuchtet.
Schlüsselwörter
Soziale Ausgrenzung, soziale Stadt, Segregation, Stadtentwicklung, kommunale Sozialpolitik, Integration, Großstadt, soziale Brennpunkte, Galgenhof-Steinbühl, Nürnberg, Arbeitslosigkeit, Armut, Ausländerintegration, Polarisierung, Zwischenbilanz, Re-Integration, nachhaltige Entwicklung, Gemeinschaftsprogramm, Bund-Länder-Initiative, ARGEBAU.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Programm "Soziale Stadt"?
Es ist eine 1996 beschlossene Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative, die Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf fördert, um soziale Ausgrenzung und Segregation zu bekämpfen.
Was sind die Hauptursachen für soziale Ausgrenzung in Großstädten?
Wesentliche Faktoren sind Arbeitslosigkeit, Armut, mangelnde Integration von Zuwanderern sowie der allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturwandel.
Was bedeutet "Segregation" im städtischen Kontext?
Segregation beschreibt die räumliche Trennung und Polarisierung verschiedener Bevölkerungsgruppen, was oft zur Entstehung von "sozialen Brennpunkten" führt.
Welches Praxisbeispiel wird in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert die Re-Integration benachteiligter Stadtteile am konkreten Beispiel von Galgenhof-Steinbühl in Nürnberg.
Welche Ziele verfolgt die kommunale Sozialpolitik?
Gemäß dem Grundgesetz sollen Kommunen für gleichwertige Lebensverhältnisse und sozialen Ausgleich sorgen, um die Ausgrenzung von Modernisierungsverlierern zu verhindern.
- Citar trabajo
- Julie Andrea Tiemann (Autor), 2003, Die "soziale Stadt" - Eine Offensive gegen soziale Ausgrenzung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59135