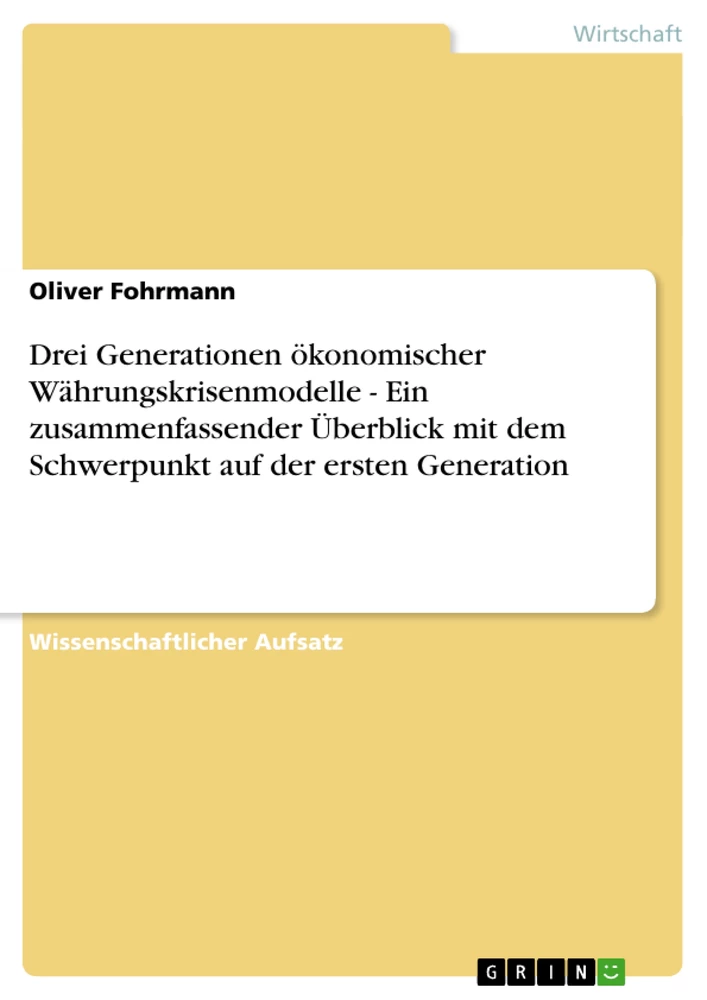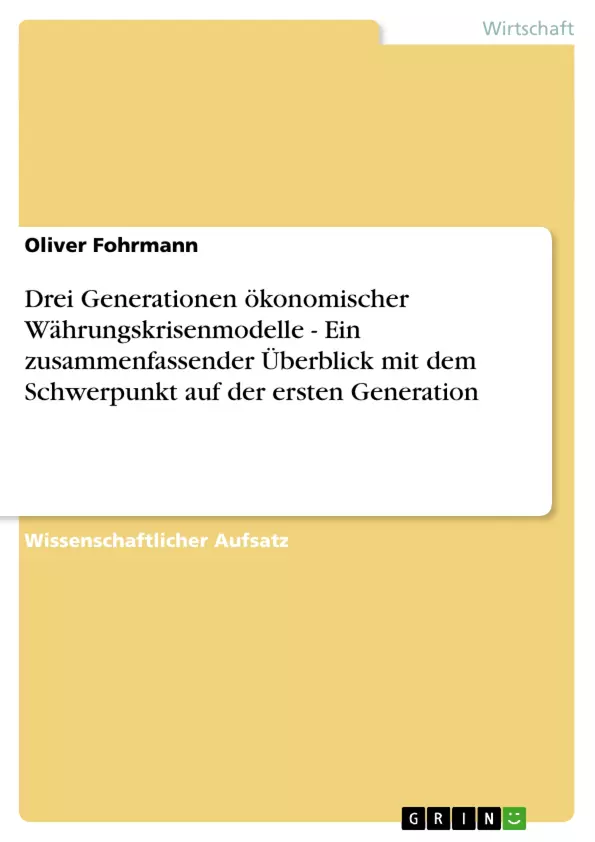Der Text gibt einen Überblick über die drei Generationen, in die Ökonomen gemeinhin Modelle von Währungskrisen einteilen. Modelle erster Generation beschreiben insbesondere die frühen Währungskrisen der Siebziger und Achtziger Jahre gut. Sie gehen von Fehlern und widersprüchlichem Handeln der wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger aus. Wenn eine Regierung beispielsweise ein Regime fester Wechselkurse aufrechterhalten will, aber auf expansive Geldpolitk nicht verzichtet, führt dies auf eine Art und Weise zu einer Währungskrise, die man mit Modellen erster Generation gut beschreiben kann. Modelle zweiter Generation beschreiben Währungskrisen, die von Regierungen bewusst als kleineres von mehreren Übeln herbeigeführt werden. Modelle dritter Generation wurden für die neueren Finanzkrisen der Neunziger Jahre (z.B. Asienkrise) entwickelt und betonen die Verflechtungen von Währungs-, Banken- und Aktienmarktkrisen. Für die erste und zweite Generation werden exemplarisch Modelle wiedergegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Währungskrisenmodelle erster Generation
- Das Währungskrisenmodell von KRUGMAN
- Das Währungskrisenmodell von FLOOD und GARBER
- Erweiterungen der klassischen Währungsattackenmodelle
- Modelle erster und zweiter Generation im Vergleich
- Währungskrisenmodelle zweiter Generation
- Währungskrisenmodelle dritter Generation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz bietet einen umfassenden Überblick über drei Generationen ökonomischer Währungskrisenmodelle, wobei der Schwerpunkt auf der ersten Generation liegt. Er untersucht die Entstehung und Entwicklung dieser Modelle im Kontext der schweren Währungskrisen der 1970er Jahre. Der Fokus liegt auf den Modellen von Krugman (1979) und Flood und Garber (1984), die als grundlegende Modelle der ersten Generation gelten.
- Spekulative Attacken auf Devisenreserven
- Festlegung und Stabilisierung von Wechselkursen
- Expansive Geldpolitik und Budgetdefizite
- Die Rolle von Deviseninterventionen durch Zentralbanken
- Das Zusammenspiel von Geldpolitik, Wechselkursen und Vermögensbeständen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Währungskrisenmodelle erster Generation
Das Kapitel 1 beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der ersten Generation von Währungskrisenmodellen. Es analysiert insbesondere die Modelle von Krugman (1979) und Flood und Garber (1984), die als Grundmodelle der ersten Generation gelten. Diese Modelle erklären Währungskrisen durch spekulativen Attacken auf Devisenreserven, die durch eine expansive Geldpolitik und ein festes Wechselkursregime begünstigt werden.
2 Währungskrisenmodelle zweiter Generation
Kapitel 2 befasst sich mit den Modellen der zweiten Generation, die auf den Erkenntnissen der ersten Generation aufbauen und zusätzliche Faktoren wie asymmetrische Informationen, Kapitalmobilität und Kreditmärkte berücksichtigen. Diese Modelle bieten eine komplexere Analyse von Währungskrisen, die die Interaktion verschiedener ökonomischer Kräfte einbeziehen.
3 Währungskrisenmodelle dritter Generation
Kapitel 3 gibt einen Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Modellierung von Währungskrisen, die unter dem Begriff „dritte Generation“ zusammengefasst werden. Diese Modelle befassen sich mit globalen Zusammenhängen, Finanzmärkten und der Rolle von Institutionen in der Entstehung von Währungskrisen.
Schlüsselwörter
Währungskrisen, Währungsattacken, Devisenreserven, feste Wechselkurse, expansive Geldpolitik, Budgetdefizit, Zentralbankinterventionen, spekulatives Verhalten, Krugman-Modell, Flood-Garber-Modell, erste Generation, zweite Generation, dritte Generation, ökonomische Modellierung.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet Währungskrisenmodelle der ersten Generation?
Diese Modelle (z.B. von Krugman) erklären Krisen durch widersprüchliche Politik, etwa wenn ein Staat feste Wechselkurse halten will, aber gleichzeitig eine expansive Geldpolitik zur Defizitfinanzierung betreibt.
Wie unterscheiden sich Modelle der zweiten von der ersten Generation?
Während die erste Generation auf politisches Fehlhandeln fokussiert, betont die zweite Generation, dass Regierungen bewusst abwägen und eine Krise herbeiführen können, wenn die Kosten der Kurshaltung zu hoch werden (z.B. durch hohe Arbeitslosigkeit).
Was sind Modelle der dritten Generation?
Diese Modelle entstanden nach der Asienkrise und untersuchen die engen Verflechtungen zwischen Währungs-, Banken- und Finanzmarktkrisen sowie die Rolle von Institutionen.
Welche Rolle spielen spekulative Attacken in diesen Modellen?
Spekulative Attacken treten auf, wenn Marktteilnehmer vorhersehen, dass die Devisenreserven einer Zentralbank zur Neige gehen. Sie beschleunigen den Zusammenbruch eines festen Wechselkurssystems.
Was ist das Kernargument des Krugman-Modells?
Das Krugman-Modell zeigt, dass eine Krise nicht zufällig geschieht, sondern die logische Folge einer unvereinbaren Kombination aus Budgetdefiziten und festen Wechselkursen ist.
- Citation du texte
- Dr. Oliver Fohrmann (Auteur), 2006, Drei Generationen ökonomischer Währungskrisenmodelle - Ein zusammenfassender Überblick mit dem Schwerpunkt auf der ersten Generation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59142