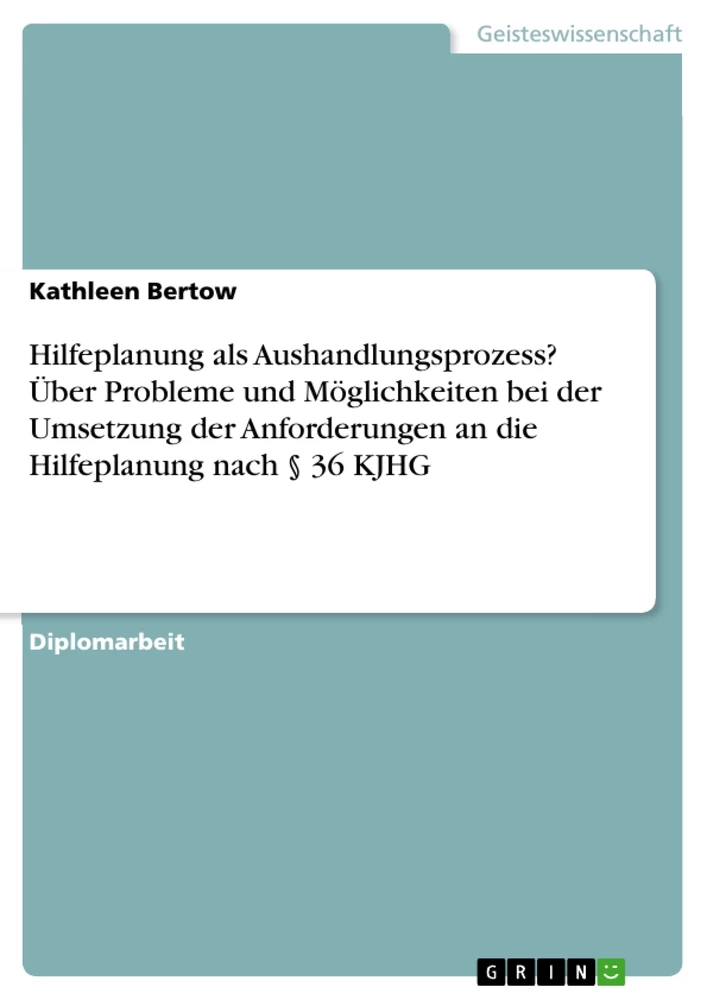1 Einleitung
Im Januar 1991 kam es zur Einführung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), welches einiges an Veränderungen für die Erziehungshilfe mit sich brachte. Im Vordergrund steht nun nicht mehr primär der Eingriff und die Kontrolle, sondern der Dienstleistungscharakter der Jugendhilfe. Dem Hilfeplan und seinem Verfahren kommt dabei besondere Bedeutung zu, denn es geht darum, gemeinsam mit den Kindern, den Jugendlichen und deren Eltern zusammenzuarbeiten, um einen von allen Seiten befürworteten Hilfeplan zu erstellen. Die Mitwirkung der Leistungsempfänger ist zugleich Voraussetzung und pädagogische Aufgabe für den erfolgreichen Verlauf einer Hilfe. In einem gemeinsam gestalteten Aushandlungsprozess sollen sich Fachkräfte und Klienten auf eine geeignete Hilfeform einigen.
Dies hört sich vielversprechend und überzeugend an. Wie jedoch gestaltet sich die Umsetzung in der Praxis? Aus eigener Erfahrung der Arbeit in einem Jugendamt sieht man sich häufig der Frage gegenüber: Welche Hilfe ist die Richtige? und Wie muss diese gestaltet sein, damit sie einerseits akzeptiert wird und andererseits möglichst erfolgversprechend verläuft? Oft steht man vor mehreren Wegen und muss umgehend entscheiden, welcher der richtige ist oder zu sein scheint. Ob diese Entscheidung richtig war, ergibt sich meist erst im Nachhinein. Vielleicht allerdings können bestimmte Hinweise auf dem Weg zur Entscheidung helfen. Diesbezüglich war die Beschäftigung mit der Frage nach einer „richtigen“ und „gelungenen“ Hilfeplanung und deren Bedingungen der Grund, sich intensiver damit auseinander zu setzen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gesetzliche Grundlagen
- 2.1 Perspektivenwechsel von der Eingriffsverwaltung zur Dienstleistungsverwaltung
- 2.2 § 27 KJHG als Voraussetzung für Hilfen zur Erziehung
- 2.3 Wesentliche Anforderungen des KJHG an das Verfahren der Hilfeplanung nach § 36
- 2.3.1 Beratungspflicht des Jugendamtes
- 2.3.2 Mitwirkung
- 2.3.3 Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte
- 2.3.4 Hilfeplanerstellung
- 2.3.5 Datenschutz
- 3 Charakter der Hilfeplanung: Diagnose oder Aushandlung?
- 3.1 Hilfeplanung als Aushandlungsgeschehen
- 3.2 Psychosoziale Diagnostik in den einzelnen Phasen des Hilfeprozesses
- 3.2.1 Phase 1: Problemsichtung und Beratung
- 3.2.2 Phase 2: Klärung der individuellen Situation und Entscheidung über die Hilfe
- 3.2.3 Phase 3: Erbringung der Hilfe und Rückmeldung über den Hilfeverlauf
- 3.3 Warum Diagnosen in der Jugendhilfe?
- 3.3.1 Sozialpädagogische Diagnose
- 3.3.2 Sozialpädagogisch-hermeneutische Diagnose
- 3.4 Vorwürfe und Entgegnungen zur Diskussion
- 4 Probleme und Möglichkeiten bei der Umsetzung der Anforderungen an den Hilfeplanungsprozess
- 4.1 Partizipation als gesetzlicher Auftrag
- 4.2 Fachliche und strukturelle Probleme der Partizipation im Hilfeplanverfahren
- 4.2.1 Methodische Probleme
- 4.2.2 Strukturelle Probleme
- 4.2.3 Methodische Hinweise zur Vorbereitung und Gestaltung von Hilfeplangesprächen
- 4.3 Probleme der kollegialen Beratung in Fachteams
- 4.4 Probleme bei der Herstellung organisatorischer Rahmenbedingungen
- 4.5 Infrastrukturplanung als Voraussetzung für flexible und individuelle Hilfeplanung
- 5 Hilfeplanung aus Sicht Betroffener
- 5.1 Erfahrungen betroffener Eltern, Kinder und Jugendlicher
- 5.2 Wünsche und Forderungen für eine verbesserte Hilfeplanung
- 5.3 Möglichkeiten für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- 6 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Umsetzung der Anforderungen an die Hilfeplanung nach § 36 KJHG in der Praxis. Ziel ist es, Probleme und Möglichkeiten bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zu identifizieren und Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet den Charakter der Hilfeplanung als Aushandlungsprozess im Gegensatz zur Diagnose, analysiert die Bedeutung der Partizipation und untersucht die Herausforderungen der Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte.
- Umsetzung des § 36 KJHG in der Praxis
- Hilfeplanung als Aushandlungsprozess vs. Diagnose
- Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Eltern
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Hilfeplanung
- Organisatorische Rahmenbedingungen und Infrastruktur
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hilfeplanung nach dem KJHG ein und benennt die zentrale Forschungsfrage nach den Problemen und Möglichkeiten der Umsetzung des Gesetzes in der Praxis. Sie hebt den Wandel von der Eingriffsverwaltung zur Dienstleistungsverwaltung hervor und stellt die Bedeutung der gemeinsamen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Eltern heraus. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage nach dem richtigen Verfahren und den Herausforderungen bei der Entscheidung für die geeignete Hilfe.
2 Gesetzliche Grundlagen: Dieses Kapitel beschreibt die gesetzlichen Grundlagen der Hilfeplanung gemäß § 36 KJHG. Es erläutert den Perspektivenwechsel von der Eingriffs- zur Dienstleistungsverwaltung und detailliert die gesetzlichen Anforderungen, darunter die Beratungspflicht des Jugendamtes, die Mitwirkung der Klienten, die Zusammenarbeit mehrerer Fachkräfte und die Erstellung des Hilfeplans. Der Datenschutz wird ebenfalls als wichtiger Aspekt angesprochen. Das Kapitel legt die rechtlichen Rahmenbedingungen für die nachfolgende Analyse der praktischen Umsetzung dar.
3 Charakter der Hilfeplanung: Diagnose oder Aushandlung?: Dieses Kapitel diskutiert die grundlegende Frage, ob Hilfeplanung eher als Aushandlungsprozess oder als diagnostischer Akt zu verstehen ist. Es werden die jeweiligen Perspektiven und Ansätze gegenübergestellt, wobei der Aushandlungsprozess die gemeinsame Erarbeitung einer Lösung im Vordergrund stellt, während die Diagnostik eine expertengeleitete Analyse und Entscheidung betont. Das Kapitel untersucht verschiedene diagnostische Ansätze in der Sozialpädagogik und bewertet die Vor- und Nachteile beider Sichtweisen im Kontext der Jugendhilfe.
4 Probleme und Möglichkeiten bei der Umsetzung der Anforderungen an den Hilfeplanungsprozess: Dieses Kapitel befasst sich mit den praktischen Problemen bei der Umsetzung der Hilfeplanung. Es analysiert die Herausforderungen der Partizipation, sowohl auf methodischer als auch auf struktureller Ebene. Die Schwierigkeiten der kollegialen Beratung in Fachteams werden ebenso thematisiert wie die Bedeutung geeigneter organisatorischer Rahmenbedingungen und einer funktionierenden Infrastruktur für eine flexible und individuelle Hilfeplanung. Das Kapitel bietet methodische Hinweise zur Gestaltung von Hilfeplangesprächen und beleuchtet die Notwendigkeit einer Verknüpfung von individueller und regionaler Jugendhilfeplanung.
5 Hilfeplanung aus Sicht Betroffener: Kapitel 5 präsentiert Ergebnisse von Untersuchungen zu den Erfahrungen von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit dem Hilfeplanungsverfahren. Es werden deren Wünsche und Forderungen für eine verbesserte Hilfeplanung sowie Möglichkeiten für eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen dargestellt. Die Perspektive der Betroffenen liefert wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung des Hilfeplanungsprozesses.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hilfeplanung nach § 36 KJHG
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die praktische Umsetzung der Anforderungen an die Hilfeplanung nach § 36 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Im Fokus stehen Probleme und Möglichkeiten der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, der Charakter der Hilfeplanung als Aushandlungsprozess im Gegensatz zur Diagnose, die Bedeutung der Partizipation aller Beteiligten und die Herausforderungen der Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden behandelt?
Das Kapitel "Gesetzliche Grundlagen" beleuchtet § 27 und § 36 KJHG. Es beschreibt den Perspektivenwechsel von der Eingriffs- zur Dienstleistungsverwaltung und detailliert die gesetzlichen Anforderungen, wie die Beratungspflicht des Jugendamtes, die Mitwirkung der Klienten, die Zusammenarbeit mehrerer Fachkräfte und die Erstellung des Hilfeplans. Der Datenschutz wird ebenfalls als wichtiger Aspekt behandelt.
Ist Hilfeplanung Diagnose oder Aushandlung?
Die Arbeit diskutiert die zentrale Frage, ob Hilfeplanung eher als Aushandlungsprozess oder als diagnostischer Akt zu verstehen ist. Sie vergleicht verschiedene Perspektiven und Ansätze, darunter die sozialpädagogische und sozialpädagogisch-hermeneutische Diagnose. Die Vor- und Nachteile beider Sichtweisen im Kontext der Jugendhilfe werden bewertet.
Welche Probleme bei der Umsetzung der Hilfeplanung werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert praktische Herausforderungen bei der Umsetzung der Hilfeplanung. Dies beinhaltet Probleme der Partizipation (methodisch und strukturell), Schwierigkeiten der kollegialen Beratung in Fachteams, die Bedeutung geeigneter organisatorischer Rahmenbedingungen und einer funktionierenden Infrastruktur für eine flexible und individuelle Hilfeplanung. Methodische Hinweise zur Gestaltung von Hilfeplangesprächen werden ebenfalls gegeben.
Welche Rolle spielen die Betroffenen in der Hilfeplanung?
Das Kapitel "Hilfeplanung aus Sicht Betroffener" präsentiert die Erfahrungen von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit dem Hilfeplanungsverfahren. Es werden deren Wünsche und Forderungen für eine Verbesserung des Prozesses sowie Möglichkeiten für eine stärkere Beteiligung der Betroffenen dargestellt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Probleme und Möglichkeiten bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags der Hilfeplanung nach § 36 KJHG zu identifizieren und Lösungsansätze aufzuzeigen. Sie untersucht den Charakter der Hilfeplanung als Aushandlungsprozess, analysiert die Bedeutung der Partizipation und beleuchtet die Herausforderungen der Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Umsetzung des § 36 KJHG in der Praxis, Hilfeplanung als Aushandlungsprozess vs. Diagnose, Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Eltern, interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Hilfeplanung, organisatorische Rahmenbedingungen und Infrastruktur.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit bietet eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung und endend mit den Schlussfolgerungen. Die Zusammenfassungen geben einen Überblick über die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels.
- Quote paper
- Kathleen Bertow (Author), 2002, Hilfeplanung als Aushandlungsprozess? Über Probleme und Möglichkeiten bei der Umsetzung der Anforderungen an die Hilfeplanung nach § 36 KJHG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59198