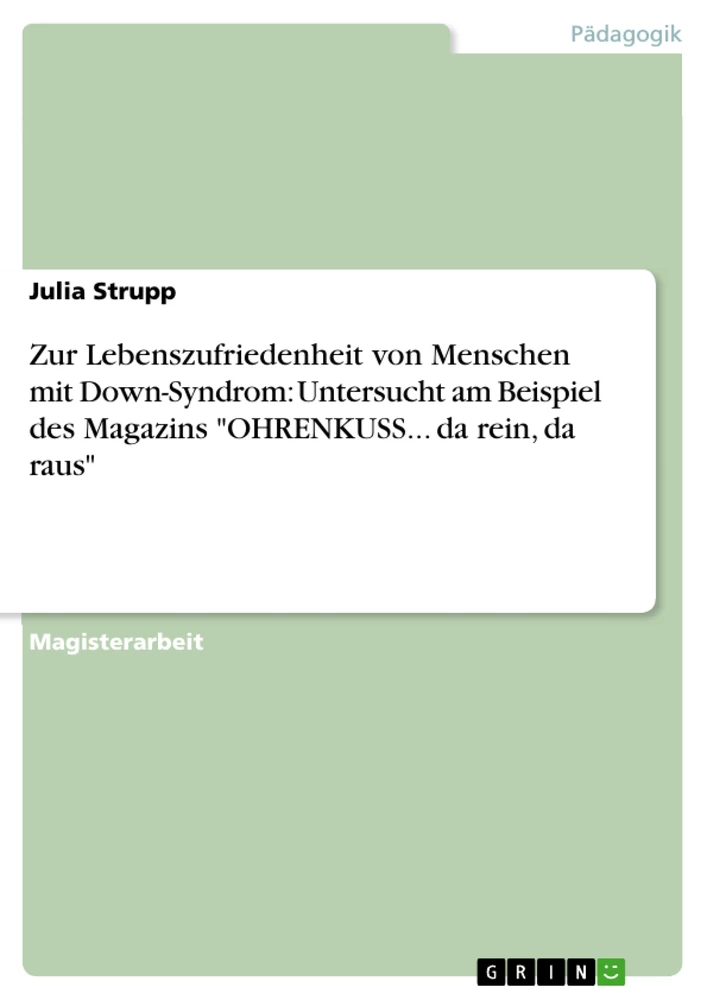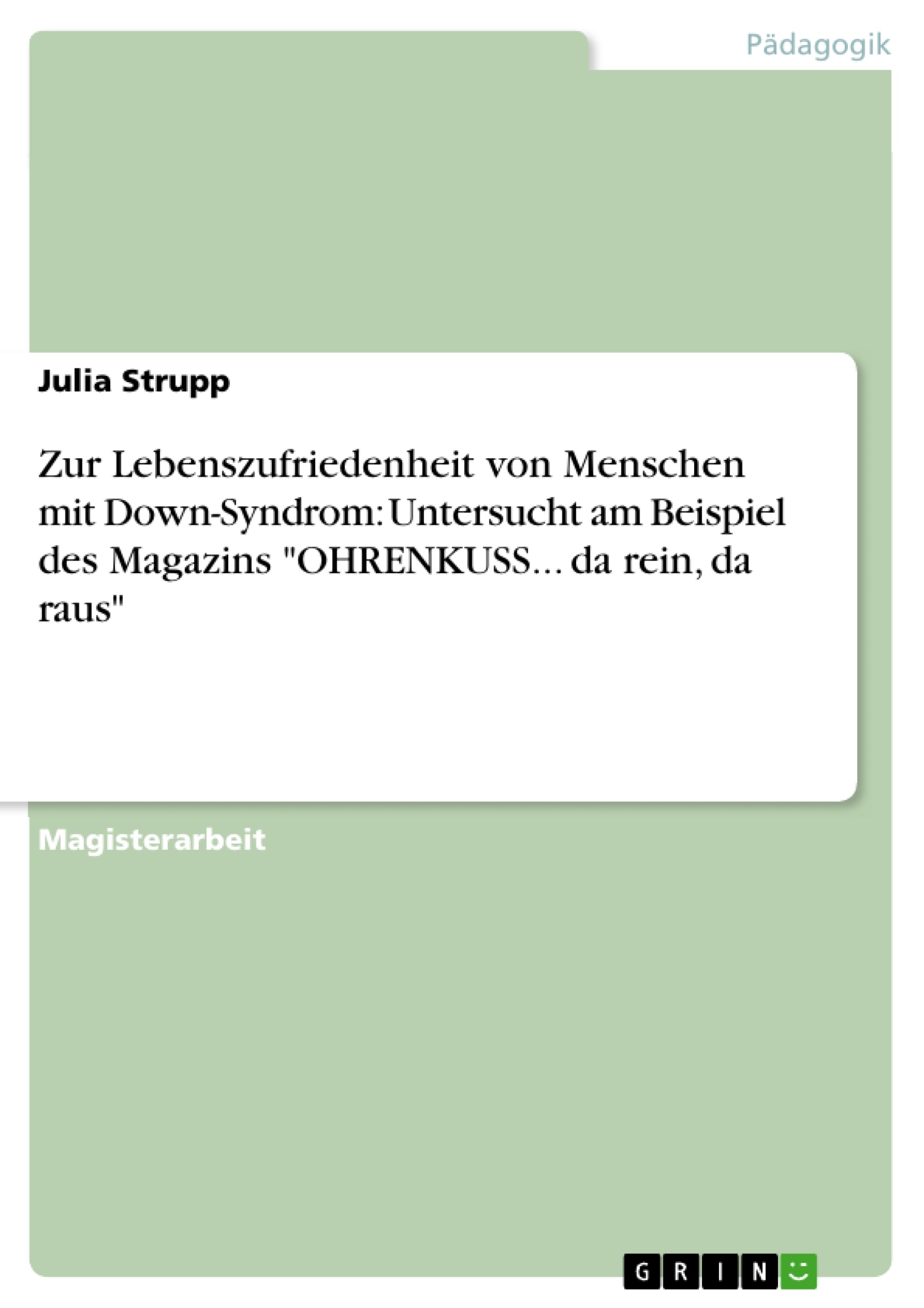Die vorliegende Magisterarbeit beabsichtigt, einen Beitrag zum Verständnis über die Lebenszufriedenheit von Menschen mit Down-Syndrom zu leisten. Dabei wird das Magazin „OHRENKUSS... da rein, da raus“ als Beispiel hervorgehoben. Fast alle Texte in diesem Magazin sind von Menschen mit Down-Syndrom erstellt, selbst geschrieben, getippt oder auch diktiert und danach eventuell selbst abgeschrieben. Es wird versucht, anhand einzelner Interviews mit den Redakteuren dieser Zeitschrift aufzuzeigen, wie durch die Möglichkeit des Schreibens und Mitteilens ein neues Bewusstsein der eigenen Individualität entstehen und zu einem steigenden Selbstwertgefühl führen kann. Die Autoren des OHRENKUSS haben durch dieses Medium die Möglichkeit, sich in eigenen Worten und Formaten mitzuteilen: Ihr ungebrochenes Interesse an der Welt, ihren Sinn für Humor und ihre Begabung, sich an schönen Dingen zu erfreuen, aber auch ihre Schwierigkeiten im Alltag, fehlende Arbeitsmöglichkeiten und Diskriminierung können thematisiert werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 „OHRENKUSS...da rein, da raus“
- 2.1 Projektbeschreibung
- 2.2 Projektentstehung und Zielsetzung
- 2.3 Aufbau der OHRENKUSS-Redaktion und ihre Arbeitsprinzipien
- 2.4 Redaktionssitzungen
- 3 Menschen mit Down-Syndrom - Begriffsklärungen
- 3.1 Geistige Behinderung
- 3.2 Down-Syndrom
- 3.3 Erwachsenenalter
- 3.4 Bedeutung des Lesens und Schreibens für Menschen mit Down-Syndrom
- 3.5 Menschen mit Down-Syndrom in der Gesellschaft und in den Medien
- 4 Empowerment-Konzept
- 4.1 Begriffsklärung
- 4.2 Menschenbild
- 4.3 Leitprinzipien
- 4.4 Methoden des Empowerment
- 4.5 Kritische Betrachtung des Empowerment
- 4.6 Empowerment und OHRENKUSS
- 5 Lebenszufriedenheit
- 5.1 Lebensqualität
- 5.2 Normalisierung
- 5.3 Lebenszufriedenheit - Versuch einer Definition
- 5.4 Zur Erforschung von Lebenszufriedenheit
- 6 Schlussfolgerungen und Fragestellungen
- 7 Methodik
- 7.1 Untersuchungsverfahren
- 7.1.1 Qualitative Interviews
- 7.1.2 Elternfragebogen
- 7.2 Stichprobenbeschreibung
- 7.3 Art und Ablauf der Untersuchung
- 7.4 Auswertung
- 8 Ergebnisse
- 9 Diskussion
- 10 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Lebenszufriedenheit von Menschen mit Down-Syndrom am Beispiel des Magazins „OHRENKUSS... da rein, da raus“. Ziel ist es, den Beitrag des Schreibens und Mitteilens im Magazin zum Selbstwertgefühl und zur individuellen Wahrnehmung der Redakteure zu beleuchten. Die Arbeit verknüpft empirische Ergebnisse mit theoretischen Konzepten wie Empowerment und Normalisierung.
- Lebenszufriedenheit von Menschen mit Down-Syndrom
- Der Einfluss des Schreibens und der Selbstverwirklichung auf die Lebenszufriedenheit
- Das Empowerment-Konzept und seine Anwendung im Kontext von „OHRENKUSS“
- Qualitative Forschungsmethoden und deren Anwendung in der Untersuchung
- Der Beitrag von „OHRENKUSS“ zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Down-Syndrom
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Lebenszufriedenheit von Menschen mit Down-Syndrom ein und benennt das Magazin „OHRENKUSS“ als Untersuchungsgegenstand. Es wird die Forschungsfrage nach dem Beitrag von „OHRENKUSS“ und Empowerment zur Lebenszufriedenheit formuliert und die Struktur der Arbeit skizziert. Die Arbeit betont die Bedeutung der Möglichkeit zum Schreiben und Mitteilen für die Selbstfindung und das Selbstwertgefühl der Redakteure. Die Autorin kündigt an, die gewonnenen Ergebnisse mit theoretischen Konzepten zu verknüpfen.
2 „OHRENKUSS...da rein, da raus“: Dieses Kapitel beschreibt das Projekt „OHRENKUSS“, seine Entstehung, Zielsetzung und den Aufbau der Redaktion. Es beleuchtet die Arbeitsprinzipien des Magazins und die Bedeutung der selbstbestimmten Mitwirkung der Redakteure. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Entstehungsgeschichte des Magazins, der Motivation der Beteiligten und dem didaktischen Konzept hinter der Zeitschrift. Die Entstehung und Entwicklung des Projektes wird detailliert nachgezeichnet, einschließlich der Namensfindung und der ersten Veröffentlichung.
3 Menschen mit Down-Syndrom - Begriffsklärungen: Dieses Kapitel klärt den Begriff der geistigen Behinderung und beschreibt das Down-Syndrom, seine Ursachen, körperlichen Merkmale und den Aspekt des Erwachsenwerdens. Es beleuchtet die gesellschaftliche Stellung von Menschen mit Down-Syndrom und deren Darstellung in den Medien. Die Bedeutung des Lesens und Schreibens für diese Personengruppe wird ebenfalls thematisiert, unterstrichen durch die besondere Relevanz des Mediums Schrift im Kontext von „OHRENKUSS“ als zentralem Bestandteil der Untersuchung.
4 Empowerment-Konzept: Dieses Kapitel führt das Empowerment-Konzept ein, erklärt den Begriff und sein Menschenbild, beschreibt die Leitprinzipien und Methoden. Es enthält eine kritische Betrachtung des Konzepts und analysiert dessen Relevanz im Kontext von „OHRENKUSS“. Das Kapitel analysiert detailliert die Anwendung des Empowerment-Konzepts im Kontext von „OHRENKUSS“. Die Autorin beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Konzepts und diskutiert dessen praktische Umsetzung im Rahmen des Projekts. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Zusammenhangs zwischen Empowerment und der Förderung der Lebenszufriedenheit der Redakteure.
5 Lebenszufriedenheit: Das Kapitel definiert den Begriff der Lebenszufriedenheit und zeigt verschiedene Forschungsansätze zur Erfassung dieses Aspekts bei Menschen mit geistiger Behinderung auf. Es diskutiert die unterschiedlichen Perspektiven auf Lebenszufriedenheit, insbesondere im Kontext der individuellen Erfahrungen und Perspektiven der Menschen mit Down-Syndrom. Das Kapitel betont den Zusammenhang zwischen Lebensqualität, Normalisierung und Lebenszufriedenheit und erläutert die Methoden der Erfassung und Interpretation der Lebenszufriedenheit in Bezug auf die vorliegende Studie.
6 Schlussfolgerungen und Fragestellungen: Dieses Kapitel präzisiert die Forschungsfragen der Arbeit und erläutert das gewählte theoretische Rahmenmodell, insbesondere Bronfenbrenners systemökologische Perspektive. Es wird dargelegt, warum diese Perspektive für die Untersuchung geeignet ist und welche Aspekte des sozialen Umfelds in die Untersuchung einbezogen werden. Die zentralen Fragen der Studie werden hier klar umrissen und mit der gewählten Methodik in Verbindung gebracht.
7 Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie, die verwendeten Forschungsmethoden (qualitative Interviews, Elternfragebögen) und den Ablauf der Untersuchung. Es gibt Auskunft über die Stichprobenselektion und die Auswertung der Daten. Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in den Forschungsprozess, von der Planung über die Datenerhebung bis zur Datenanalyse. Die Autorin beschreibt die Methoden der Datenerhebung und -auswertung, inklusive der verwendeten Instrumente (Interviewleitfaden, Rating-Skalen, Elternfragebogen) und begründet die Wahl dieser Methoden.
Schlüsselwörter
Lebenszufriedenheit, Down-Syndrom, Empowerment, „OHRENKUSS“, qualitative Forschung, geistige Behinderung, Selbstwertgefühl, Inklusion, Selbstbestimmung, Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu „OHRENKUSS...da rein, da raus“ - Magisterarbeit
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Lebenszufriedenheit von Menschen mit Down-Syndrom anhand des Magazins „OHRENKUSS...da rein, da raus“. Im Mittelpunkt steht der Einfluss des Schreibens und Mitteilens im Magazin auf das Selbstwertgefühl und die individuelle Wahrnehmung der Redakteure. Die Arbeit verbindet empirische Ergebnisse mit theoretischen Konzepten wie Empowerment und Normalisierung.
Was ist „OHRENKUSS...da rein, da raus“?
„OHRENKUSS...da rein, da raus“ ist ein Magazin, das von Menschen mit Down-Syndrom selbst gestaltet und herausgegeben wird. Die Arbeit beschreibt ausführlich die Entstehung, Zielsetzung, den Aufbau der Redaktion und die Arbeitsprinzipien des Magazins. Der Fokus liegt auf der selbstbestimmten Mitwirkung der Redakteure.
Welche theoretischen Konzepte werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Konzepte von Empowerment und Normalisierung. Das Empowerment-Konzept wird detailliert erläutert, inklusive seiner Leitprinzipien, Methoden und einer kritischen Betrachtung. Der Zusammenhang zwischen Empowerment, Normalisierung und der Förderung der Lebenszufriedenheit der Redakteure wird analysiert.
Wie wird Lebenszufriedenheit in der Arbeit definiert und erforscht?
Die Arbeit definiert den Begriff der Lebenszufriedenheit und präsentiert verschiedene Forschungsansätze zu deren Erfassung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Es wird der Zusammenhang zwischen Lebensqualität, Normalisierung und Lebenszufriedenheit diskutiert, sowie die Methoden zur Erfassung und Interpretation der Lebenszufriedenheit im Kontext der Studie erläutert.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet qualitative Forschungsmethoden, darunter qualitative Interviews mit den Redakteuren und Elternfragebögen. Das Kapitel „Methodik“ beschreibt detailliert den Ablauf der Untersuchung, die Stichprobenbeschreibung und die Auswertung der Daten. Die Wahl der Methoden wird begründet.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die empirischen Ergebnisse der Studie. Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse findet sich im Kapitel „Ergebnisse“. Die Diskussion dieser Ergebnisse im Kontext der theoretischen Konzepte erfolgt im Kapitel „Diskussion“.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Kapitel „Schlussfolgerungen und Fragestellungen“ fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und diskutiert die Bedeutung der Studie im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit von Menschen mit Down-Syndrom und den Beitrag des Magazins „OHRENKUSS“ zur gesellschaftlichen Teilhabe.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lebenszufriedenheit, Down-Syndrom, Empowerment, „OHRENKUSS“, qualitative Forschung, geistige Behinderung, Selbstwertgefühl, Inklusion, Selbstbestimmung, Teilhabe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, „OHRENKUSS...da rein, da raus“, Menschen mit Down-Syndrom – Begriffsklärungen, Empowerment-Konzept, Lebenszufriedenheit, Schlussfolgerungen und Fragestellungen, Methodik, Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Code enthalten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Pädagogen, Therapeuten und alle, die sich mit der Lebenszufriedenheit von Menschen mit Down-Syndrom, Inklusion und Empowerment befassen. Sie bietet wertvolle Einblicke in die Praxis und die theoretischen Hintergründe.
- Citar trabajo
- Julia Strupp (Autor), 2004, Zur Lebenszufriedenheit von Menschen mit Down-Syndrom: Untersucht am Beispiel des Magazins "OHRENKUSS... da rein, da raus", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59294