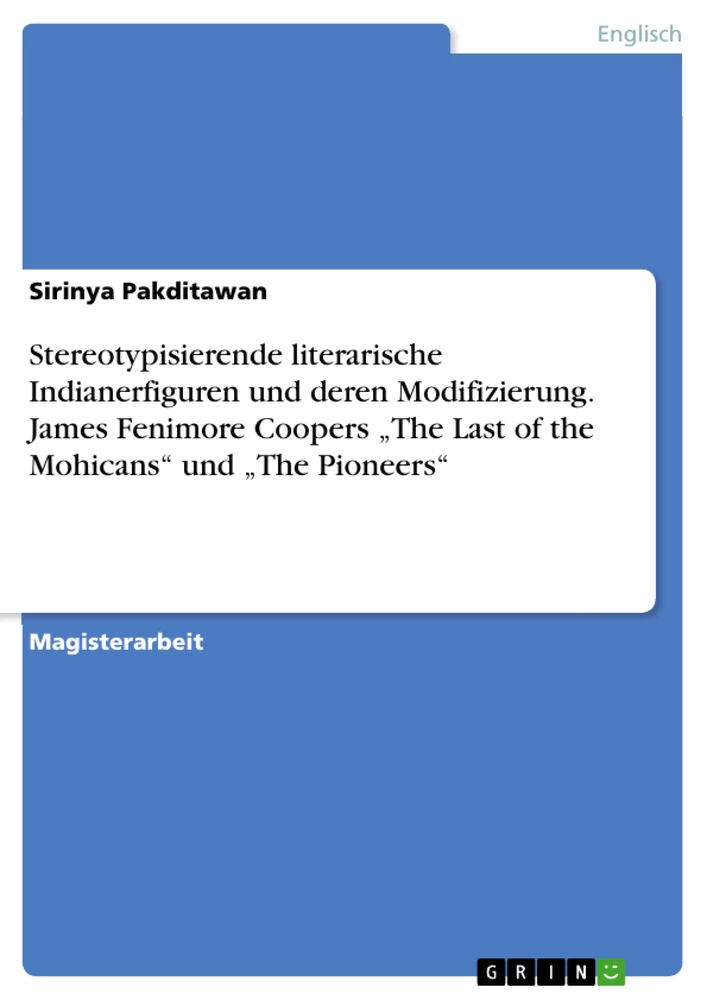James Fenimore Coopers Werk markiert den Beginn der Indianerliteratur des 19. Jahrhunderts. In seinen Indianerromanen stellt Cooper die Beziehung der Angloamerikaner zu den Indianern dar und entwirft darüber hinaus ein Bild des Indianers, das am nachhaltigsten die Vorstellung vom typischen Indianer in der Literatur geprägt hat. Hierbei ist Cooper einerseits der europäischen Aufklärung verpflichtet, die den "noble savage" „erfand“. Andererseits greift Cooper auch das puritanische Feindbild des Indianers, den "satanic savage", auf. Darüber hinaus orientiert sich Cooper aber auch an zeitgenössischen spezifisch amerikanischen Vorstellungen von Indianern, wie dem "vanishing American". Im Ganzen präsentiert Cooper ein stereotypisiertes Bild des Indianers, indem er ihn unter die simple Dichotomie des „guten“ und des „bösen“ Indianers subsumiert. Dennoch problematisiert Cooper bestimmte Klischees des Fremden, indem er einzelne Indianer individualisiert.
Diese Arbeit untersucht, wie Cooper den „typischen“ Indianer darstellt und wie er zentrale Indianergestalten individualisiert. Hierbei wird zunächst auf die Traditionen und Quellen eingegangen, denen Coopers Indianerdarstellung verpflichtet ist. Diese Arbeit richtet sich vor allem an Studierende und Mitarbeiter im Fachbereich Amerikanistik, sowie an alle Interessierten auf dem Gebiet der Indianerliteratur.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Stereotypisierende Indianerbilder in der nordamerikanischen Literatur
- 1.1. Der „teuflische Wilde“ der Puritaner
- 1.2. Der „edle Wilde“ der europäischen Aufklärung
- 1.3. Der „edle Wilde“ der Amerikaner und andere amerikanisch-indianische Stereotypen
- 1.3.1. The vanishing American
- 1.3.2. Der „gute“ Indianer
- 1.3.3. Der blutrünstige und der degenerierte Indianer
- 2. Coopers problembewusste Indianer-Bearbeitung
- 2.1. Coopers Informationsquellen
- 2.2. Festschreibung und Verarbeitung der Quellen
- 2.2.1. Captivity narratives und melodramatische
- 2.2.2. Der Missionar Heckewelder
- 3. Indianer-Typen in The Last of the Mohicans
- 3.1. Stereotype Charakterisierung des indianischen Wesens
- 3.1.1. „Typische“ Indianer und die „guten“ Delawaren
- 3.2. Naturgebundenheit und Statik als Merkmale der indianischen Zivilisation
- 4. Magua: Der „teuflische Wilde“ mit komplexem Charakter
- 4.1. Äußere Erscheinung und Verhalten
- 4.2. Negative Charakterentwicklung und Widerspruch
- 5. Uncas: Der zivilisationswillige „edle Wilde“
- 5.1. Äußere Erscheinung und Verhalten
- 5.2. Positiver Entwicklungsprozess und Affiliation mit der angloamerikanischen Zivilisation
- 6. Chingachgook: Der unzivilisierbare „edle Wilde“
- 6.1. Ambivalentes Wesen des nicht zivilisierbaren „guten“ Indianers
- 6.2. Vom „guten“ zum degenerierten Indianer
- 7. Resümee
- 8. Anmerkungen
- 9. Literaturverzeichnis
- 9.1. Primärliteratur
- 9.2. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Darstellung von Indianern in den Werken von James Fenimore Cooper, insbesondere in den Romanen „The Last of the Mohicans“ und „The Pioneers“. Sie analysiert, wie Cooper die stereotypisierten Bilder des „edlen Wilden“ und des „teuflischen Wilden“ verwendet und gleichzeitig versucht, die Komplexität der indianischen Kultur und ihrer Mitglieder zu zeigen.
- Entwicklung des stereotypischen Indianerbildes in der nordamerikanischen Literatur
- Coopers Verwendung von Quellen und seine Gestaltung der Indianerfiguren
- Die Ambivalenz in Coopers Darstellung des Indianers zwischen „gut“ und „böse“
- Die Rolle der weißen Zivilisation in der „Entartung“ und Veränderung des Indianers
- Die Bedeutung von Coopers Werk für das Verständnis des Mythos vom „Roten Mann“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über Coopers Werke und stellt die Relevanz seiner Indianerdarstellung heraus. Kapitel 1 beleuchtet die historische Entwicklung des stereotypischen Indianerbildes, von den Puritanern bis zu den amerikanischen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts. Kapitel 2 untersucht Coopers Informationsquellen und die Art und Weise, wie er diese in seinen Romanen verarbeitet.
Kapitel 3 fokussiert auf die Darstellung der Indianer in „The Last of the Mohicans“, besonders auf die stereotypischen Charakterisierungen des indianischen Wesens. Kapitel 4 widmet sich der Figur des Magua, einem komplexen Charakter, der als „teuflischer Wilder“ dargestellt wird. Kapitel 5 analysiert den „edlen Wilden“ Uncas und seine Zivilisationswilligkeit.
Schlussendlich wird in Kapitel 6 der ambivalente Charakter des „guten“ Indianers Chingachgook untersucht, der sich von einem edlen Wilden zu einem „degenerierten“ entwickelt. Das Resümee fasst die wichtigsten Punkte der Untersuchung zusammen.
Schlüsselwörter
Stereotypisierung, Indianerbild, James Fenimore Cooper, „The Last of the Mohicans“, „The Pioneers“, „edler Wilder“, „teuflischer Wilder“, Kulturkritik, Zivilisation, Natur, Degeneration, Mythos, amerikanische Nationalliteratur.
- Citation du texte
- Sirinya Pakditawan (Auteur), 2004, Stereotypisierende literarische Indianerfiguren und deren Modifizierung. James Fenimore Coopers „The Last of the Mohicans“ und „The Pioneers“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59352