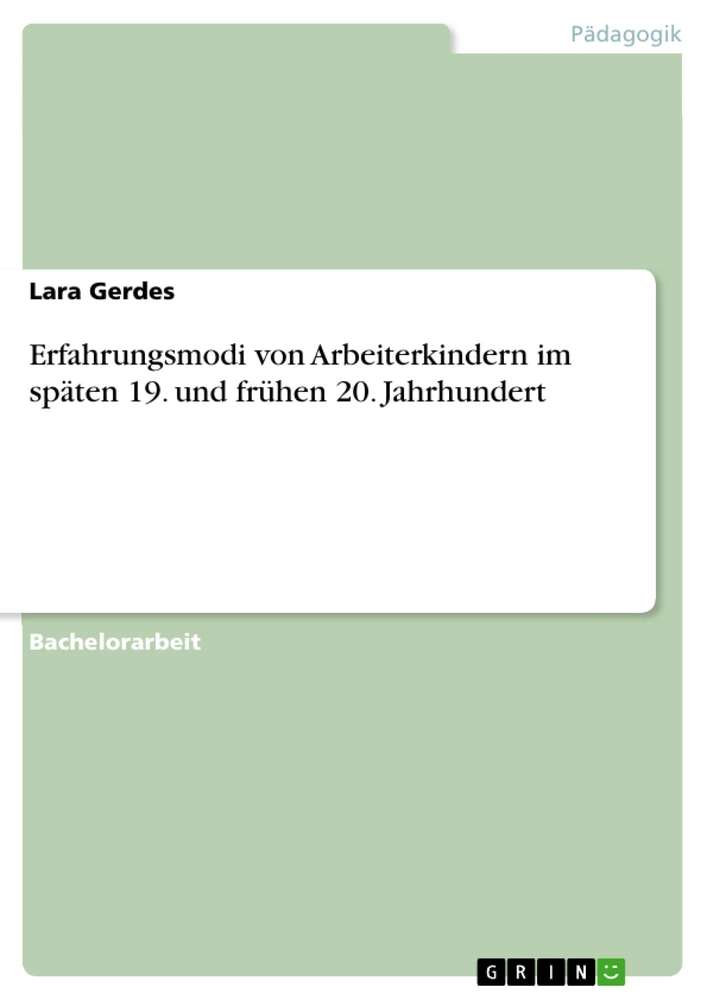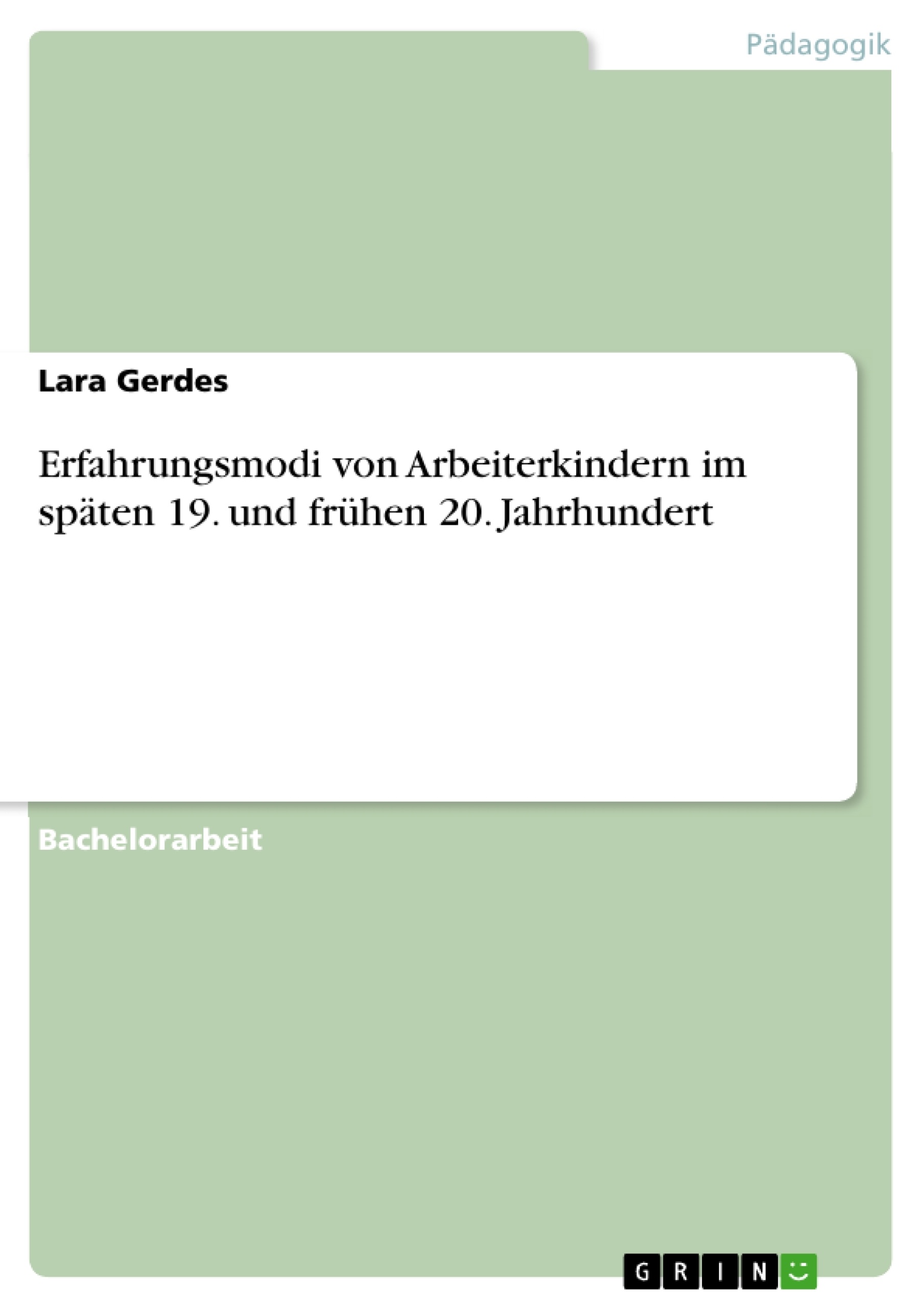Schwer arbeitende Kinder – in unserer modernen Idealvorstellung von Kindheit klingt das eher befremdlich und abschreckend. Für die Heranwachsenden der untersten Gesellschaftsschicht um 1900 war dies jedoch die alltägliche Realität. Neben den schlechten Wohnbedingungen und der bereits in frühen Kinderjahren beginnenden harten Arbeit in Fabriken, im Haushalt, der Heimindustrie und auf dem Land bestimmten Familienspannungen, Brutalität und Krankheit ihr junges Dasein. Diese äußere Lebenswelt der Menschen zur Zeit der Industrialisierung wurde politik-, wirtschafts- und mentalitätsgeschichtlich vermehrt ab 1970 erforscht. Aber wie genau wurden diese äußeren Umstände von den Kindern und Jugendlichen verarbeitet? Wurden sie überhaupt verarbeitet? Oder endeten die Leidenserfahrungen zwangsläufig in einer Verödung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Verortung
- Sozialisation
- Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung
- Zentrale Begriffe der Sozialisationsforschung
- Historische Sozialisationsforschung
- Pädagogisch-biographische historische Sozialisationsforschung
- Die Situation der ArbeiterInnen um 1900
- Die Kindheit der ArbeiterInnenkinder um 1900 – allgemeine und besondere Erfahrungsmodi
- Die allgemeine Lebenswelt von Arbeiterkindern in dieser Zeit
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich aus den strukturellen Bedingungen der Gesellschaft ergaben
- Die Bedeutung von Sozialisationsprozessen für die Persönlichkeitsentwicklung
- Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Erfahrungsmodi, die durch die jeweiligen Lebensbereiche (Familie, Arbeit, Schule etc.) geprägt wurden
- Die Frage, inwieweit aktive und produktive Verarbeitungs- und Handlungsversuche von den Kindern und Jugendlichen unternommen wurden, um eine positive Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Lebensbedingungen von Arbeiterkindern im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Das Hauptziel der Untersuchung ist es, die individuellen Begegnungen der Kinder mit den prägenden Bedingungen ihrer Kindheit und Jugend zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Einleitung und einer Definition des Begriffs "Sozialisation" und führt das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung ein. Es werden zentrale Begriffe der Sozialisationsforschung erläutert, die historische Sozialisationsforschung sowie der pädagogisch-biografische Ansatz von Cloer, Klika und Seyfarth-Stubenrauch vorgestellt.
Kapitel drei schildert die allgemeine Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter um 1900.
Kapitel vier untersucht die Kindheit der Arbeiterkinder um 1900. Es werden die typischen Erfahrungen in den Bereichen Familie, Straße, Arbeit und Schule anhand von autobiografischen Beispielen analysiert.
Schlüsselwörter
Arbeiterkinder, Sozialisation, historische Sozialisationsforschung, Lebensbedingungen, Erfahrungsmodi, produktive Realitätsverarbeitung, Persönlichkeitsentwicklung, Kindheit, Jugend, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Industrialisierung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie war die Kindheit von Arbeiterkindern um 1900?
Sie war geprägt von harter Arbeit in Fabriken oder Heimindustrie, schlechten Wohnbedingungen, familiären Spannungen und oft auch Brutalität und Krankheit.
Was bedeutet „produktive Realitätsverarbeitung“?
Es beschreibt den Prozess, wie Kinder und Jugendliche aktiv versuchen, ihre schwierigen Lebensumstände zu bewältigen und eine eigene Identität zu entwickeln.
Welche Rolle spielte die Schule für Arbeiterkinder damals?
Die Schule war oft ein Ort strenger Disziplin, bot aber gleichzeitig einen der wenigen Räume außerhalb der harten Arbeitswelt der Familie.
Wie untersuchten Forscher diese Kindheitserfahrungen?
Wichtige Quellen sind autobiografische Berichte, die im Rahmen der pädagogisch-biographischen historischen Sozialisationsforschung analysiert werden.
Führten die Leidenserfahrungen zwangsläufig zur Verödung?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und zeigt auf, dass viele Kinder trotz der widrigen Umstände aktive Handlungsstrategien entwickelten.
- Citar trabajo
- Lara Gerdes (Autor), 2020, Erfahrungsmodi von Arbeiterkindern im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593581