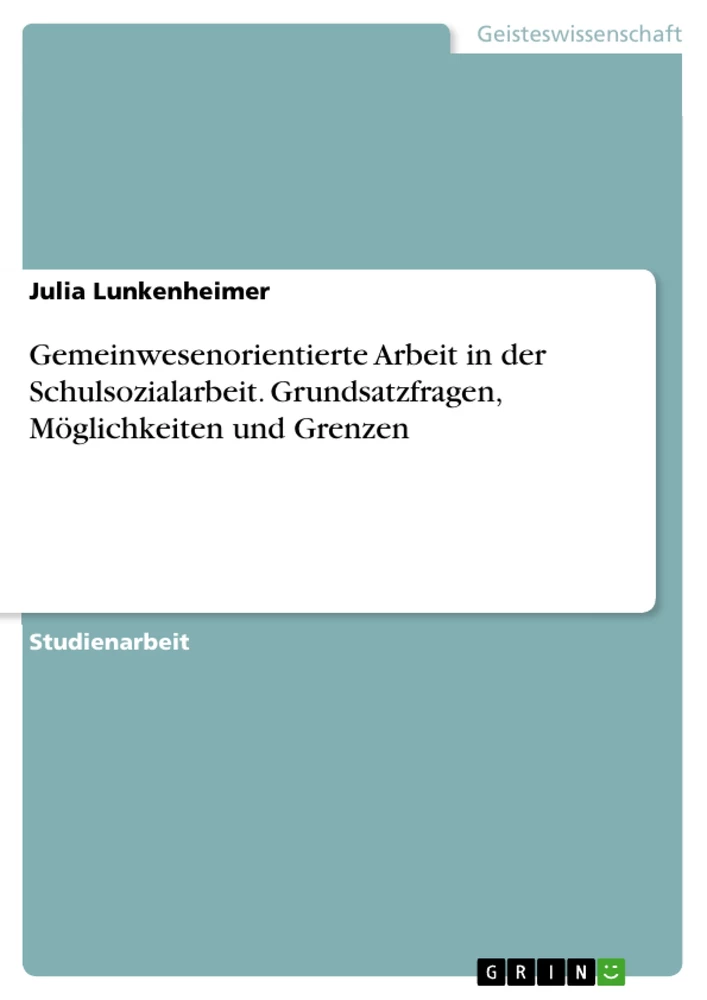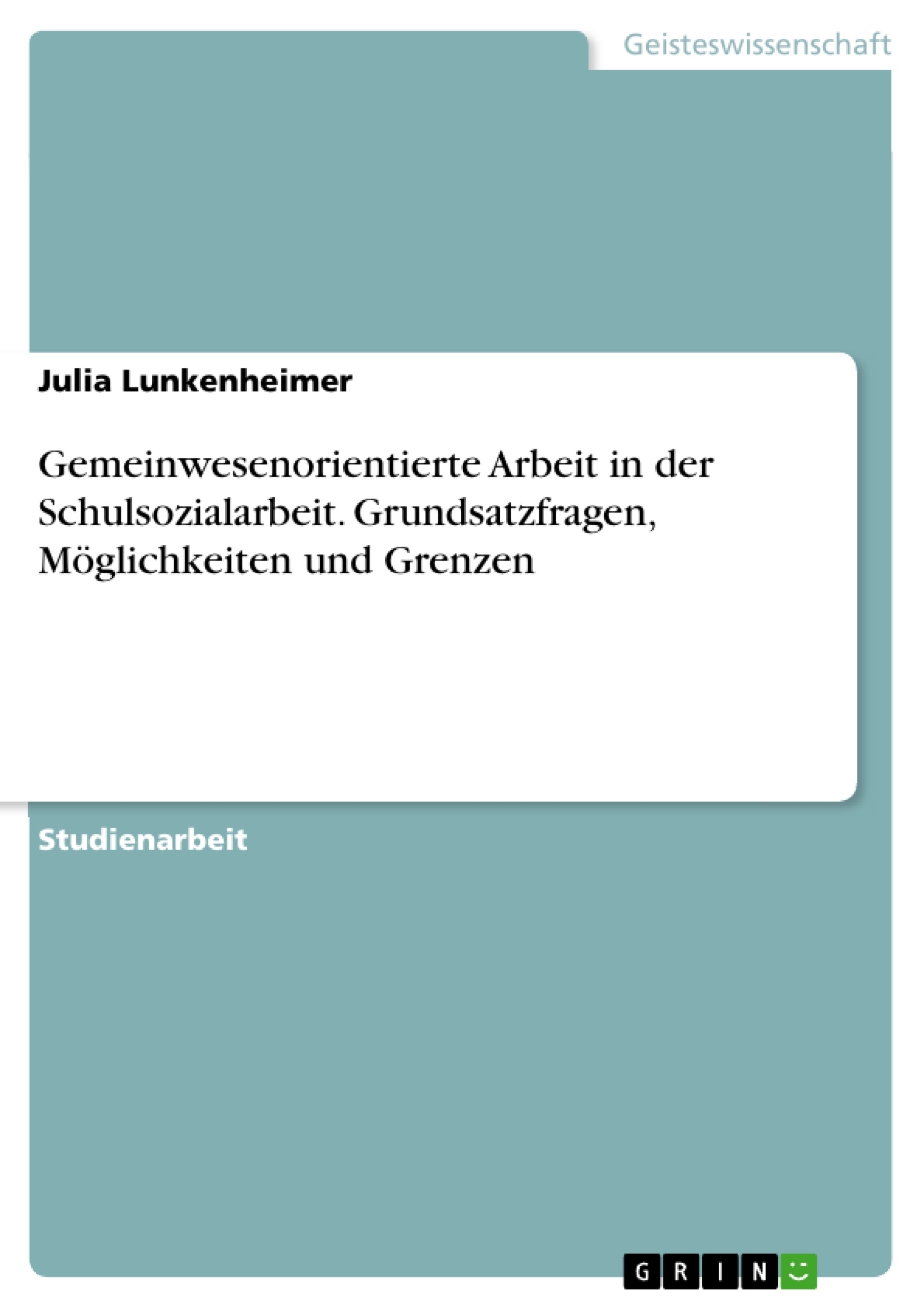Die Schulsozialarbeit (SSA) ist als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit noch relativ jung und dahingehend noch in der Entwicklung bezüglich allgemeingültiger Definition, Konzeption und Aufgaben. Es stellt sich die Frage, ob SSA nur für die Schule oder auch das Gemeinwesen zuständig ist. Neben dieser Grundsatzfrage ist es darüber hinaus wichtig zu klären, wo die Möglichkeiten und Grenzen einer gemeinwesenorientierten SSA liegen. Würde dann ein anderes Profil von SSA notwendig werden?
Schule wird nach wie vor verbunden mit Leistungsdruck, Lernstress und Mangel an Freizeit. Interessen und Eigeninitiative werden wenig gefördert. Die Entwicklung des Kindes hin zu einem selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und kreativen Menschen erfährt keine Förderung, sondern wird gehemmt durch festgelegte Lerninhalte und institutionelle Strukturen, welche starr und vorgegeben sind. Gleichwohl beginnt sich seit dem 12. Kinder- und Jugendbericht vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ 2005) in Deutschland ein Wandel hinsichtlich des Bildungsverständnisses zu vollziehen. Bildung versteht sich in einem Wechselspiel zwischen formalen und informellen Prozessen, wodurch nicht nur institutionell arrangierte Bildungsmöglichkeiten, sondern gleichwohl lebensweltspezifische Bildungsgelegenheiten im Mittelpunkt stehen.
Unter dem Begriff lokale Bildungslandschaften soll eine sozialräumliche Perspektive eingenommen werden, die unterschiedlichste Bildungsorte und -gelegenheiten im Rahmen von Kooperation und Vernetzung miteinander verbindet. Dazu gehören Bildungsorte wie Schule, Einrichtungen und Angebote der Jugendhilfe, Familie, Freunde, Medien oder kulturelle Angebote. Eine wichtige Brückenfunktion zwischen den verschiedenen Bildungsorten nimmt die Schulsozialarbeit (SSA) ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gemeinwesenarbeit
- Eine kurze Einführung
- Bildung und Gemeinwesen
- Das Verständnis von Bildung im Wandel
- Bildung in sozialräumlicher Perspektive: Lokale Bildungslandschaften
- Schulsozialarbeit
- Eine Einführung
- Geschichtlicher Abriss
- Definition
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Aufgaben und Zielgruppe
- Schulsozialarbeit im Rahmen lokaler Bildungslandschaften
- Gründe für eine gemeinwesenorientierte Schulsozialarbeit
- Aufgaben
- Möglichkeiten und Grenzen
- Eine Einführung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich mit der gemeinwesenorientierten Arbeit in der Schulsozialarbeit auseinander. Sie untersucht die grundsätzlichen Fragen, Möglichkeiten und Grenzen dieses Arbeitsansatzes im Kontext der lokalen Bildungslandschaften.
- Das Verständnis von Bildung im Wandel und die Bedeutung von lebensweltspezifischen Bildungsgelegenheiten
- Die Rolle der Gemeinwesenarbeit (GWA) in der Sozialen Arbeit und ihre Anwendung im Bildungsbereich
- Die Definition, Aufgaben und Herausforderungen der Schulsozialarbeit (SSA) im Rahmen lokaler Bildungslandschaften
- Die Möglichkeiten und Grenzen einer gemeinwesenorientierten SSA
- Die Frage nach dem Profil einer gemeinwesenorientierten SSA
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt mit einem Zitat von Seneca in die Thematik ein und beleuchtet den Wandel im Bildungsverständnis hin zu einem Wechselspiel zwischen formalen und informellen Bildungsprozessen. Sie beschreibt die Bedeutung lokaler Bildungslandschaften und die Rolle der Schulsozialarbeit als Schnittstelle zwischen verschiedenen Bildungsorten.
Das Kapitel "Gemeinwesenarbeit" stellt diese als eine der drei klassischen Methoden der Sozialen Arbeit vor. Es erläutert die historische Entwicklung und die Bedeutung der GWA für die Aktivierung von Ressourcen im Sozialraum.
Das Kapitel "Schulsozialarbeit" definiert und beschreibt die Geschichte, Aufgaben und Rahmenbedingungen der SSA. Es fokussiert auf die Bedeutung der SSA im Kontext lokaler Bildungslandschaften und untersucht die Gründe für eine gemeinwesenorientierte SSA sowie deren Möglichkeiten und Grenzen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe der Arbeit sind Gemeinwesenarbeit, Schulsozialarbeit, lokale Bildungslandschaften, sozialräumliche Perspektive, Bildung im Wandel, Ressourcenaktivierung, Aufgaben und Grenzen der Schulsozialarbeit.
- Quote paper
- Julia Lunkenheimer (Author), 2014, Gemeinwesenorientierte Arbeit in der Schulsozialarbeit. Grundsatzfragen, Möglichkeiten und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593664