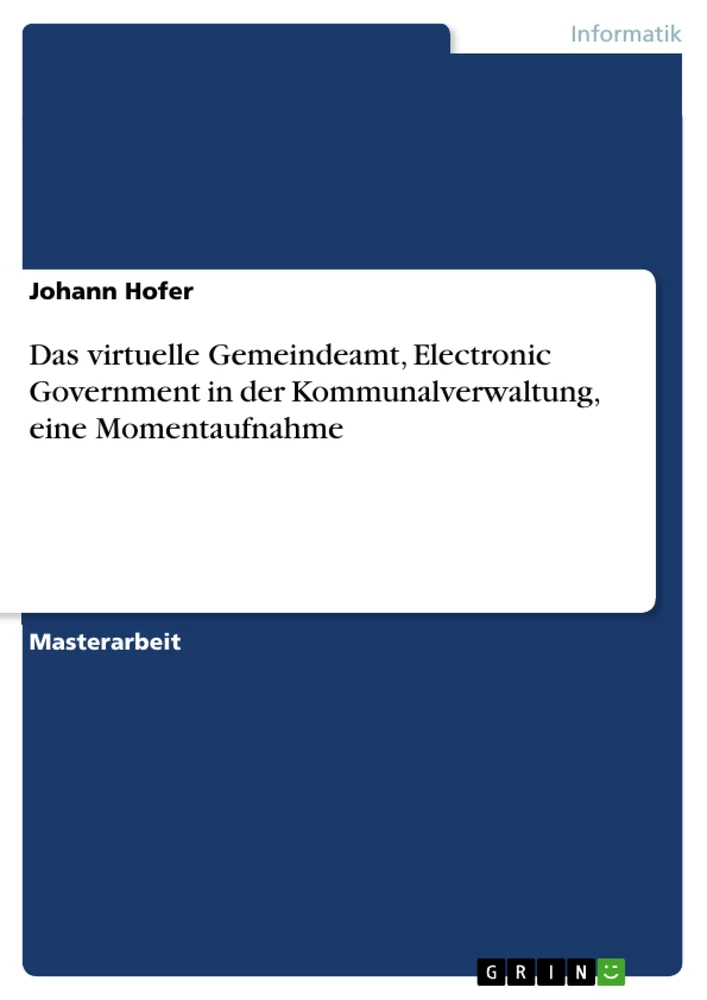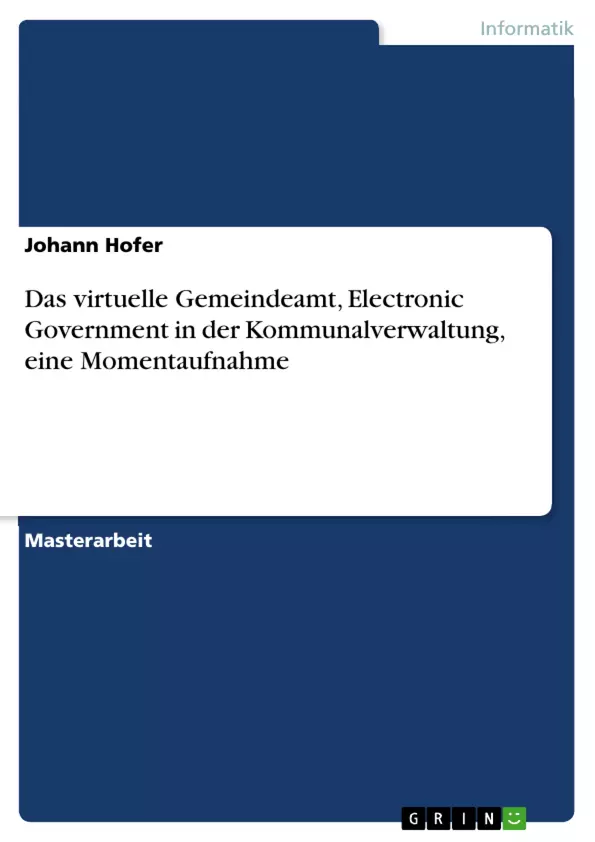Seit einigen Jahren halten die Ideen des New Public Management Einzug in der öffentlichen Verwaltung. Weit über Europa hinaus bilden sich Netzwerke, die dieses Thema diskutieren und erforschen. In vielen Staaten gibt es auch auf politischer, bürokratischer und universitärer Ebene mannigfache Bestrebungen, die Ideen des New Public Management zu unterstützen und umzusetzen. Im Zuge dieser Diskussionen und Bemühungen um eine Modernisierung und Entbürokratisierung öffentlicher Verwaltungen, ist auch der junge Forschungsbereich des Electronic Government entstanden. Dieses Gebiet ist zwar kein zwingender Bestandteil des New Public Management, es ist aber doch im Kontext mit der Verwaltungsmodernisierung nicht wegzudenken. Denn E-Government ist trotz vieler offener Fragen bereits mehr als eine Vision. Mit dem Einsatz moderner Informations-und Kommunikationstechnologie soll staatliche Tätigkeit für Bürger, Politik, Verwaltung und Wirtschaft effizienter, einfacher und transparenter gestaltet werden. Auch für die österreichischen Gemeinden bietet Electronic Government eine Menge von Vorteilen und auch die Chance, bisher brachliegende Synergieeffekte in großem Ausmaß zu nutzen. Die seriöse und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem teilweise noch sehr unstrukturierten Thema E-Government ist daher unerlässlich. Denn die praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse im Alltag, vor allem auf breiter Ebene in den Gemeinden, wird ein wesentlicher Faktor für den Erfolg, die Akzeptanz und die Nachhaltigkeit von Electronic Government werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Darstellung des Themas
- 1.2 Persönliche Beweggründe für die Themenwahl
- 1.3 Thesen und Überlegungen
- 1.3.1 E-Government für kleine und mittlere Gemeinden - Problemdarstellung
- 1.3.2 E-Government im Kontext Bürger - Verwaltung
- 1.3.3 E-Government - Ausbildungsanforderungen in der Verwaltung
- 1.3.4 E-Government als Ausgrenzungsfaktor
- 1.3.5 E-Government aus dem Blickwinkel 50+
- 2. E-Government
- 2.1 Begriffsdefinitionen
- 2.2 E-Government als Teil des New Public Management
- 2.3 Abgrenzung zu E-Commerce und E-Business
- 2.4 Anwendungsmöglichkeiten von E-Government im Kommunalbereich
- 2.4.1 E-Administration
- 2.4.2 E-Assistance
- 2.4.3 E-Democracy
- 2.4.4 Bürgerportal am Beispiel der Marktgemeinde Wilhering
- 2.5 G2? - Die Beziehungsebenen von E-Government
- 2.5.1 G2G Government to Government
- 2.5.2 G2C Government to Consumer
- 2.5.3 G2Z Government to Citizen
- 2.5.4 G2B Government to Business
- 2.5.5 G2N Government to Non-Governmental
- 2.6 Das Österreichische E-Government Gütesiegel
- 2.7 Kritische Problembetrachtung
- 2.7.1 Einheitliche Standards - eEurope
- 2.7.2 Datenschutz, Datensicherheit und akzeptable Risiken
- 2.8 Standardkomponenten für E-Government
- 2.8.1 Bürgerkarte
- 2.8.2 Kryptografie und digitale Signatur
- 2.9 Gesetzliche Basis
- 2.9.1 E-Government-Gesetz (E-GovG)
- 2.9.2 Signaturgesetz (SigG)
- 2.9.3 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
- 3. Zusammenfassung und Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Einführung von E-Government in der Kommunalverwaltung und analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Implementierung von Informations- und Kommunikationstechnologie in den öffentlichen Sektor ergeben.
- Analyse des E-Government-Konzepts und seiner Anwendungsmöglichkeiten in österreichischen Gemeinden
- Bewertung der Vorteile und Herausforderungen von E-Government für die öffentliche Verwaltung
- Untersuchung der Auswirkungen von E-Government auf Bürger, Verwaltung und Wirtschaft
- Beurteilung der Bedeutung von Standards, Datenschutz und Sicherheit für E-Government
- Evaluierung der rechtlichen Grundlagen und der notwendigen Schritte zur erfolgreichen Einführung von E-Government in der österreichischen Kommunalverwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit dient der Einführung in das Thema E-Government. Es werden die persönlichen Beweggründe für die Themenwahl sowie die zentralen Thesen und Überlegungen dargestellt. Insbesondere wird die Relevanz von E-Government für kleine und mittlere Gemeinden sowie die Herausforderungen im Kontext der Beziehung zwischen Bürger und Verwaltung beleuchtet.
Kapitel Zwei befasst sich mit dem E-Government-Konzept und seinen verschiedenen Facetten. Es werden Begriffsdefinitionen vorgestellt, E-Government als Teil des New Public Management erläutert und die Abgrenzung zu E-Commerce und E-Business vorgenommen. Ein Schwerpunkt liegt auf den Anwendungsmöglichkeiten von E-Government im Kommunalbereich, wobei die verschiedenen Kategorien E-Administration, E-Assistance, E-Democracy sowie das Bürgerportal am Beispiel der Marktgemeinde Wilhering näher untersucht werden.
Der dritte Abschnitt beleuchtet die Beziehungsebenen von E-Government und die damit verbundenen Herausforderungen. Insbesondere werden die Bereiche Government to Government (G2G), Government to Consumer (G2C), Government to Citizen (G2Z), Government to Business (G2B) und Government to Non-Governmental (G2N) behandelt.
Kapitel vier widmet sich dem Österreichischen E-Government Gütesiegel und stellt die Bedeutung von Standards, Datenschutz und Sicherheit für die erfolgreiche Umsetzung von E-Government in der Praxis heraus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema E-Government im Kontext der österreichischen Kommunalverwaltung. Zu den zentralen Begriffen zählen dabei die Konzepte des New Public Management, der E-Administration, der E-Democracy, des Bürgerportals, des Datenschutzes, der Datensicherheit und der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Electronic Government (E-Government) für Kommunen?
Es bezeichnet den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien, um Verwaltungsprozesse für Bürger und Wirtschaft effizienter und transparenter zu gestalten.
Welche Vorteile bietet das „virtuelle Gemeindeamt“?
Vorteile sind unter anderem Synergieeffekte bei der Datenverwaltung, Zeitersparnis durch Online-Formulare und eine verbesserte Erreichbarkeit der Behörden.
Was bedeuten Abkürzungen wie G2C und G2B?
G2C steht für „Government to Citizen“ (Bürgerdienste) und G2B für „Government to Business“ (Dienstleistungen für Unternehmen).
Welche rechtlichen Grundlagen gibt es für E-Government in Österreich?
Zentrale Gesetze sind das E-Government-Gesetz (E-GovG), das Signaturgesetz (SigG) und das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz.
Ist E-Government ein Ausgrenzungsfaktor für ältere Menschen?
Die Arbeit beleuchtet kritisch den Blickwinkel der Generation 50+ und die Gefahr einer digitalen Kluft, falls keine barrierefreien Zugänge geschaffen werden.
- Quote paper
- Johann Hofer (Author), 2005, Das virtuelle Gemeindeamt, Electronic Government in der Kommunalverwaltung, eine Momentaufnahme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59371