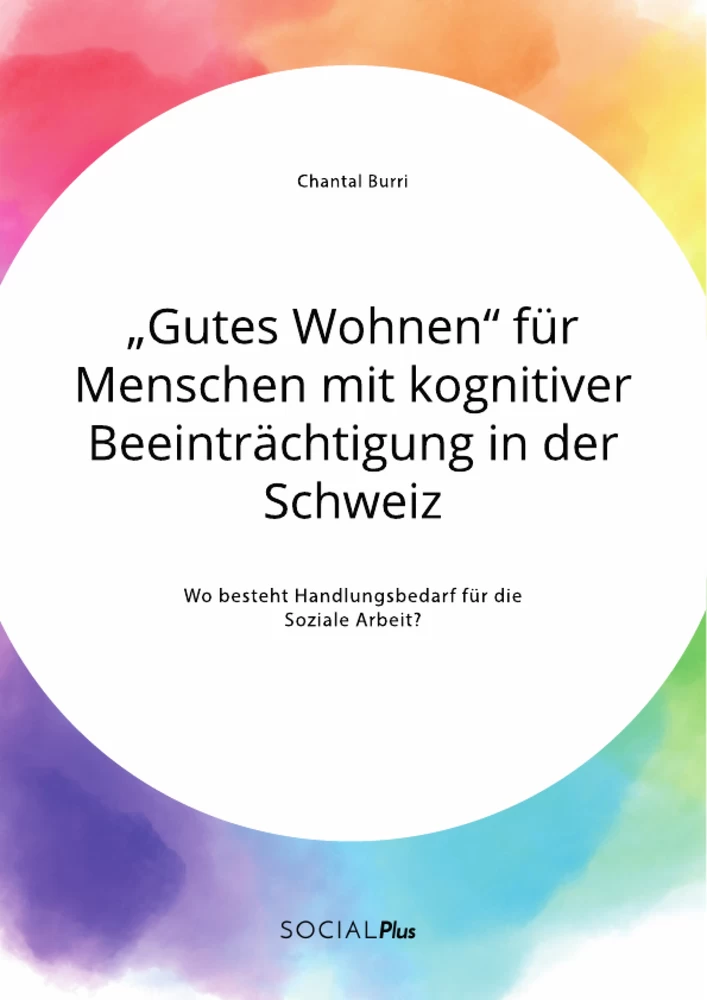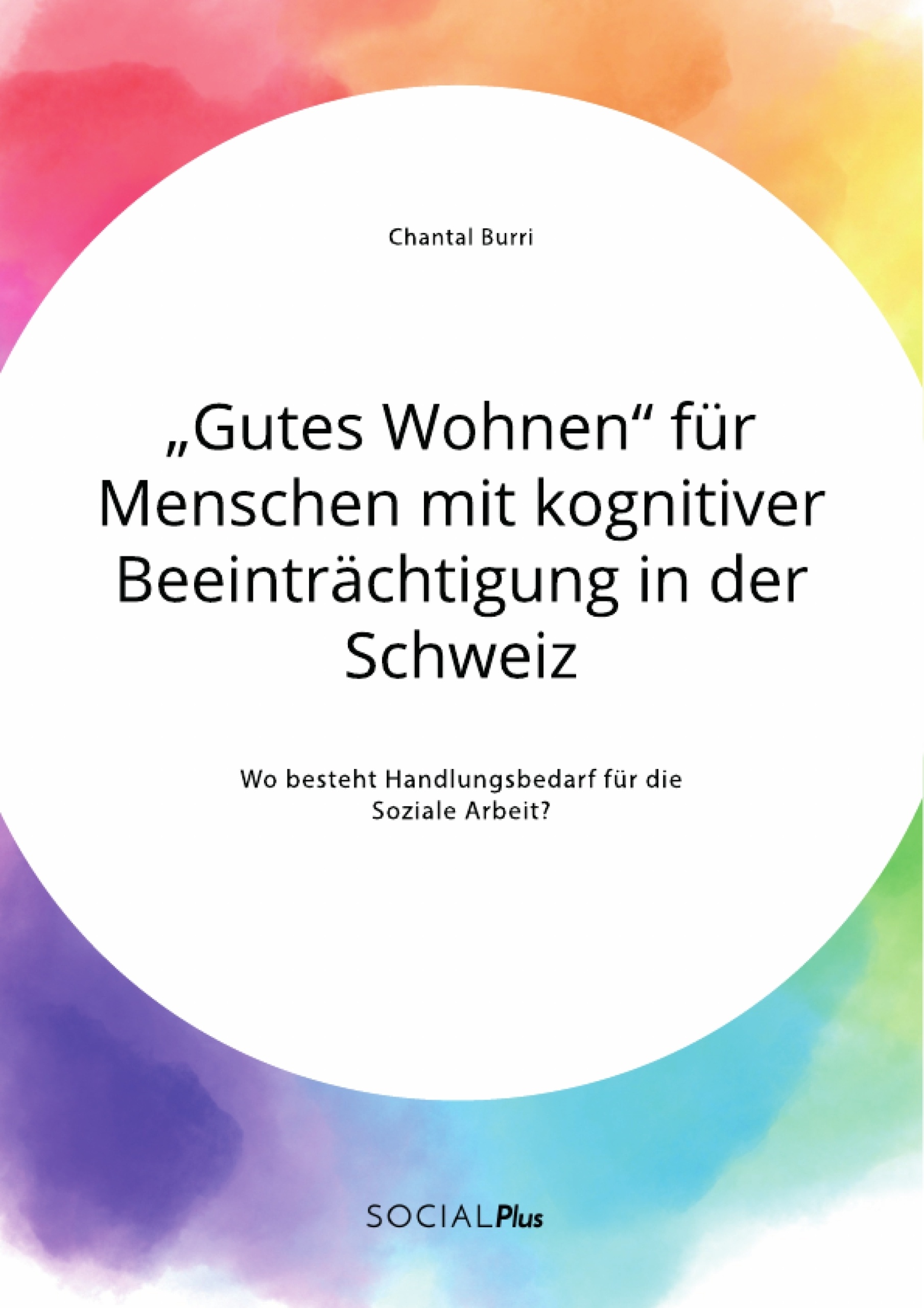Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen fordert Wahlfreiheit bezüglich der eigenen Wohnsituation. Wichtige Aspekte dabei sind die Forderungen nach Gleichberechtigung, Zugang zu gemeindenahen Dienst- und Unterstützungsleistungen sowie die Möglichkeit zu persönlicher Assistenz. Doch inwiefern werden diese Ziele heute in der Schweiz erfüllt?
Wie lässt sich „gutes Wohnen“ für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung erfassen? Welche Anforderungen für bestehende Wohnformen in der Schweiz lassen sich daraus ableiten? Welche Konsequenzen bringen diese Erkenntnisse für die Soziale Arbeit mit sich?
Chantal Burri befasst sich mit den Anforderungen an ein „gutes Wohnen“ für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in der Schweiz. Anhand ausgewählter Leitprinzipien bewertet sie die verschiedenen Wohnformen und zeigt deren Potentiale, aber auch den jeweiligen Handlungsbedarf. Ihr Buch richtet sich an Mitarbeiter:innen der Behindertenhilfe, aber auch allgemein an Sozialarbeiter.
Aus dem Inhalt:
- Selbstbestimmung;
- Capability Approach;
- Sozialräumliche Teilhabe;
- Empowerment;
- Inklusion;
- Normalisierung
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage
- Persönliche Motivation
- Erkenntnisinteresse und Fragestellung
- Relevanz für die Soziale Arbeit
- Eingrenzung des Themas
- Aufbau der Arbeit
- Wohnen und Beeinträchtigung
- Kognitive Beeinträchtigung
- Wohnsituation Schweiz
- Leitprinzipien für die Begleitung von Menschen mit einer Beeinträchtigung
- Herleitung
- Selbstbestimmung
- Sozialräumliche Teilhabe
- Normalisierung
- Beeinträchtigungsbedingter Nachteilsausgleich
- Bewertung der Anforderungen an «gutes Wohnen»
- Selbstbestimmung
- Sozialräumliche Teilhabe
- Normalisierung
- Beeinträchtigungsbedingter Nachteilsausgleich
- Zusammenfassung der Bewertungen
- Schlussfolgerungen
- Erkenntnisse und Beantwortung der Fragestellungen
- Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor Thesis analysiert die Wohnsituation von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in der Schweiz. Sie befasst sich mit der Frage, wie die Anforderungen an "gutes Wohnen" im Kontext der kognitiven Beeinträchtigung erfüllt werden können und welche Rolle die Soziale Arbeit dabei spielt.
- Analyse der Anforderungen an "gutes Wohnen" für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung
- Bewertung verschiedener Wohnformen hinsichtlich ihrer Eignung und Verwirklichungschancen
- Aufzeigen von Handlungsbedarf und Lösungsansätzen für die Soziale Arbeit
- Bedeutung von Selbstbestimmung, sozialräumlicher Teilhabe und Normalisierung
- Einbezug verschiedener normativer Bezugssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Ausgangslage dar, erläutert die persönliche Motivation und das Erkenntnisinteresse. Die Relevanz für die Soziale Arbeit sowie die Eingrenzung des Themas werden ebenfalls behandelt.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel definiert den Begriff der kognitiven Beeinträchtigung und beleuchtet die Wohnsituation in der Schweiz. Es werden verschiedene Wohnformen vorgestellt und ihre Herausforderungen für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung beleuchtet.
- Kapitel 3: Es werden die Leitprinzipien für die Begleitung von Menschen mit einer Beeinträchtigung erörtert, darunter Selbstbestimmung, sozialräumliche Teilhabe, Normalisierung und der beeinträchtigungsbedingte Nachteilsausgleich.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel werden die Anforderungen an "gutes Wohnen" anhand der zuvor definierten Leitprinzipien bewertet. Die verschiedenen Wohnformen werden hinsichtlich ihrer Eignung und Verwirklichungschancen analysiert.
Schlüsselwörter
Kognitive Beeinträchtigung, Wohnen, Schweiz, Soziale Arbeit, Selbstbestimmung, sozialräumliche Teilhabe, Normalisierung, beeinträchtigungsbedingter Nachteilsausgleich, Wohnformen, Handlungsbedarf, Lösungsansätze.
- Quote paper
- Chantal Burri (Author), 2021, „Gutes Wohnen“ für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in der Schweiz. Wo besteht Handlungsbedarf für die Soziale Arbeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593926