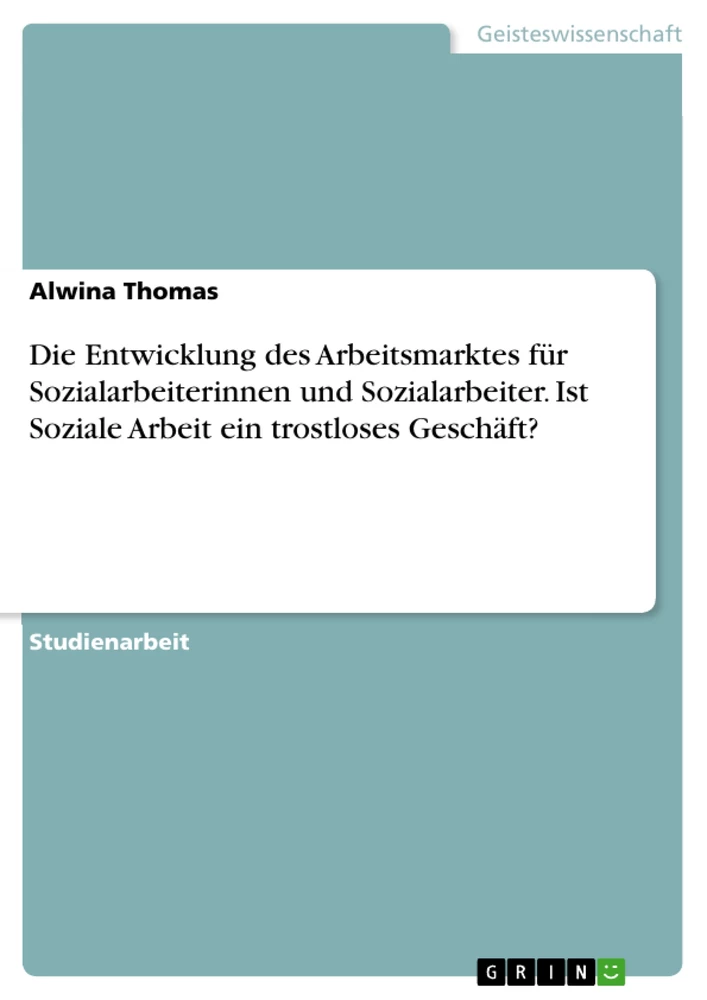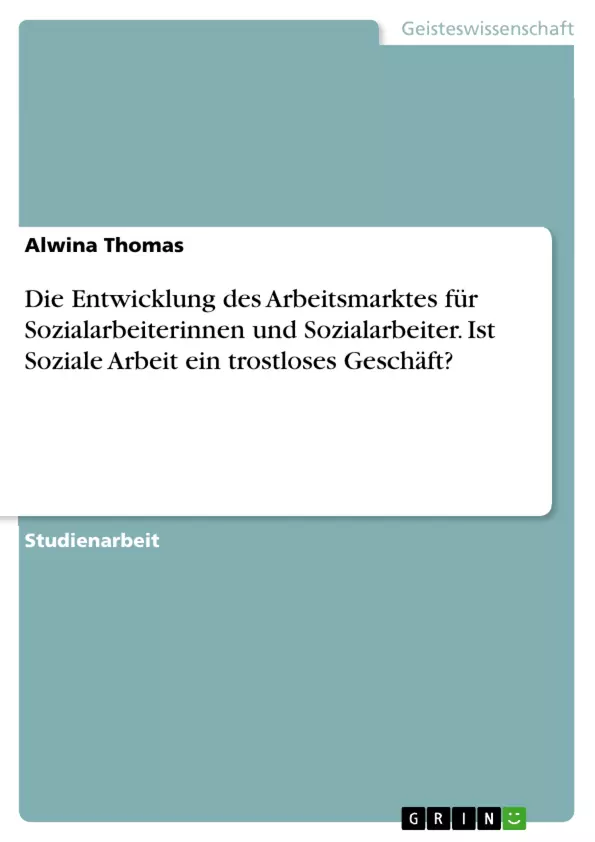Ein Sozialarbeiter wird von einem Straßenräuber überfallen.
"Geld oder Leben" schreit der Räuber.
"Tut mir leid,", antwortet der Sozialarbeiter, "als Sozialarbeiter besitze ich weder das eine noch das andere."
Soziale Arbeit: Ein trostloses Geschäft!?
1 Einleitung
Zahlreiche Menschen haben keine genaue Vorstellung darüber, was Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen eigentlich leisten. Grund dafür ist vor allem die Heterogenität der Aufgabenbereiche. So sind SozialarbeiterInnen zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe, in Schulen oder auch in der Schuldnerberatung und als Streetworker tätig. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind in Deutschland rund 276.000 Erwerbstätige mit (Fach-) Hochschulabschluss für den Studienbereich Sozialwesen als SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen beschäftigt. Im Vergleich: Im Jahr 1996 lag die Zahl bei rund 124.000. In den letzten 20 Jahren hat sich die Erwerbstätigenzahl (mit (Fach-)Hochschulabschluss) im Bereich Sozialwesen somit fast verdoppelt.
Dennoch lässt die gesellschaftliche Akzeptanz und Wertschätzung dieser Berufsgruppe zu wünschen übrig. Dies spiegelt sich in der Unwissenheit der Bevölkerung bzgl. der Aufgaben und Tätigkeiten des Arbeitsbereiches wieder. Die Bezeichnung und Berufsklasse „Sozialarbeiter“ (als gutmütiger Öko-Freak mit Jesuslatschen) ist gängig, der genaue Aufgaben- und Leistungsbereich jedoch unklar. Für die allgemeine Mehrheit erscheinen SozialarbeiterInnen entbehrlich, denn diese wirken ohnehin „nur“ in Problemzonen, in denen sie sich schließlich nicht wiederfinden. Der einhergehende Mehrwert für die gesellschaftliche Entwicklung bleibt vergessen. Als Resultat dümpeln SozialarbeiterInnen oftmals in den dunklen Tiefen des Niedriglohnsektors, der Teilzeitbeschäftigung, der befristeten Arbeitsverträge und angeblich politischer Ohnmacht als stille Helden vor sich hin. Dabei stellt sich mir die Frage: Warum mache ich das eigentlich?
Die vorliegende Arbeit soll Aufschluss über die mögliche Zukunft der Sozialen Arbeit geben. Es werden die bestehenden Chancen von SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen auf dem heutigen Arbeitsmarkt erörtert und die Veränderungen beschrieben, welcher die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Sozialen Arbeit unterworfen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist Soziale Arbeit?
- 2.1 Was bedeutet „sozial“?
- 2.2 Historische Wurzeln der sozialen Arbeit
- 2.3 Gegenstand der Sozialen Arbeit heute
- 2.4 Handlungsfelder der Sozialen Arbeit
- 3 Stand und Entwicklungen am Arbeitsmarkt
- 3.1 Arbeitgeber der Sozialen Arbeit
- 3.2 Soziale Arbeit im Wachstum
- 3.3 Soziale Arbeit im Spannungsfeld
- 3.4 Kompetenz- und Arbeitsplatzanforderungen im Sozialsektor
- 3.5 Risiken und Chancen für die Zukunft
- 4 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und beleuchtet die Chancen und Herausforderungen dieses Berufsfelds. Die Arbeit soll Aufschluss darüber geben, welche Perspektiven sich für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auf dem heutigen Arbeitsmarkt bieten und welche Veränderungen sich für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Sozialen Arbeit ergeben.
- Definition des Begriffs „Soziale Arbeit“ und seiner historischen Wurzeln
- Analyse der Handlungsfelder und Arbeitgeber der Sozialen Arbeit
- Beschreibung der aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
- Bewertung der Chancen und Risiken für die Zukunft der Sozialen Arbeit
- Reflexion der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Wertschätzung des Berufsfelds
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Problematik der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Wertschätzung der Sozialen Arbeit. Sie führt den Leser in die Thematik ein und stellt die Motivation und die Zielsetzung der Arbeit dar.
2 Was ist Soziale Arbeit?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Soziale Arbeit“ und seiner historischen Wurzeln. Es wird der Frage nachgegangen, was es bedeutet, Soziale Arbeit zu leisten und welche Bedeutung der Begriff „sozial“ in diesem Zusammenhang hat. Die historische Entwicklung der Sozialen Arbeit wird anhand von wichtigen Persönlichkeiten und Meilensteinen dargestellt, die die Strukturen und theoretischen Denkansätze der heutigen Sozialen Arbeit prägen.
3 Stand und Entwicklungen am Arbeitsmarkt
Das dritte Kapitel analysiert den aktuellen Stand und die Entwicklungen am Arbeitsmarkt für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Es werden die wichtigsten Arbeitgeber der Sozialen Arbeit vorgestellt und die aktuellen Herausforderungen und Chancen für die Berufsgruppe beleuchtet. Zudem wird das Spannungsfeld zwischen den Anforderungen des Arbeitsmarktes und den Kompetenzen der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter beleuchtet.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Arbeitsmarkt, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, gesellschaftliche Wahrnehmung, Handlungsfelder, Arbeitgeber, Entwicklungen, Chancen, Risiken, Kompetenzanforderungen, Niedriglohnsektor, Teilzeitbeschäftigung, befristete Arbeitsverträge, politische Ohnmacht, Wertschätzung, Zukunft.
- Quote paper
- Alwina Thomas (Author), 2020, Die Entwicklung des Arbeitsmarktes für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Ist Soziale Arbeit ein trostloses Geschäft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594544