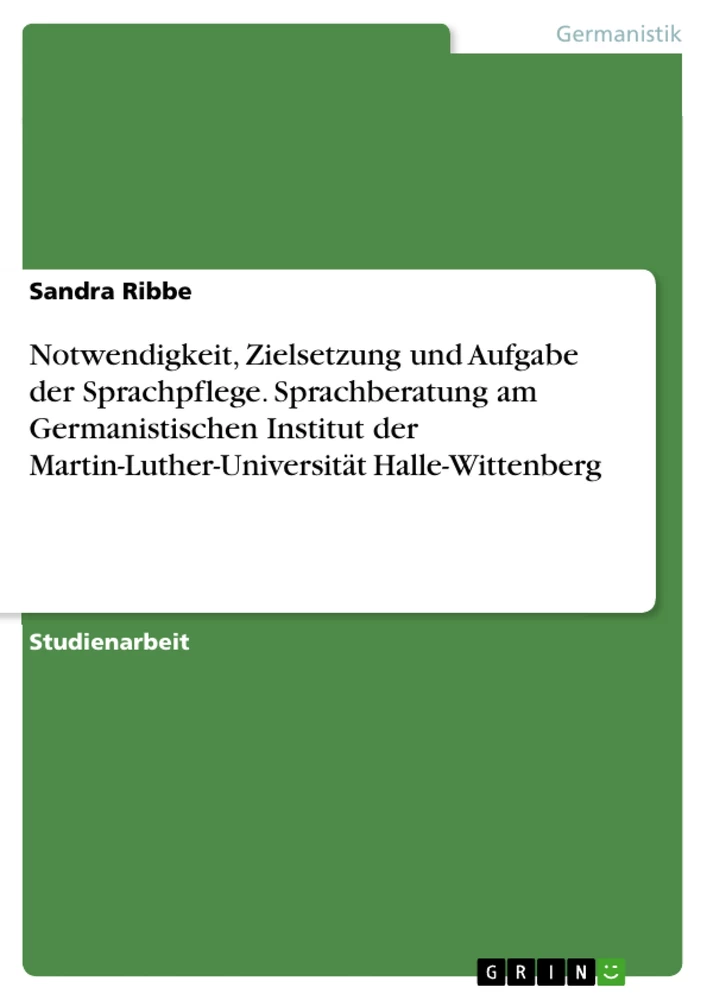In den vergangenen zehn Jahren wurde wohl kaum ein amtliches Regelwerk so oft reformiert wie die deutsche Rechtschreibung. Es wurde vielfach diskutiert und wiederholt Ergänzungen bzw. Änderungen vorgenommen, dutzende Schulbücher mussten neu gedruckt werden. Hilfe für die unsicheren und irritierten Bürger gab und gibt es bei verschiedenen Institutionen und Sprachberatungsstellen, die praktische Sprachpflege betreiben. Das Ziel meiner Hausarbeit soll sein, die Notwendigkeit, Zielsetzung und Aufgaben der gegenwärtigen Sprachpflege aufzuzeigen. Dazu wird der Begriff der Sprachpflege definiert und von den Begriffen Sprachkultur, Sprachkritik und Sprachpolitik abgegrenzt. Zusätzlich soll die Frage geklärt werden, warum (bis heute?) eine gewisse Skepsis und Sensibilität gegenüber deutscher Sprachpflege bzw. Sprachpolitik besteht und wie es dazu kam? Ich werde kurz auf die Geschichte der Sprachpflege eingehen, um die Entwicklung der sprachpflegerischen Arbeit ab dem 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart darzustellen. Im zweiten Kapitel werde ich auf Sprachberatungsstellen in Deutschland näher eingehen und deren Arbeit erläutern. Des Weiteren beschäftige ich mich in der Seminararbeit mit der Sprachberatung am germanistischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, deren Aufgaben und einigen aktuellen Beispielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachpflege
- Definition
- Geschichtlicher Überblick der Sprachpflege
- Sprachpflege im 17. Jahrhundert
- Sprachpflege im 18. und 19. Jahrhundert (bis etwa 1830)
- Sprachpflege von circa 1830 bis 1918
- Sprachpflege von 1919 bis 1945
- Sprachpflege von 1946 bis circa 1970
- Abgrenzung zu Sprachkultur, Sprachkritik und Sprachpolitik
- Praktische Sprachpflege
- Geschichte der Sprachberatungsstellen
- Was Sprachberatungen leisten
- Praktische Sprachpflege in der Sprachberatung in Halle/Saale
- Eine Auswahl aus aktuellen Anfragen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Seminararbeit ist es, die Notwendigkeit, Zielsetzung und Aufgaben der gegenwärtigen Sprachpflege aufzuzeigen. Der Begriff der Sprachpflege wird definiert und von Sprachkultur, Sprachkritik und Sprachpolitik abgegrenzt. Außerdem soll die Frage geklärt werden, warum bis heute eine gewisse Skepsis und Sensibilität gegenüber deutscher Sprachpflege bzw. Sprachpolitik besteht und wie es dazu kam.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Sprachpflege“
- Entwicklung der sprachpflegerischen Arbeit vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart
- Die Rolle von Sprachberatungsstellen in Deutschland
- Praktische Sprachpflege am Germanistischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- Aktuelle Beispiele aus der Sprachberatung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sprachpflege ein und stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Seminararbeit vor. Im ersten Kapitel wird der Begriff der Sprachpflege definiert und von verwandten Begriffen wie Sprachkultur, Sprachkritik und Sprachpolitik abgegrenzt. Außerdem wird ein historischer Überblick über die Sprachpflege vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart gegeben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Sprachberatungsstellen in Deutschland und deren Aufgaben. Die Arbeit der Sprachberatung am Germanistischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wird im Detail erläutert und anhand aktueller Beispiele veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Sprachpflege, Sprachkultur, Sprachkritik, Sprachpolitik, Sprachberatung, Sprachwandel, Sprachnorm, Sprachgeschichte, Deutsch, Germanistik, Sprachberatungsstelle, Halle/Saale
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff Sprachpflege?
Sprachpflege bezeichnet die praktische Bemühung um die Erhaltung und Förderung der Sprachqualität und -normen. Sie wird in der Arbeit von verwandten Begriffen wie Sprachkultur, Sprachkritik und Sprachpolitik abgegrenzt.
Warum ist Sprachpflege heute noch notwendig?
Durch häufige Reformen, wie die der deutschen Rechtschreibung, entstehen Unsicherheiten bei den Bürgern. Sprachberatungsstellen bieten hier praktische Hilfe und Orientierung.
Seit wann gibt es Sprachpflege in Deutschland?
Die systematische sprachpflegerische Arbeit lässt sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen und hat sich über die Jahrhunderte stetig weiterentwickelt.
Warum herrscht Skepsis gegenüber der Sprachpflege?
Die Arbeit untersucht historisch bedingte Gründe für die Sensibilität und Skepsis gegenüber staatlicher Sprachpolitik und Sprachpflege in Deutschland.
Was leistet die Sprachberatung an der Universität Halle-Wittenberg?
Die Sprachberatung am Germanistischen Institut in Halle/Saale bearbeitet aktuelle Anfragen von Bürgern zu Sprachnormen, Rechtschreibung und Sprachwandel.
- Citation du texte
- Sandra Ribbe (Auteur), 2006, Notwendigkeit, Zielsetzung und Aufgabe der Sprachpflege. Sprachberatung am Germanistischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59593