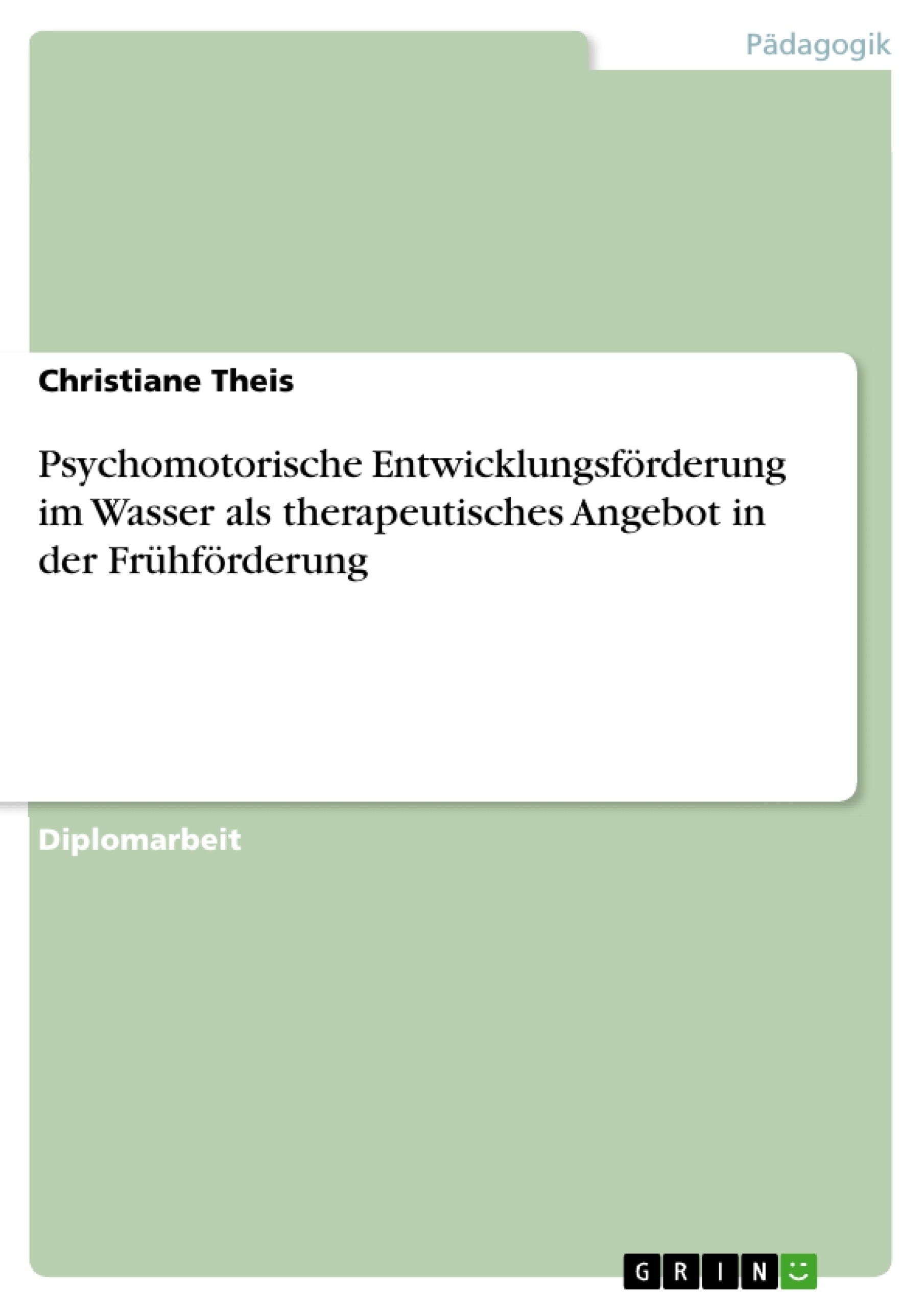Mit dieser Diplomarbeit wird ein Konzept zur psychomotorischen Entwicklungsförderung im Wasser vorgelegt, das zur Prävention und Rehabilitation in die Angebotstruktur der Frühförderung integriert werden kann. Es soll gezeigt werden, welche Chancen der Entwicklungsförderung ein solches Angebot für nahezu alle Formen und Ausprägungen von Behinderung sowie für jede Altersstufe bietet und weshalb die psychomotorische Entwicklungsförderung im Wasser verstärkt als ergänzende Maßnahme in der Frühförderung eingesetzt werden sollte. Zur Einordnung der psychomotorischen Entwicklungsförderung im Wasser in den Kontext von Frühförderung werden die Ausführungen in Kapitel 2 mit einer Beschreibung der Institution Frühförderung und der von ihr betreuten Personengruppe begonnen. In Kapitel 3 soll anschließend eine knappe Darstellung der „Meilensteine“ kindlicher Entwicklung und eventueller behinderungsspezifischer Besonderheiten die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Entwicklungsförderung verdeutlichen. Dem folgt in Kapitel 4 eine Einführung in die Psy-chomotorik, die zum Verständnis des auf die Förderung im Wasser bezogenen Teils als notwendig erachtet wird. Nach einer in Kapitel 5 gegebenen kurzen Übersicht über bereits bestehende Ansätze zur Förderung von Menschen im Wasser in kritischer Auseinandersetzung mit ihrer Eignung für die Klientel der Frühförderung, wird in Kapitel 7, angelehnt an die Prinzipien der Psychomotorik, ein Konzept der Entwicklungsförderung im Wasser unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften und deren Wirkung auf den Menschen aus-formuliert. Besonderes Augenmerk wird auf den Einbezug der Eltern gelegt, um auch kleinen Kindern und Kindern mit starken Bewegungseinschränkungen die Teilnahme zu ermöglichen und die Interaktion von Kind und Elternteil zu fördern. Die Darstellung inhaltlicher Aspekte in Kapitel 8 präzisiert die Überlegungen. In Kapitel 9 werden die erläuterten positiven Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung anhand empirischer Ergebnisse aus anderen Förderangeboten im Wasser belegt. Zuletzt werden in Kapitel 10 Grenzen der Möglichkeiten psy-chomotorischer Entwicklungsförderung im Wasser aufgezeigt und in Kapitel 11 das vorliegende Konzept in die Angebotsstruktur der Frühförderung integriert. [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG.
- THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER FRÜHFÖRDERUNG.
- BEGRIFFSKLÄRUNG..
- AUFGABEN UND ZIELE DER FRÜHFÖRDERUNG.
- FACHLICHE STANDARDS DER FRÜHFÖRDERUNG.
- GANZHEITLICHKEIT.
- FAMILIENORIENTIERUNG
- DIE ÖKOLOGISCH-SYSTEMISCHE PERSPEKTIVE DER ENTWICKLUNG NACH BRONFENBRENNER.
- INTERDISZIPLINARITÄT.
- SOZIALE INTEGRATION
- VERNETZUNG
- DIE BERUFSGRUPPEN IN DER FRÜHFÖRDERUNG.
- BEHINDERUNGSBILDER IN DER FRÜHFÖRDERUNG..
- TRISOMIE 21
- INFANTILE CEREBRALPARESE..
- DIE ENTWICKLUNG VOM NEUGEBORENEN- BIS ZUM VORSCHULALTER
- DIE ENTWICKLUNG DER WAHRNEHMUNG.
- DIE MOTORISCHE ENTWICKLUNG.
- DIE KOGNITIVE ENTWICKLUNG NACH JEAN PIAGET
- DIE SENSOMOTORISCHE PERIODE
- VOROPERATORISCHES ANSCHAULICHES DENKEN..
- DIE SOZIAL-EMOTIONALE ENTWICKLUNG....
- PSYCHOMOTORISCHE ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG..
- ENTSTEHUNG DER PSYCHOMOTORIK IN DEUTSCHLAND.
- DAS MENSCHENBILD DER PSYCHOMOTORIK.
- ZIELE UND INHALTE DER PSYCHOMOTORIK
- KOMPETENZERWEITERUNG DURCH PSYCHOMOTORIK
- ICH-KOMPETENZ.
- SACH-KOMPETENZ.
- SOZIAL-KOMPETENZ.
- DIE BEDEUTUNG DES SELBSTKONZEPTES FÜR DIE ENTWICKLUNG.
- BEGRIFFSKLÄRUNG..
- SICH SELBST ERFÜLLENDE PROPHEZEIUNGEN.
- DIE SÄULEN DES SELBSTKONZEPTES..
- DAS KONZEPT DER ERLERNTEN HILFLOSIGKEIT NACH SELIGMAN...
- ABBAU EINES NEGATIVEN SELBSTKONZEPTES.
- DIE BEDEUTUNG DES SELBSTKONZEPTES FÜR DIE PSYCHOMOTORISCHE FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER ODER VON BEHINDERUNG BEDROHTER KINDER.......
- DIE EINHEIT VON WAHRNEHMUNG UND BEWEGUNG
- DIE PROFILIERUNG DES BEGRIFFES „ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG“ FÜR DIE PSYCHOMOTORIK IN DER FRÜHFÖRDERUNG
- ANGEBOTE DER FÖRDERUNG IM WASSER
- AKTIVE WASSERTHERAPIE NACH INNENMOSER...
- DIE HALLIWICK-METHODE NACH MCMILLAN
- DIE MOTORISCHE FRÜHSTIMULATION DURCH SÄUGLINGS- UND KLEINKINDERSCHWIMMEN…………………………………………
- PSYCHOMOTORISCHE FRÜHFÖRDERUNG IM WASSER NACH CHEREK..
- PSYCHOMOTORISCHE ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG IM WASSER...
- DIE BESONDEREN EIGENSCHAFTEN DES MEDIUMS WASSER UND IHRE AUSWIRKUNG AUF KÖRPERREAKTIONEN, WAHRNEHMUNG UND BEWEGUNGSMÖGLICHKEITEN.........
- WASSERTEMPERATUR
- WASSERWIDERSTAND..
- WASSERDRUCK
- AUFTRIEB
- OPTISCHE REIZE.
- AKUSTISCHE REIZE.
- OLFAKTORISCHE REIZE.
- EMOTIONALE ERLEBNISQUALITÄTEN IM WASSER..
- ZUM BEGRIFF DER EMOTION...
- POSITIVE UND NEGATIVE EMOTIONEN IM WASSER
- KONZEPTIONELLE ÜBERLEGUNGEN.
- ÄUBERER RAHMEN
- ART UND DAUER DES ANGEBOTES..
- GRUPPENGRÖßE UND -ZUSAMMENSETZUNG.
- PERSONELLE STANDARDS.
- FINANZIERUNG DES ANGEBOTES
- DIDAKTISCH-METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN.
- ALTERSBEGRENZUNGEN FÜR DIE PSYCHOMOTORISCHE ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG IM WASSER IN DER FRÜHFÖRDERUNG
- INHALTLICHE ÜBERLEGUNGEN ZUR PSYCHOMOTORISCHEN ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG IM WASSER
- WASSERGEWÖHNUNG
- RITUALE BEI DER PSYCHOMOTORISCHEN ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG IM WASSER....
- TAKTILE, VESTIBULÄRE UND KINÄSTHETISCHE STIMULATION DURCH SCHWUNGÜBUNGEN IM WASSER......
- GESTALTUNG VON BEWEGUNGSANLÄSSEN ANHAND VON MATERIALIEN..
- SOZIALE ERFAHRUNGEN IM WASSER..
- ELTERN-KIND-INTERAKTION IM WASSER
- SOZIALE ERFAHRUNGEN IM KONTAKT MIT ANDEREN KINDERN.
- DER EINSATZ VON SCHWIMMHILFEN
- DIE ROLLE DES PSYCHOMOTORIKERS.
- VERÄNDERUNGEN BEI KINDERN IN DER PSYCHOMOTORISCHEN ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG IM WASSER.
- GRENZEN DER PSYCHOMOTORISCHEN ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG IM WASSER FÜR KINDER MIT BEHINDERUNG
- INTEGRATION DER PSYCHOMOTORISCHEN ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG IM WASSER IN DIE FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER UND VON BEHINDERUNG BEDROHTER KINDER.
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der psychomotorischen Entwicklungsförderung im Wasser als therapeutisches Angebot in der Frühförderung. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Frühförderung, analysiert die Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum Vorschulalter und untersucht die Bedeutung der Psychomotorik für die Entwicklung von Kompetenzen und des Selbstkonzepts. Im Fokus steht die spezielle Anwendung psychomotorischer Förderung im Wasser, wobei die besonderen Eigenschaften des Mediums Wasser und deren Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes im Vordergrund stehen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Angebote der Förderung im Wasser, analysiert konzeptionelle Überlegungen und stellt didaktisch-methodische Überlegungen zur Gestaltung von Förderstunden im Wasser vor.
- Theoretische Grundlagen der Frühförderung
- Psychomotorische Entwicklungsförderung und ihre Bedeutung
- Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum Vorschulalter
- Besondere Eigenschaften des Mediums Wasser und deren Auswirkungen auf die Entwicklung
- Didaktisch-methodische Überlegungen zur Gestaltung von Förderstunden im Wasser
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der psychomotorischen Entwicklungsförderung im Wasser als therapeutisches Angebot in der Frühförderung ein und gibt einen Überblick über die Inhalte der Arbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Frühförderung. Es definiert den Begriff der Frühförderung, erläutert die Aufgaben und Ziele und behandelt verschiedene fachliche Standards wie Ganzheitlichkeit, Familienorientierung, Interdisziplinarität, soziale Integration und Vernetzung. Das dritte Kapitel analysiert die Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum Vorschulalter, wobei die Entwicklung der Wahrnehmung, die motorische Entwicklung, die kognitive Entwicklung nach Jean Piaget sowie die sozial-emotionale Entwicklung im Fokus stehen. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der psychomotorischen Entwicklungsförderung, ihrer Entstehung in Deutschland, dem Menschenbild der Psychomotorik sowie den Zielen und Inhalten. Des Weiteren werden Kompetenzerweiterung durch Psychomotorik, die Bedeutung des Selbstkonzepts und die Einheit von Wahrnehmung und Bewegung thematisiert.
Kapitel fünf stellt verschiedene Angebote der Förderung im Wasser vor, wie die aktive Wassertherapie nach Innenmoser, die Halliwick-Methode nach McMillan, die motorische Frühstimulation durch Säuglings- und Kleinkinderschwimmen sowie die psychomotorische Frühförderung im Wasser nach Cherek. Das sechste Kapitel untersucht die besonderen Eigenschaften des Mediums Wasser und ihre Auswirkungen auf Körperreaktionen, Wahrnehmung und Bewegungsmöglichkeiten, wobei die Wasserttemperatur, der Wasserwiderstand, der Wasser druck, der Auftrieb sowie optische, akustische und olfaktorische Reize im Fokus stehen.
Kapitel sieben behandelt konzeptionelle Überlegungen zur psychomotorischen Entwicklungsförderung im Wasser, wie den äußeren Rahmen, die Art und Dauer des Angebots, die Gruppengröße und -zusammensetzung, die personellen Standards, die Finanzierung, didaktisch-methodische Überlegungen und Altersbegrenzungen.
Schlüsselwörter
Psychomotorische Entwicklungsförderung, Frühförderung, Wassertherapie, Bewegung, Wahrnehmung, Entwicklung, Selbstkonzept, Kompetenzen, Integration, Behinderung, Familienorientierung, Interdisziplinarität, Medium Wasser.
- Citation du texte
- Diplom - Heilpädagogin Christiane Theis (Auteur), 2005, Psychomotorische Entwicklungsförderung im Wasser als therapeutisches Angebot in der Frühförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59767