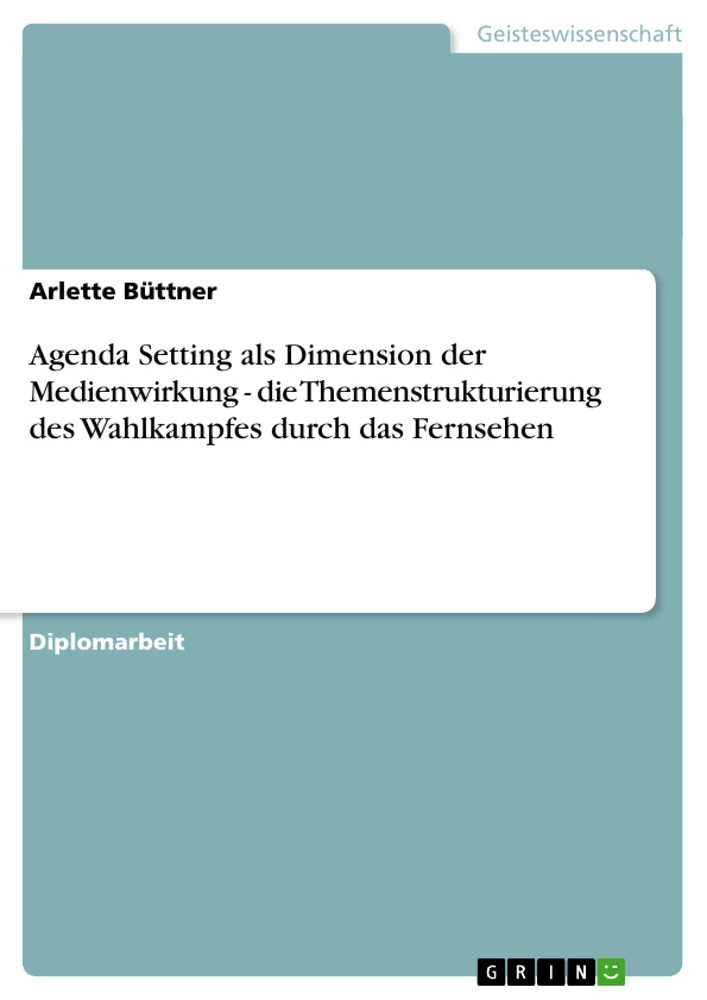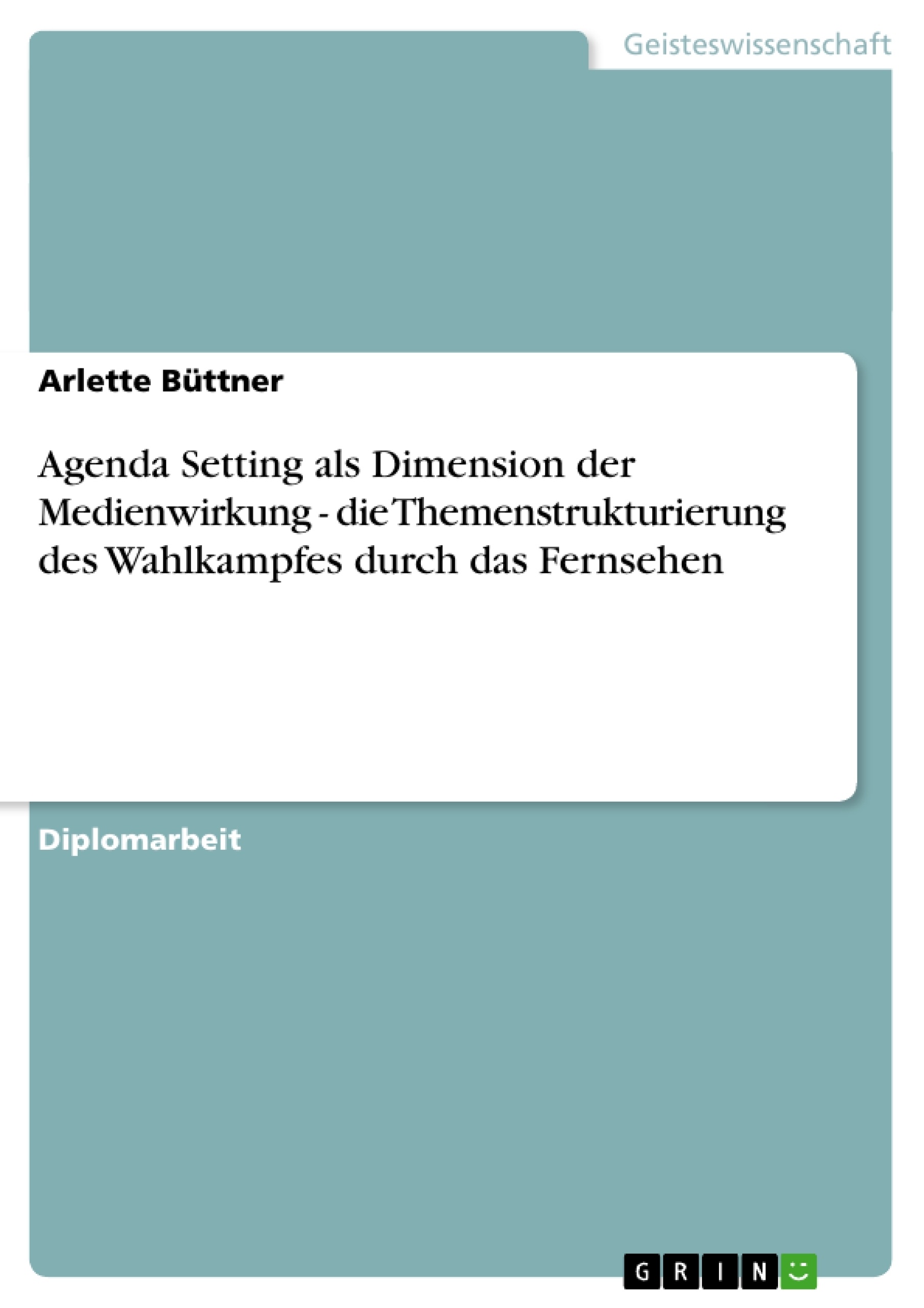„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien“. Diese schlichte Feststellung des Systemtheoretikers Niklas Luhmann bringt es auf den Punkt: um sich ein Bild über unsere Umwelt zu machen, um informiert zu sein, sind wir in unserer modernen Welt mehr denn je auf die Massenmedien angewiesen. Damit kommt den Medien eine besondere Verantwortung gegenüber ihren Nutzern zu. Hierfür sind sie auf die Vermittlungsleistung durch Massenmedien angewiesen, was neben der Verantwortung sowie der Kontrollfunktion, die den Medien zugeschrieben wird, auch eine nicht zu unterschätzende Machtfülle beinhaltet. In Deutschland werden die Medien immer wieder als ‚vierte Gewalt’ tituliert, und der Anteil, den sie am täglichen Leben haben, untermauert diese Vermutung: durchschnittlich 600 Minuten pro Tag konsumieren Erwachsene ab 14 Jahren Massenmedien, wovon 220 Minuten auf das Fernsehen entfallen, jedoch nur 28 Minuten auf die Tageszeitung. Die Vermutung, dass ein Großteil der Bevölkerung sich über das Fernsehen informiert, liegt nahe und war einer der Ausgangspunkte für diese Arbeit. Von besonderem Interesse für mich ist die Frage, inwieweit das Fernsehen bei Bundestagswahlen nicht nur eine informierende und strukturierende Funktion innehat, sondern ob das Fernsehen, wie manchmal vermutet wird, Wahlen (mit-)entscheiden kann. Können sich die Bürger darauf verlassen, alle relevanten Informationen, die sie zur Bildung einer Meinung benötigen, von den Medien zur Verfügung gestellt zu bekommen?
„Darf man den Medien trauen?“, fragte die renommierte Wochenzeitung ‚Die Zeit’ im Januar 2006. Diese Frage stellt einen weiteren Ansatzpunkt der Arbeit dar. Wir sind in unserer Meinungsbildung abhängig davon, was wir wissen, und was wir wissen, erfahren wir durch die Massenmedien. Diese haben also eindeutig eine Wirkung auf unsere Meinungen, Einstellungen und unser Verhalten. Doch wie sieht diese Wirkung aus? Sind wir überhaupt in der Lage, die Mechanismen der Medienproduktion so weit zu durchschauen, dass wir mit ausreichendem Misstrauen an die uns dargebotenen Informationen herangehen? Und – spielt all das überhaupt eine Rolle, wenn wir schließlich zur Wahlurne schreiten? Wie kommt die Wahlentscheidung zustande und welchen Anteil haben die Medien, insbesondere das Fernsehen, an dieser Entscheidung? Diese Frage steht im Mittelpunkt der nachfolgenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung und Erkenntnisinteresse
- Das Forschungsfeld der Medienwirkung
- Grundlagen und begriffliche Klärung des Wirkungsbegriffes
- Ausgangspunkt und Entwicklung der Medienwirkungsforschung
- Hauptparadigmen der Medienwirkungsforschung
- Persuasionsforschung / Überredungskommunikation
- Theorie der kognitiven Dissonanz / Verstärkerhypothese
- Agenda-Setting-Hypothese
- Schweigespiraltheorie
- Die Agenda-Setting Funktion der Massenmedien
- Das ursprüngliche Modell des Agenda-Setting
- Zentrale Begriffe und Variable des Modells
- Der Begriff des „Themas“
- Die,,Wichtigkeit\" des Themas
- Intervenierende Variable und Randbedingungen
- Medienbezogene Variable
- Publikumsbezogene Variable
- Der Faktor Zeit und Themenkarrieren
- Wirkungsmodelle und Effektebenen
- Das Awareness- bzw. Aufmerksamkeitsmodell
- Das Salience-Modell
- Das Prioritäten-Modell
- Weiterentwicklung – Agenda Building und Second-Level Agenda-Setting
- Die Bundestagswahlkämpfe 2002 und 2005 im Vergleich – warum das Fernsehen im Wahlkampf so wichtig ist
- Zur Einführung - ein Überblick über moderne Wahlkampfführung
- Die Bundestagswahlen 2002 und 2005 im systematischen Vergleich
- Politische Situation und Stimmungen
- Das Themenmanagement der Regierung
- Das Themenmanagement der Opposition
- Die Agenda der Wähler
- Die Agenda des Fernsehens
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Fernsehens als Agenda-Setter im Kontext von Bundestagswahlkämpfen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit das Fernsehen die Themen des Wahlkampfes beeinflusst und somit mitbestimmt, worüber in der öffentlichen Diskussion gesprochen wird.
- Die Bedeutung von Medienwirkungen in der modernen Gesellschaft
- Die Agenda-Setting-Hypothese als Modell zur Erklärung der Medienwirkung
- Die Rolle des Fernsehens im Wahlkampfprozess
- Ein Vergleich der Bundestagswahlkämpfe 2002 und 2005
- Die Frage nach der Manipulierbarkeit und dem Einfluss des Fernsehens auf die Wähler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Erkenntnisinteresse und stellt die Relevanz der Medienwirkung im Kontext der modernen Gesellschaft dar. Anschließend werden die Grundlagen der Medienwirkungsforschung beleuchtet, wobei der Fokus auf dem Wirkungsbegriff und der Entwicklung verschiedener Paradigmen liegt.
Im dritten Kapitel wird die Agenda-Setting-Hypothese als zentrales Modell zur Erklärung der Medienwirkung vorgestellt. Hierbei werden sowohl das ursprüngliche Modell als auch zentrale Begriffe und Variable erläutert, sowie die verschiedenen Wirkungsmodelle und Effektebenen besprochen.
Das vierte Kapitel widmet sich der Analyse der Bundestagswahlkämpfe 2002 und 2005. Hierbei werden die politische Situation, das Themenmanagement der Regierung und der Opposition sowie die Agenda der Wähler und des Fernsehens im Vergleich betrachtet.
Schlüsselwörter
Medienwirkung, Agenda-Setting, Fernsehen, Wahlkampf, Bundestagswahl, Themenmanagement, politische Kommunikation, Medienmanipulation, öffentliche Meinung.
Häufig gestellte Fragen zu Agenda Setting und Fernsehen
Was besagt die Agenda-Setting-Hypothese?
Medien geben nicht vor, WAS wir denken sollen, aber sie bestimmen sehr erfolgreich, WORÜBER wir nachdenken sollen.
Welchen Einfluss hat das Fernsehen auf Bundestagswahlen?
Das Fernsehen strukturiert die Themen des Wahlkampfes und beeinflusst dadurch, welche politischen Probleme die Wähler als am wichtigsten wahrnehmen.
Was ist der Unterschied zwischen Salience- und Prioritäten-Modell?
Das Salience-Modell beschreibt die gefühlte Wichtigkeit eines Themas, während das Prioritäten-Modell die Rangfolge der Themen im Bewusstsein analysiert.
Wie unterschieden sich die Wahlkämpfe 2002 und 2005?
Die Arbeit vergleicht das Themenmanagement von Regierung und Opposition sowie die Übereinstimmung der Medien-Agenda mit der Wähler-Agenda in diesen Jahren.
Warum werden Medien oft als "vierte Gewalt" bezeichnet?
Wegen ihrer enormen Machtfülle bei der Informationsvermittlung und ihrer Kontrollfunktion gegenüber der Politik.
- Arbeit zitieren
- Arlette Büttner (Autor:in), 2006, Agenda Setting als Dimension der Medienwirkung - die Themenstrukturierung des Wahlkampfes durch das Fernsehen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59906