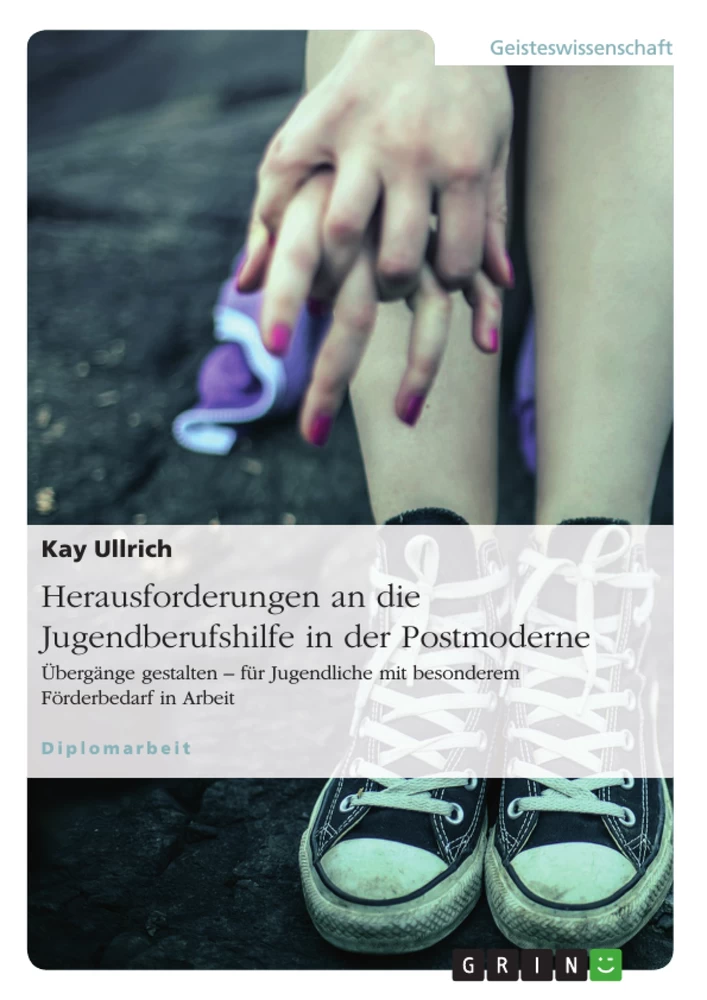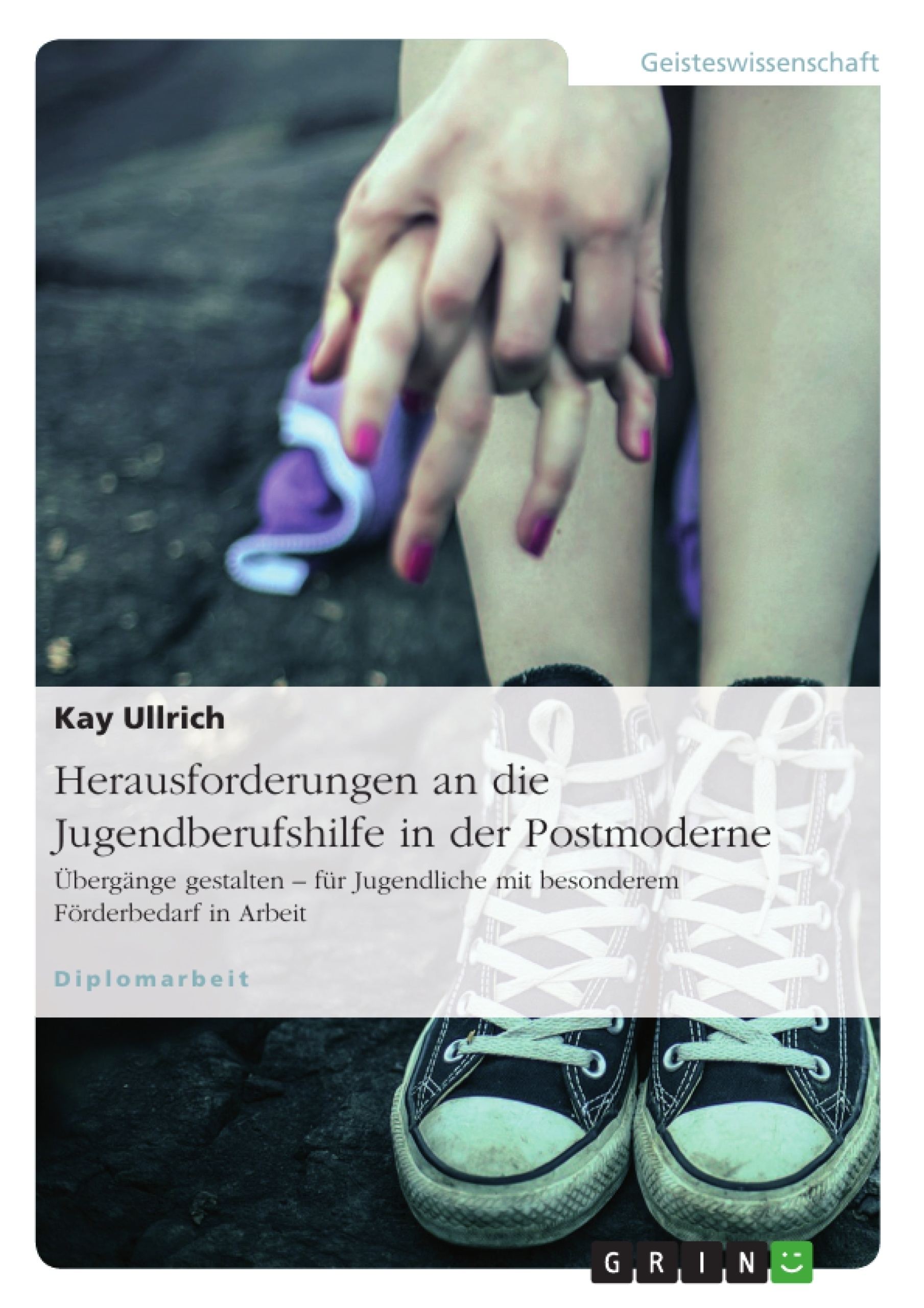Seit den 1970er Jahren sind, als Folge von wechselnden demographischen Entwicklungen, konjunkturellen Schwankungen sowie der ansteigenden Automatisierung und Flexibilisierung von Arbeit, zunehmend Schwierigkeiten Jugendlicher beim Eintritt in die Erwerbsarbeit zu beobachten. Im Ringen um die Teilhabe an dem kostbar gewordenen Gut der Erwerbsarbeit steigen die Qualifikationsansprüche an die Bewerber. Von dieser Entwicklung ist die Gruppe der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf außerordentlich betroffen. Aufgrund verschiedenster individueller aber auch gesellschaftlicher Determinanten, rücken sie in der Warteschlange vor den Toren der Erwerbsarbeit immer weiter nach hinten.
Die vorliegende Arbeit betrachtet die Situation der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf an der sogenannten ersten Schwelle.
Wie kann für möglichst viele der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf eine Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt erreicht werden und was geschieht mit denen, die kurz oder auch langfristig nicht in diesen Markt integriert werden können?
Zunächst bemüht sich die vorliegende Arbeit um die Klärung des Benachteiligtenbegriffs innerhalb der Jugendberufshilfe. Im Anschluss erfolgt die Betrachtung der Thematik der Berufsvorbereitung während der Schulzeit. Weiterhin werden die Entwicklungsaufgaben für das Jugendalter betrachtet. Diese Sichtweise wird im Folgenden um die gesellschaftliche Perspektive erweitert. Die leitende Fragestellung ist die, nach dem Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen in der Postmoderne und den sich hieraus ergebenden Konsequenzen für die Zielgruppe dieser Arbeit. Nicht zuletzt werden Aspekte der Jugendarbeitslosigkeit thematisiert. Nach einer Betrachtung der strukturellen Bedingungen des Arbeitsmarktes, rückt das System der Jugendberufshilfe in den Blickpunkt. Ziel ist es hier, einen Einblick in die derzeitigen Förderstrukturen zu geben. Letztendlich stellt sich die Frage nach der Position der Sozialen Arbeit im Handlungsfeld der Jugendberufshilfe. Das Konzept der Lebensweltorientierung wird in seinen Ansätzen vorgestellt und seine Relevanz für die Praxis diskutiert. Ein Exkurs greift das Thema der Netzwerkarbeit auf. Abschließend werden die Themen „Lebensbewältigung als zusätzlicher Inhalt der Jugendberufshilfe“, „Möglichkeiten alternativer Beschäftigung“ und die „Duale Ausbildung“ als Herausforderungen für die Jugendberufshilfe in der Postmoderne dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Der Benachteiligtenbegriff
- Der Begriff der Behinderung
- Benachteiligte Jugendliche oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf?
- Zielgruppe
- Schule als berufsvorbereitende Instanz?
- Das Konzept der Ganztagsschule
- Zum Verhältnis von Schul- und Beschäftigungssystem
- Entwicklungsaufgaben in der Jugend
- Postmoderne und der Begriff der Arbeit
- Postmoderne - Versuch einer Konkretisierung
- Zeichen der Zeit
- Individualisierung und Pluralisierung
- Auswirkungen von Individualisierung und Pluralisierung für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf
- Der Begriff der Arbeit
- Bedeutung von Erwerbsarbeit
- Erwerbsarbeit im Wandel und die Folgen für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf
- Erwerbsarbeit aus der Sicht von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf
- Arbeitsorientierung und Arbeitserfahrung
- Belastende Erwerbssituationen und mögliche Bewältigungsstrategien
- Jugendarbeitslosigkeit
- Folgen von Erwerbslosigkeit für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf
- Kreislauf der Jugendarbeitslosigkeit
- Postmoderne - Versuch einer Konkretisierung
- Das System der Jugendberufshilfe
- Trägerstrukturen innerhalb der Jugendberufshilfe
- Jugendberufshilfe – Versuch einer Konkretisierung
- Förderstrukturen der Bundesagentur für Arbeit
- Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit
- Orientierung: Berufsausbildungsvorbereitende Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit seit 1996
- Berufsausbildungsvorbereitung in der Neuen Förderstruktur
- Wesentliche Änderungen im neuen Fachkonzept
- Konzept der Lebensweltorientierung innerhalb der Jugendberufshilfe
- Dimensionen von lebensweltorientierter Arbeit
- Handlungsmaximen eines lebensweltorientierten Konzepts in der Jugendberufshilfe
- Arbeitsorientierung versus Lebensweltorientierung
- Exkurs: Netzwerkarbeit
- Schlussfolgerungen
- Ohne Ausbildung und Vollzeitbeschäftigung. Lebensbewältigung als Inhalt der Jugendberufshilfe
- Jugendliche mit besonderem Förderbedarf in Arbeit. Möglichkeiten alternativer Beschäftigungsformen
- Duale Ausbildung für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Jugendberufshilfe bei der Integration von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf in den Arbeitsmarkt im Kontext der Postmoderne. Ziel ist es, die spezifischen Schwierigkeiten dieser Zielgruppe zu beleuchten und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Der Einfluss der Postmoderne auf den Arbeitsmarkt und die Bedeutung von Individualisierung und Pluralisierung.
- Die Rolle der Schule und der Jugendberufshilfe bei der Berufsvorbereitung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf.
- Die Bedeutung von lebensweltorientierten Ansätzen in der Jugendberufshilfe.
- Herausforderungen und Bewältigungsstrategien im Zusammenhang mit Jugendarbeitslosigkeit.
- Alternative Beschäftigungsformen für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und skizziert die Bedeutung der Integration von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf in den Arbeitsmarkt. Sie stellt die Forschungsfrage und die methodischen Vorgehensweisen dar, die im Verlauf der Arbeit angewendet werden.
Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit, wie "Benachteiligung," "Behinderung" und "besonderer Förderbedarf." Es differenziert zwischen diesen Begriffen und definiert die Zielgruppe der Untersuchung. Die Abgrenzung der Begriffe ist essentiell für ein präzises Verständnis der nachfolgenden Analysen und ermöglicht eine fokussierte Auseinandersetzung mit den spezifischen Herausforderungen der Zielgruppe.
Schule als berufsvorbereitende Instanz?: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Schule in der Berufsvorbereitung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Es analysiert das Konzept der Ganztagsschule und beleuchtet das Verhältnis zwischen Schul- und Beschäftigungssystem. Die kritische Auseinandersetzung mit der Schulstruktur in Bezug auf die individuellen Bedürfnisse der Zielgruppe ist zentral für das Verständnis der Notwendigkeit von zusätzlicher Unterstützung durch die Jugendberufshilfe.
Entwicklungsaufgaben in der Jugend: Das Kapitel beschreibt die zentralen Entwicklungsaufgaben Jugendlicher und wie diese im Kontext von besonderem Förderbedarf beeinflusst werden. Es beleuchtet die Herausforderungen, die aus diesen Entwicklungsaufgaben resultieren und welche besonderen Bedürfnisse zu berücksichtigen sind. Diese Betrachtung ist wichtig, um den komplexen Hintergrund der Jugendarbeitslosigkeit und des Übergangs ins Berufsleben zu verstehen.
Postmoderne und der Begriff der Arbeit: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss der Postmoderne auf den Arbeitsmarkt und den Begriff der Arbeit selbst. Es untersucht die Auswirkungen von Individualisierung und Pluralisierung auf Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Die tiefgreifenden Veränderungen des Arbeitsmarktes und die zunehmende Unsicherheit werden als entscheidende Faktoren für die Schwierigkeiten der Integration dieser Jugendlichen betrachtet. Der Wandel des Arbeitsmarktes und seine Folgen für die Zielgruppe werden detailliert untersucht.
Das System der Jugendberufshilfe: Dieses Kapitel beschreibt das System der Jugendberufshilfe, seine Trägerstrukturen, Fördermöglichkeiten und Maßnahmen. Der Fokus liegt auf der Bundesagentur für Arbeit und ihren Programmen zur beruflichen Integration. Es beleuchtet die Entwicklung der Förderstrukturen und deren Anpassung an die Bedürfnisse der Zielgruppe. Die Beschreibung der Förderstrukturen bietet einen Rahmen, um die Effektivität der Jugendberufshilfe zu bewerten.
Konzept der Lebensweltorientierung innerhalb der Jugendberufshilfe: Das Kapitel untersucht den Ansatz der Lebensweltorientierung in der Jugendberufshilfe. Es beschreibt die Dimensionen dieser Arbeit und die Handlungsmaximen eines solchen Konzepts. Es vergleicht die Lebensweltorientierung mit traditionellen Arbeitsorientierungsmodellen und untersucht deren jeweilige Vor- und Nachteile im Kontext der Integration von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Die Gegenüberstellung verschiedener Konzepte hilft zu verstehen, welche Ansätze für die Integration am effektivsten sind.
Exkurs: Netzwerkarbeit: Dieser Exkurs beleuchtet die Bedeutung von Netzwerkarbeit in der Jugendberufshilfe. Er analysiert die Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit verschiedener Akteure und institutioneller Partner. Die Bedeutung interinstitutioneller Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Integration wird hervorgehoben und die Notwendigkeit einer engen Vernetzung von Schule, Jugendberufshilfe und Arbeitgebern aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, Jugendberufshilfe, Postmoderne, Arbeitsmarkt, Integration, Lebensweltorientierung, Netzwerkarbeit, Jugendarbeitslosigkeit, Berufsausbildung, Individualisierung, Pluralisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Integration von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf in den Arbeitsmarkt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Jugendberufshilfe bei der Integration von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf in den Arbeitsmarkt im Kontext der Postmoderne. Sie beleuchtet die spezifischen Schwierigkeiten dieser Zielgruppe und zeigt mögliche Lösungsansätze auf.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Einfluss der Postmoderne auf den Arbeitsmarkt und die Bedeutung von Individualisierung und Pluralisierung; die Rolle der Schule und der Jugendberufshilfe bei der Berufsvorbereitung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf; die Bedeutung von lebensweltorientierten Ansätzen in der Jugendberufshilfe; Herausforderungen und Bewältigungsstrategien im Zusammenhang mit Jugendarbeitslosigkeit; und alternative Beschäftigungsformen für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung (Benachteiligung, Behinderung, Förderbedarf, Zielgruppe), Schule als berufsvorbereitende Instanz (Ganztagsschule, Verhältnis Schul- und Beschäftigungssystem), Entwicklungsaufgaben in der Jugend, Postmoderne und der Begriff der Arbeit (Individualisierung, Pluralisierung, Erwerbsarbeit, Jugendarbeitslosigkeit), Das System der Jugendberufshilfe (Trägerstrukturen, Förderstrukturen der BA, Maßnahmen der BA, Berufsausbildungsvorbereitende Maßnahmen), Konzept der Lebensweltorientierung in der Jugendberufshilfe, Exkurs: Netzwerkarbeit, Schlussfolgerungen (alternative Beschäftigungsformen, duale Ausbildung) und Schlusswort.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit klärt zentrale Begriffe wie "Benachteiligung," "Behinderung" und "besonderer Förderbedarf". Es wird zwischen diesen Begriffen differenziert und die Zielgruppe der Untersuchung präzise definiert.
Welche Rolle spielt die Schule?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Schule in der Berufsvorbereitung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf, das Konzept der Ganztagsschule und das Verhältnis zwischen Schul- und Beschäftigungssystem.
Wie wirkt sich die Postmoderne auf den Arbeitsmarkt aus?
Die Arbeit analysiert den Einfluss der Postmoderne, insbesondere Individualisierung und Pluralisierung, auf den Arbeitsmarkt und die daraus resultierenden Herausforderungen für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf.
Was ist das System der Jugendberufshilfe?
Die Arbeit beschreibt das System der Jugendberufshilfe, seine Trägerstrukturen, Fördermöglichkeiten und Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA), einschliesslich der berufsausbildungsvorbereitenden Maßnahmen.
Was ist Lebensweltorientierung in der Jugendberufshilfe?
Die Arbeit untersucht das Konzept der Lebensweltorientierung, ihre Dimensionen und Handlungsmaximen, und vergleicht sie mit traditionellen Arbeitsorientierungsmodellen.
Welche Rolle spielt Netzwerkarbeit?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Netzwerkarbeit in der Jugendberufshilfe und die Zusammenarbeit verschiedener Akteure (Schule, Jugendberufshilfe, Arbeitgeber).
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen befassen sich mit Lebensbewältigung als Inhalt der Jugendberufshilfe, Möglichkeiten alternativer Beschäftigungsformen und dualer Ausbildung für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, Jugendberufshilfe, Postmoderne, Arbeitsmarkt, Integration, Lebensweltorientierung, Netzwerkarbeit, Jugendarbeitslosigkeit, Berufsausbildung, Individualisierung, Pluralisierung.
- Quote paper
- Kay Ullrich (Author), 2006, Herausforderungen an die Jugendberufshilfe in der Postmoderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59945