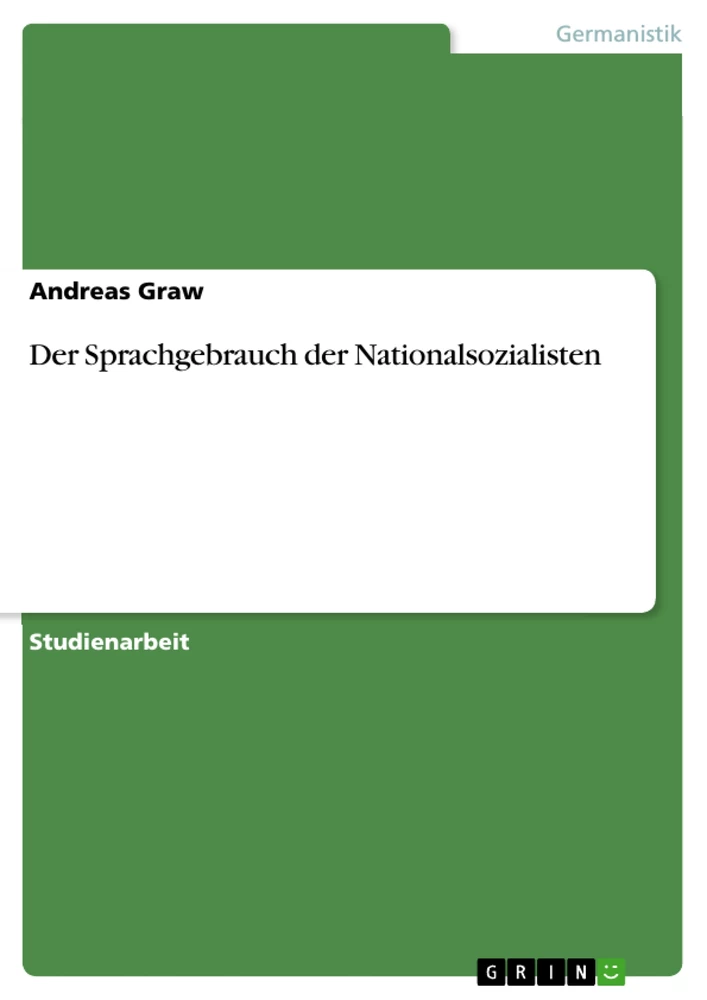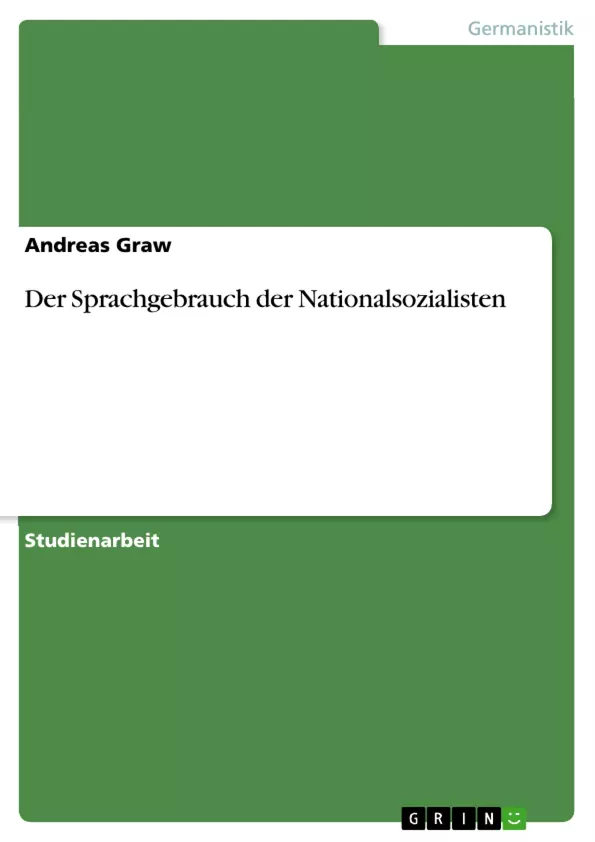Kurt Lenk bezeichnet das nationalsozialistische Regime als „Ausdrucksideologie“. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie kein in sich geschlossenes Gebilde darstellt, sondern aus einem Gemenge verschiedener anderer Ideologien besteht. Das wichtigste Mittel dieser Ausdrucksideologien ist das Schwarz-Weiß-Denken, hier sind wir, die Guten, und auf der anderen Seite ist der Feind.1 Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem wichtigsten Mittel der Ausdrucksideologie, nämlich mit der Sprache.
Zunächst wird die politische Sprache genauer betrachtet. Eine klare Trennung des Politischen vom Privaten ist zwar nicht möglich. Denn die Politik wurde durch die gleichgeschalteten Massenmedien in jedes Wohnzimmer transportiert. Es soll hier jedoch unterschieden werden zwischen der direkten Einwirkung auf den Alltag der Menschen und der indirekten Einflussnahme durch politische Rhetorik in Reden oder etwa auf Wahlplakaten.
In einem letzten Schritt soll schließlich geklärt werden, ob sich 1945 mit dem Ende der NS-Herrschaft die deutsche Sprache geändert hat, oder ob es vielleicht Kontinuitäten gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die politische Sprache der Nationalsozialisten
- Semantik
- Superlativ
- Adjektiv-Attribute
- Sprachliche Einwirkung auf den Alltag
- Plakate, Zeitungsanzeigen und Anordnungen
- Sprachregelung im Pressewesen
- Neuwörter und „verordneter“ Bedeutungswandel
- 1945: Bruch oder Kontinuität in der deutschen Sprache?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert den Sprachgebrauch der Nationalsozialisten und untersucht, wie dieser die politische Rhetorik der Partei prägte und auf den Alltag der Menschen einwirkte. Sie beleuchtet die spezifischen Merkmale der nationalsozialistischen Sprache, wie Semantik, Superlativ und Adjektiv-Attribute, und analysiert die Verbreitung dieser Sprache in verschiedenen Medien und Lebensbereichen.
- Analyse der politischen Sprache der Nationalsozialisten
- Untersuchung der sprachlichen Einwirkung auf den Alltag
- Bewertung der Kontinuität oder des Bruchs in der deutschen Sprache nach 1945
- Bedeutung des Freund-Feind-Schemas in der nationalsozialistischen Rhetorik
- Untersuchung der Militarisierung der Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Konzept der „Ausdrucksideologie“ vor und beschreibt die zentrale Rolle der Sprache innerhalb dieses Konzepts. Sie führt in die Thematik der politischen Sprache der Nationalsozialisten ein und grenzt das Untersuchungsfeld der Arbeit ab.
Die politische Sprache der Nationalsozialisten
Dieses Kapitel analysiert die politische Sprache der Nationalsozialisten, insbesondere die Reden Hitlers, und untersucht deren spezifische Merkmale. Es werden drei große Wortfelder beleuchtet: der Sport, die naturwissenschaftlich-technische Sprache und die kriegerische Sprache. Die Arbeit zeigt auf, wie diese Wortfelder zur Förderung der Volksgemeinschaft und zur Verunglimpfung von Feinden eingesetzt wurden.
Sprachliche Einwirkung auf den Alltag
Dieses Kapitel beleuchtet die Einwirkung der nationalsozialistischen Sprache auf den Alltag der Menschen. Es werden verschiedene Medien und Bereiche untersucht, wie Plakate, Zeitungsanzeigen, Anordnungen, Sprachregelung im Pressewesen und die Einführung neuer Wörter. Die Arbeit zeigt auf, wie die NS-Sprache in den Alltag integriert wurde und eine umfassende Kontrolle über die Kommunikation errichtete.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen: „Ausdrucksideologie“, „politische Sprache“, „Semantik“, „Superlativ“, „Adjektiv-Attribute“, „Volksgemeinschaft“, „Feindbild“, „Sprachregelung“, „Neuwörter“, „Militarisierung“, „Kontinuität“, „Bruch“, „1945“.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der NS-Sprache als "Ausdrucksideologie"?
Sie ist kein geschlossenes System, sondern ein Gemenge aus Ideologien, das vor allem durch Schwarz-Weiß-Denken (Freund-Feind-Schema) geprägt ist.
Aus welchen Bereichen entlehnten die Nazis ihre Begriffe?
Wichtige Wortfelder waren der Sport, die Naturwissenschaft/Technik und insbesondere die kriegerische Sprache (Militarisierung).
Wie beeinflusste die NS-Sprache den Alltag der Menschen?
Durch gleichgeschaltete Medien, Plakate, Zeitungsanzeigen und "verordneten" Bedeutungswandel drang die politische Rhetorik bis in den privaten Raum vor.
Gab es nach 1945 einen kompletten Bruch in der deutschen Sprache?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob sich die Sprache mit dem Ende der NS-Herrschaft schlagartig änderte oder ob es Kontinuitäten bestimmter Begriffe gab.
Welche rhetorischen Mittel waren typisch für NS-Reden?
Häufig genutzt wurden Superlative, wertende Adjektiv-Attribute und eine stark emotionale Semantik zur Beeinflussung der Massen.
- Quote paper
- Andreas Graw (Author), 2004, Der Sprachgebrauch der Nationalsozialisten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60035