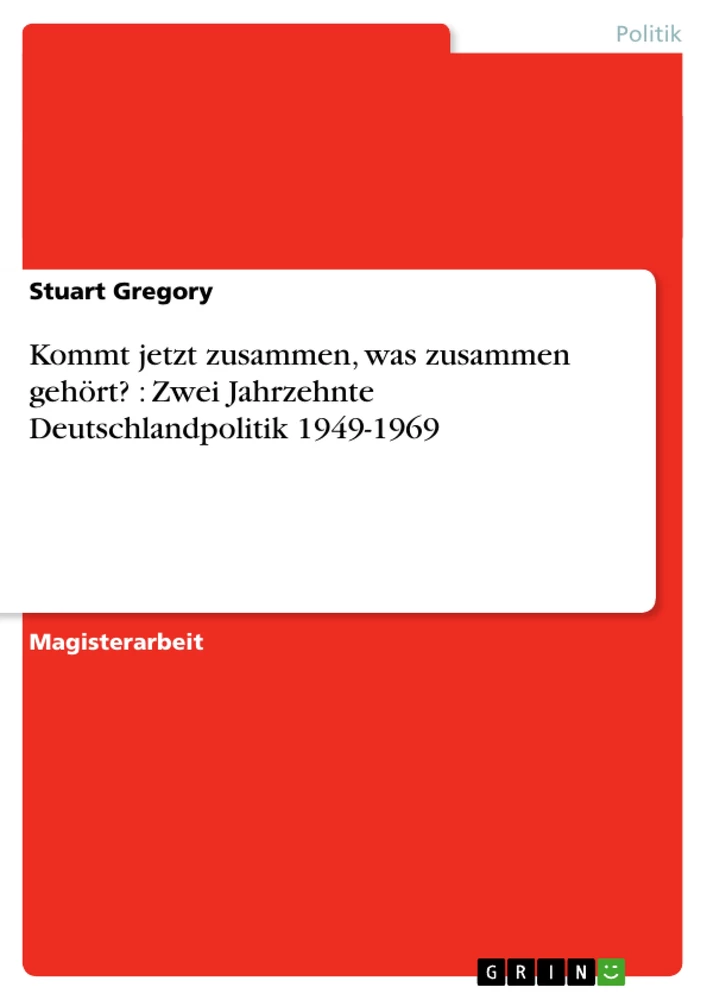Abstrakt
Diese Arbeit stellt die Frage, inwiefern wurde das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik in den ersten 20 Jahren nach denen Gründung von der öffentlichen Meinung bzw. vom innen- und aussenpolitischen Druck beeinflusst. Insbesonders wird die Stelle der Bundesrepublik untersucht. Es wird gezeigt, daß die Bundesrepublik paradoxerwiese das Ziel der deutschen Einheit folgte (oder zu folgen behauptete), indem sie ihre Stelle im westlichen Bündnis zementierte. Sie hoffte, daß die DDR durch westliche Stärke und diplomatische Isolierung gezwungen würde, rapproachement zu suchen. Direkter Kontakt mit Ostdeutschland wurde meistens auf den Sonderfall von Berlin gerichtet, und durch die Berliner Regierung geleitet. Selbst wenn die westdeutsche Regierung eine neue deutschlandpolitische Richtung suchte, wurde diese primär eine Folge der veränderten Lage des Kalten Kriegs. Die DDR, ihrerseits, versuchte sich ständig als eigenstängier, souveräner Staat zu bezeichnen.
Die Bevölkerung jenes Staats akzeptierte die Politik ihre Regierungen, und die öffentliche Meinung spielte keine Rolle in der Lösung der deutschen Frage.
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das Verhältnis zwischen den zwei deutschen Staaten überwiegend als eine Frage der internationalen Politik anstatt eine innenpolitische Sache behandelt wurde.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entwicklung des Status Quo
- 2.1. Die politische Teilung und die Gründung der zwei deutschen Staaten
- 2.2. Die Außenpolitik der Bundesrepublik
- 2.2.1. Grundlage der Außen- und Deutschlandpolitik: der Alleinvertretungsanspruch und die Hallstein Doktrin
- 2.3. "Die da drüben": Die Stellung der DDR
- 2.3.1. Die Mauer
- 2.3.2. Abgrenzung und die Suche nach Anerkennung
- 3. Druck zum Wandel
- 3.1. Politisches Engagement
- 3.2. Die öffentliche Meinung
- 3.3. Deutsch-deutsche Zusammenarbeit
- 3.3.1. Berlin
- 3.3.2. Ausreisende
- 3.4. Die politische Führung
- 3.4.1. Die SPD Politik
- 3.4.2. Die Unionsparteien
- 4. Die neue Ostpolitik
- 4.1. Anfang der neuen Ostpolitik
- 4.2. Ostpolitik zur Zeit der sozial-liberalen Koalition
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsch-deutsche Beziehung in den ersten zwanzig Jahren nach der Gründung der Bundesrepublik und der DDR. Im Mittelpunkt steht die westdeutsche Ostpolitik, ihre Beweggründe und Auswirkungen auf die DDR. Es wird analysiert, inwieweit innenpolitische und außenpolitische Faktoren, sowie die öffentliche Meinung, das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten beeinflusst haben.
- Die Rolle des Kalten Krieges in der deutschen Außenpolitik
- Die westdeutsche Deutschlandpolitik und der Alleinvertretungsanspruch
- Die Reaktion der DDR auf die westdeutsche Ostpolitik
- Der Einfluss der öffentlichen Meinung und des politischen Drucks
- Die Bedeutung der Berliner Frage
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext der deutschen Teilung und die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Einflüsse auf die deutsch-deutsche Beziehung in den ersten zwanzig Jahren nach der Staatsgründung. Sie hebt die Fokussierung auf die westdeutsche Ostpolitik und deren Auswirkungen hervor und betont die geringe Rolle von Kultur, Nationalismus und öffentlicher Meinung im Vergleich zur internationalen Politik. Der Molotow-Ribbentrop-Pakt wird als ein Beispiel für das vorherrschende Misstrauen zwischen der Sowjetunion und dem Westen genannt und als wichtiger Faktor für die Entwicklung der Nachkriegsordnung und der deutschen Teilung hervorgehoben.
2. Die Entwicklung des Status Quo: Dieses Kapitel beschreibt die politische Teilung Deutschlands und die Gründung der beiden deutschen Staaten. Es analysiert die Außenpolitik der Bundesrepublik, insbesondere den Alleinvertretungsanspruch und die Hallstein-Doktrin, sowie die Position der DDR, ihre Abgrenzung vom Westen und den Versuch, internationale Anerkennung zu erlangen. Die Errichtung der Berliner Mauer wird im Kontext der politischen und ideologischen Spannungen zwischen Ost und West eingeordnet und als ein entscheidender Moment in der Entwicklung der deutsch-deutschen Beziehungen dargestellt. Die Kapitel analysiert die strategische Positionierung beider Staaten im Kalten Krieg und die Rolle des internationalen Drucks auf die Entwicklung des Status Quo.
3. Druck zum Wandel: Kapitel 3 untersucht die Faktoren, die in den ersten 20 Jahren einen Wandel im deutsch-deutschen Verhältnis bewirkt haben. Es analysiert das politische Engagement, die öffentliche Meinung (wenn auch mit der Feststellung, dass diese nur eine geringe Rolle spielte), und die deutsch-deutsche Zusammenarbeit, insbesondere die Situation in Berlin und die Ausreisepolitik. Schließlich werden die politischen Strategien von SPD und Unionsparteien im Umgang mit der deutschen Frage beleuchtet. Die Zusammenfassung verdeutlicht, wie sich die verschiedenen Handlungsebenen, von internationalem Druck bis hin zur Innenpolitik, auf die Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden deutschen Staaten ausgewirkt haben.
4. Die neue Ostpolitik: Dieses Kapitel beschreibt den Beginn und die Entwicklung der neuen Ostpolitik, besonders während der sozial-liberalen Koalition. Es analysiert die politischen und strategischen Entscheidungen, die zu dieser Wende führten, sowie deren Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten. Die Analyse fokussiert sich auf die Hintergründe und die Ziele der neuen Ostpolitik, die sich im Kontext der veränderten internationalen Konstellation des Kalten Krieges abspielten. Es wird erörtert, welche Bedeutung die veränderten Machtverhältnisse und das veränderte Verhältnis zwischen den Großmächten für die neue Politik hatten.
Schlüsselwörter
Deutschlandpolitik, Kalter Krieg, Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Republik, deutsche Einheit, Hallstein-Doktrin, Alleinvertretungsanspruch, Ostpolitik, Berlin, öffentliche Meinung, internationaler Druck, deutsch-deutsche Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Deutsch-Deutsche Beziehungen (1949-1969)
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die deutsch-deutschen Beziehungen in den ersten zwanzig Jahren nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Der Schwerpunkt liegt auf der westdeutschen Ostpolitik, ihren Motiven und Auswirkungen auf die DDR. Es werden innen- und außenpolitische Faktoren sowie die öffentliche Meinung als Einflussgrößen auf das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten analysiert.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Die Entwicklung des Status Quo, 3. Druck zum Wandel, 4. Die neue Ostpolitik und 5. Schluss. Jedes Kapitel wird in einer Zusammenfassung detailliert beschrieben.
Welche Themen werden im Kapitel "Die Entwicklung des Status Quo" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die politische Teilung Deutschlands und die Gründung der beiden Staaten. Es analysiert die Außenpolitik der BRD (Alleinvertretungsanspruch und Hallstein-Doktrin) und die Position der DDR (Abgrenzung vom Westen und Suche nach internationaler Anerkennung). Die Errichtung der Berliner Mauer wird im Kontext der politischen und ideologischen Spannungen eingeordnet.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Druck zum Wandel"?
Kapitel 3 untersucht die Faktoren, die einen Wandel im deutsch-deutschen Verhältnis bewirkten. Analysiert werden politisches Engagement, öffentliche Meinung (deren geringe Rolle hervorgehoben wird), deutsch-deutsche Zusammenarbeit (Berlin und Ausreisepolitik) und die Strategien von SPD und Unionsparteien im Umgang mit der deutschen Frage.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Die neue Ostpolitik"?
Dieses Kapitel beschreibt den Beginn und die Entwicklung der neuen Ostpolitik, besonders während der sozial-liberalen Koalition. Es analysiert die politischen Entscheidungen, die zu dieser Wende führten, und deren Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten. Der Fokus liegt auf den Hintergründen und Zielen der neuen Ostpolitik im Kontext der veränderten internationalen Konstellation des Kalten Krieges.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Thematik des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Deutschlandpolitik, Kalter Krieg, Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Republik, deutsche Einheit, Hallstein-Doktrin, Alleinvertretungsanspruch, Ostpolitik, Berlin, öffentliche Meinung, internationaler Druck, deutsch-deutsche Zusammenarbeit.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument untersucht die deutsch-deutsche Beziehung in den ersten zwanzig Jahren nach der Staatsgründung. Im Mittelpunkt steht die westdeutsche Ostpolitik, ihre Beweggründe und Auswirkungen auf die DDR. Es wird analysiert, inwieweit innenpolitische und außenpolitische Faktoren, sowie die öffentliche Meinung, das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten beeinflusst haben.
Welche Rolle spielt der Kalte Krieg im Dokument?
Der Kalte Krieg spielt eine zentrale Rolle als Rahmenbedingung für die deutsch-deutschen Beziehungen. Er beeinflusst die Außenpolitik beider Staaten, den Alleinvertretungsanspruch der BRD, die Reaktionen der DDR und den internationalen Druck auf die Entwicklung des Verhältnisses zwischen beiden deutschen Staaten.
- Quote paper
- Stuart Gregory (Author), 2002, Kommt jetzt zusammen, was zusammen gehört? : Zwei Jahrzehnte Deutschlandpolitik 1949-1969, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6004