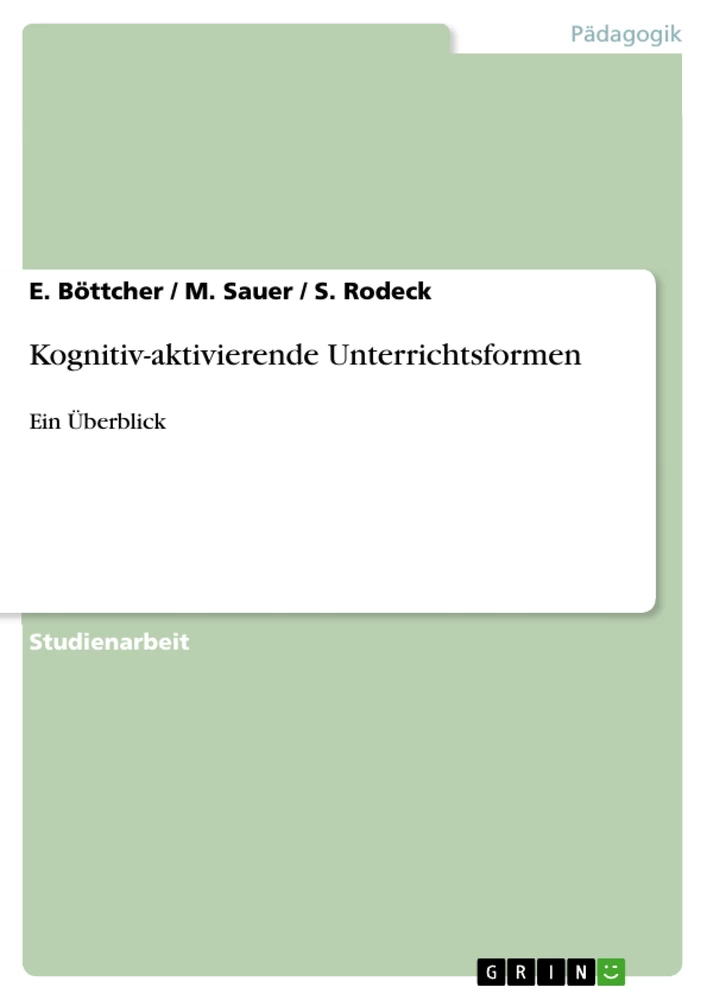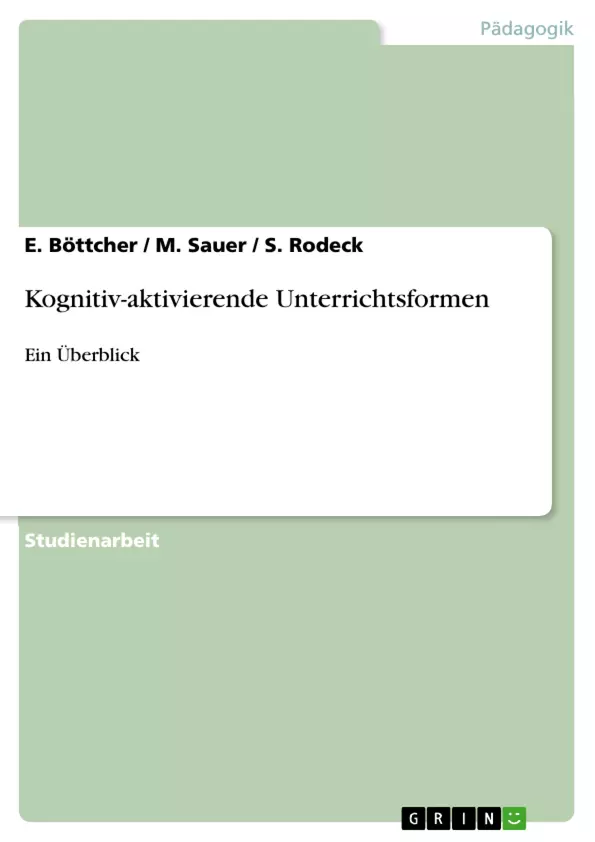Um aufzuzeigen, dass Lehrer durchaus im normalen Schulalltag Lernende befähigen können, neue Probleme mit vorhandenem Wissen lösen zu können, soll in dieser Hausarbeit folgende Frage aufgeworfen werden: Wie kann die Problemlösekompetenz der Lernenden - und damit die Fähigkeit in einer immer komplexer werdenden Welt neuen Anforderungen gerecht zu werden - verbessert werden? Aufbauend auf dieser Frage stellen wir in den Abschnitten 2 und 3 dieser Hausarbeit zum einen die traditionelle Unterrichtsphilosphie – die wir in unter dem Begriff Kognitivismus verstehen – und zum anderen den Konstruktivismus vor. Eine Analyse der jeweiligen Ansätze soll sowohl Chancen wie auch Gefahren der beiden Ansätze darstellen.
Als Ergebnis der beiden Abschnitte für die in dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung kann festgehalten werden, dass Problemlösekompetenz eher durch eine konstruktivistische Unterrichtsphilosophie ermöglicht wird, als durch den Kognitivismus. Dies liegt vor allem daran, dass Schlüsselkompetenzen, wie z.B. die Problemlösekompetenz nicht durch den Kognitivismus ausgeprägt werden können. Ferner entsteht durch den Kognitivismus träges Wissen, mit dem eine Lösung von neuen Problemen nur schwer möglich ist. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns im weiteren Verlauf der Hausarbeit mit dem Konstruktivismus und stellen, um die Frage zu beantworten, wie Schülern eine Problemlösekompetenz erwerben können, verschiedene Ansätze des Konstruktivismus im Abschnitt 3 dar.
Der Abschnitt 3.1. beschäftigt sich insbesondere mit der Cognitive Flexibility-Theorie, welche das Geschehen außerhalb der Schule möglichst komplex darstellen möchte. Der Cognitive Apprenticeship-Ansatz, der insbesondere in der beruflichen Ausbildung in Betrieben, relevant ist, soll im Abschnitt 3.2. gewürdigt werden. Schließlich wird im Abschnitt 3.3. anhand des amerikanischen Beispiels „Adventures of Jasper Woodbury“ der Anchored Instruction-Ansatz näher erläutert werden. Im vierten und letzten Abschnitt dieser Hausarbeit soll ein abschließendes Fazit gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kognitivismus
- Lernen in systemvermittelnden Lernumgebungen
- Primat der Instruktion
- Rollenverständnis der Lehrenden & Lernenden
- Chancen des Kognitivismus
- Gefahren des Kognitivismus
- Der Konstruktivismus
- Lernen in situierten Lernumgebungen
- Primat der Instruktion
- Rollenverständnis der Lehrenden & Lernenden
- Cancen des Konstruktivismus
- Gefahren des Konstruktivismus
- Ansätze des Konstruktivismus
- Cognitive Apprenticeship
- Cognitive Flexibility
- Anchored Instruction
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Problemlösekompetenz von Lernenden in einer immer komplexer werdenden Welt verbessert werden kann. Sie untersucht die traditionelle Unterrichtsphilosophie, den Kognitivismus, und den Konstruktivismus, um deren Chancen und Gefahren für die Förderung von Problemlösefähigkeiten zu beleuchten.
- Vergleich der traditionellen Unterrichtsphilosophie (Kognitivismus) und des Konstruktivismus
- Analyse von Chancen und Gefahren der beiden Ansätze für die Förderung der Problemlösekompetenz
- Darstellung von Ansätzen des Konstruktivismus, die die Entwicklung von Problemlösekompetenz fördern
- Bewertung der Eignung der verschiedenen Ansätze zur Verbesserung der Problemlösekompetenz
- Zusammenfassende Bewertung der beiden Unterrichtsphilosophien im Hinblick auf die Förderung von Problemlösefähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die Ergebnisse der PISA-Studie und stellt die Problematik des Wissensabrufs und der Anwendung in neuen Problemfeldern im deutschen Bildungssystem dar. Die Arbeit formuliert die Leitfrage, wie die Problemlösekompetenz der Lernenden verbessert werden kann.
Kapitel 2 beleuchtet den Kognitivismus, der Lernen als einen Prozess der Informationsverarbeitung versteht, der sich eindeutig beschreiben lässt. Das Kapitel analysiert die Rolle des Lehrenden und des Lernenden in systemvermittelnden Lernumgebungen und diskutiert Chancen und Gefahren des Kognitivismus für die Entwicklung von Problemlösefähigkeiten.
Kapitel 3 widmet sich dem Konstruktivismus, der Lernen als einen aktiven Konstruktionsprozess des Lernenden im Kontext situierter Lernumgebungen versteht. Das Kapitel analysiert die Rolle des Lehrenden und des Lernenden, diskutiert Chancen und Gefahren des Konstruktivismus für die Förderung von Problemlösefähigkeiten.
Kapitel 4 stellt verschiedene Ansätze des Konstruktivismus vor, die sich mit der Förderung von Problemlösekompetenz befassen. Dazu zählen die Cognitive Flexibility-Theorie, der Cognitive Apprenticeship-Ansatz und der Anchored Instruction-Ansatz.
Schlüsselwörter
Kognitivismus, Konstruktivismus, Problemlösekompetenz, systemvermittelnde Lernumgebungen, situierte Lernumgebungen, Cognitive Flexibility, Cognitive Apprenticeship, Anchored Instruction.
- Quote paper
- E. Böttcher (Author), M. Sauer (Author), S. Rodeck (Author), 2005, Kognitiv-aktivierende Unterrichtsformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60061