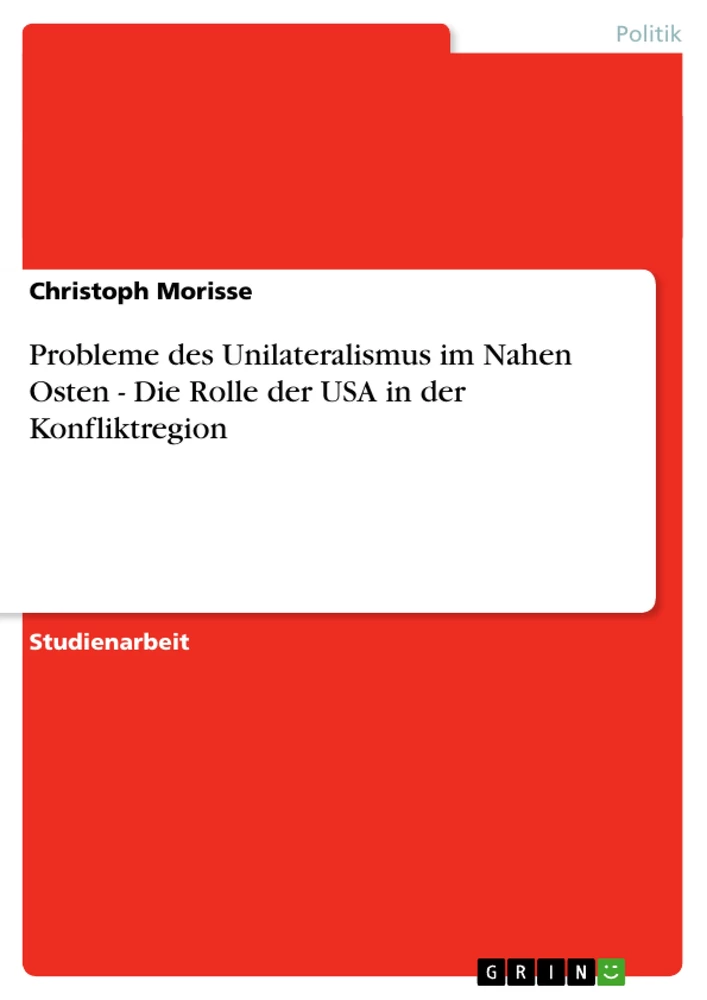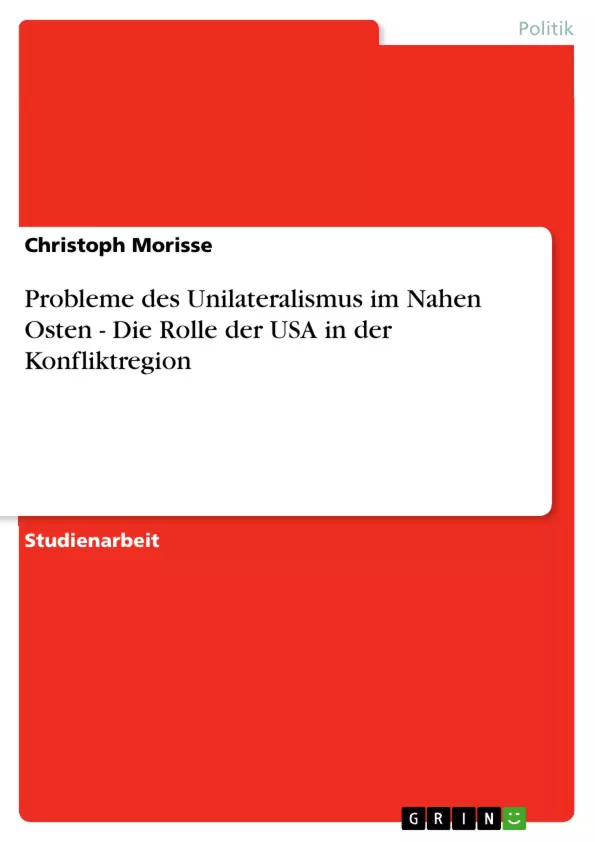Ziel dieser Untersuchung ist es, die Rolle der USA im regionalen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu analysieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die politischen Interessen der USA. Der Betrachtungszeitraum ist die Amtszeit von William Jefferson Clinton1. Zur Zeit der Clinton-Administration zeichnet sich von Beginn bis Ende in Bezug auf den Peace Process2 ein Spannungsbogen mit negativer Tendenz ab: Von sehr positiven Anfängen (Oslo I) über einen praktischen Stillstand der Verhandlungen (Netanjahu-Regierung) bis hin zum damaligen Höhepunkt der negativen Entwicklung des Friedensprozesses, dem Ausbruch der Al-Aksa-Intifada.
Zum Thema „Pax Americana“3 ist in der großen Auswahl an Literatur die Fallstudie von Hubel, Kaim und Lembcke4 zur Zeit die fundierteste und umfassendste Analyse der weltpolitischen Rolle der USA im Nahen Osten. Trotz der vielen, theoretischen Modelle verschafft die Abhandlung einen fundierten Einblick in die komplexen und zum Teil widersprüchlichen Interdependenzen in der Konfliktregion.
Es werden in dieser Arbeit keine neuen Vorschläge für die Lösung des Jahrzehnte andauernden Konfliktes gemacht, die nicht schon in den wichtigsten Publikationen zum Thema diskutiert worden sind. Die Untersuchung möchte vielmehr einen Beitrag dazu leisten, den Nahost-Konflikt und seine Verankerung in der Geopolitik der USA einzuordnen, indem die Interessen der Supermacht USA, genau analysiert werden, so dass Widersprüche und Dilemmata in den Beziehungen zu Israel und den arabischen Staaten deutlich werden.
Eine Analyse der U.S:-Interessen ist eine notwendige Voraussetzung für Frieden und Stabilität schaffende Strategien, aus denen realistische Optionen zu Konfliktlösungen hervorgehen können. Eine der Kernfragen bleibt, warum die bisherige Politik der USA im Nahen Osten wenig erfolgreich war und sich kein durchgreifend stabiler Friede etablieren konnte. Können sich die USA nicht durchsetzen? Reichen die Drohungen und Angebote der Sole Superpower nicht aus? Wollen die Amerikaner überhaupt eine endgültige Friedensordnung oder ist das oberste Ziel das Aufrechterhalten des Peace Process? Antworten sind die Basis für Friedens- und Stabilitäts-Konzepte für neue Windows of Opportunity.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Kurze Vorüberlegung zu theoretischen Voraussetzungen
- 2. Suprematie der USA
- 3. Ziele der USA im Nahen Osten
- 4. „Rebellen und Musterknaben“ im regionalen System aus Sicht der USA
- 4.1. Konstellation nach Hottinger
- 4.2. Position der USA als extraregionaler Akteur im regionalen System
- 4.3 Instrumentalisierung der USA
- 5. Sicherheitspolitik der USA im Nahen Osten
- 5.1. U.S.-Militärhilfe für Israel
- 5.2. Atomwaffen-Dilemma
- 5.3. U.S.-Militärstrategie im Nahen Osten
- 5.4. Multipolarität als militärstrategische Option im Nahen Osten
- 5.5. Innenpolitische Voraussetzung der U.S.-Politik im Nahen Osten
- 6. Clintons Nahost-Politik
- 6.1. Divided Gouvernment nach der „konservativen Revolution“
- 6.2. Methoden der Clinton-Administration
- 6.2.1. Shuttle Diplomacy
- 6.2.2. Hands-Off-Strategie
- 6.2.3. Dilemmata
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle der USA im israelisch-palästinensischen Konflikt während der Amtszeit von Bill Clinton (1993-2001), wobei der Fokus auf den politischen Interessen der USA liegt. Sie untersucht die Entwicklung des Friedensprozesses während dieser Zeit, von optimistischen Anfängen bis zum Ausbruch der zweiten Intifada. Die Arbeit vermeidet Lösungsvorschläge, die nicht bereits in der Literatur diskutiert wurden, und konzentriert sich stattdessen auf die Einordnung des Nahost-Konflikts in die US-amerikanische Geopolitik und die Analyse der US-Interessen, um Widersprüche und Dilemmata aufzuzeigen. Eine zentrale Frage ist, warum die US-Politik im Nahen Osten wenig erfolgreich war und kein stabiler Friede entstand.
- Die politischen Interessen der USA im Nahost-Konflikt
- Die Rolle der USA als extraregionaler Akteur
- Der Einfluss der US-amerikanischen Innenpolitik auf die Nahost-Politik
- Analyse des Friedensprozesses während der Clinton-Administration
- Widersprüche und Dilemmata in der US-amerikanischen Nahost-Politik
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, die Rolle der USA im israelisch-palästinensischen Konflikt während der Clinton-Ära zu analysieren, mit besonderem Fokus auf die US-amerikanischen politischen Interessen. Der Zeitraum wird als von optimistischen Anfängen bis zum negativen Höhepunkt des Friedensprozesses mit dem Ausbruch der Al-Aksa-Intifada beschrieben. Die Arbeit stützt sich auf bestehende Literatur und zielt darauf ab, den Konflikt im Kontext der US-Geopolitik zu verorten und die US-Interessen detailliert zu analysieren, um Widersprüche und Dilemmata aufzuzeigen. Die Untersuchung soll einen Beitrag zum Verständnis der Ursachen für den mangelnden Erfolg der bisherigen US-Politik leisten.
1. Kurze Vorüberlegung zu theoretischen Voraussetzungen: Dieses Kapitel analysiert den israelisch-palästinensischen Konflikt als regionalen Konflikt mit globalen Auswirkungen. Es argumentiert, dass der Konflikt maßgeblich den außenpolitischen Erfolg US-amerikanischer Präsidenten beeinflusst und die Beziehungen der USA zu arabischen Staaten prägt. Der Einfluss des Konflikts auf die Weltpolitik wird anhand des großen Interesses der USA an der Region, dem Einfluss der pro-israelischen Lobby und der strategischen Bedeutung der Öl exportierenden arabischen Staaten erläutert. Die Arbeit benennt auch die Schwierigkeiten, den regionalen Konflikt vom globalen Kontext zu trennen und die begrenzten Erfolge von Theorien der internationalen Beziehungen bei der Konfliktlösung.
2. Suprematie der USA: Dieses Kapitel behandelt die US-amerikanische Hegemonie nach dem Ende des Kalten Krieges. Es beschreibt die USA als einzige Supermacht und diskutiert Brzezinski's Konzept einer „Hegemonie neuen Typs“ und deren Grenzen. Es wird argumentiert, dass die USA, trotz ihrer Dominanz, nicht immer ihre Ziele im Nahen Osten durchsetzen können, was anhand von Beispielen aus der Clinton-Ära illustriert wird, in denen der Friedensprozess aufgrund von innen- und außenpolitischen Faktoren ins Stocken geriet. Der Fokus liegt auf den US-Interessen hinter der Nahost-Politik und der Frage, warum die Supermacht ihre Ziele nicht vollständig erreicht.
3. Ziele der USA im Nahen Osten: Dieses Kapitel beschreibt die unveränderte Ausrichtung der US-Außenpolitik im Nahen Osten seit 1945, die durch die „Heilige Dreieinigkeit“ – Schutz Israels, Zugang zu Ölmärkten und Eindämmung des Kommunismus – gekennzeichnet ist. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die „Eindämmung des Terrorismus“ zum zentralen Punkt. Die Arbeit beschreibt dies als „Eindämmung nicht-amerikanischer Wertvorstellungen“ und diskutiert die Prioritäten dieser außenpolitischen Ziele.
Schlüsselwörter
USA, Nahost-Konflikt, Israel, Palästinenser, Friedensprozess, Clinton-Administration, Geopolitik, nationale Interessen, Supermacht, Hegemonie, Sicherheitspolitik, Öl, Terrorismus, multipolare Weltordnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Rolle der USA im israelisch-palästinensischen Konflikt während der Clinton-Ära
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rolle der USA im israelisch-palästinensischen Konflikt während der Amtszeit von Bill Clinton (1993-2001), mit besonderem Fokus auf die politischen Interessen der USA. Sie untersucht die Entwicklung des Friedensprozesses in diesem Zeitraum, von optimistischen Anfängen bis zum Ausbruch der zweiten Intifada.
Welche zentralen Fragestellungen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die politischen Interessen der USA im Nahost-Konflikt, die Rolle der USA als extraregionaler Akteur, den Einfluss der US-amerikanischen Innenpolitik auf die Nahost-Politik, den Friedensprozess während der Clinton-Administration sowie Widersprüche und Dilemmata in der US-amerikanischen Nahost-Politik. Eine zentrale Frage ist, warum die US-Politik im Nahen Osten wenig erfolgreich war und kein stabiler Friede entstand.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit analysiert den israelisch-palästinensischen Konflikt als regionalen Konflikt mit globalen Auswirkungen und diskutiert die Schwierigkeiten, den regionalen Konflikt vom globalen Kontext zu trennen. Sie betrachtet die begrenzten Erfolge von Theorien der internationalen Beziehungen bei der Konfliktlösung und analysiert die US-amerikanische Hegemonie nach dem Ende des Kalten Krieges, inklusive Brzezinski's Konzept einer „Hegemonie neuen Typs“ und deren Grenzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die die Zielsetzung der Arbeit und den zeitlichen Rahmen beschreibt; ein Kapitel zu theoretischen Voraussetzungen; ein Kapitel zur Suprematie der USA; ein Kapitel zu den Zielen der USA im Nahen Osten; ein Kapitel zu „Rebellen und Musterknaben“ im regionalen System aus Sicht der USA; ein Kapitel zur Sicherheitspolitik der USA im Nahen Osten und ein Kapitel zu Clintons Nahost-Politik, inklusive der verwendeten Methoden (Shuttle Diplomacy, Hands-Off-Strategie) und der damit verbundenen Dilemmata. Jedes Kapitel analysiert spezifische Aspekte der US-amerikanischen Rolle im Konflikt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit vermeidet Lösungsvorschläge, die nicht bereits in der Literatur diskutiert wurden. Stattdessen konzentriert sie sich auf die Einordnung des Nahost-Konflikts in die US-amerikanische Geopolitik und die Analyse der US-Interessen, um Widersprüche und Dilemmata aufzuzeigen und einen Beitrag zum Verständnis der Ursachen für den mangelnden Erfolg der bisherigen US-Politik zu leisten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: USA, Nahost-Konflikt, Israel, Palästinenser, Friedensprozess, Clinton-Administration, Geopolitik, nationale Interessen, Supermacht, Hegemonie, Sicherheitspolitik, Öl, Terrorismus, multipolare Weltordnung.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselwörtern. Sie basiert auf bestehender Literatur und zielt auf eine detaillierte Analyse der US-amerikanischen Interessen und ihrer Auswirkungen auf den Nahost-Konflikt ab.
- Quote paper
- Christoph Morisse (Author), 2001, Probleme des Unilateralismus im Nahen Osten - Die Rolle der USA in der Konfliktregion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6012