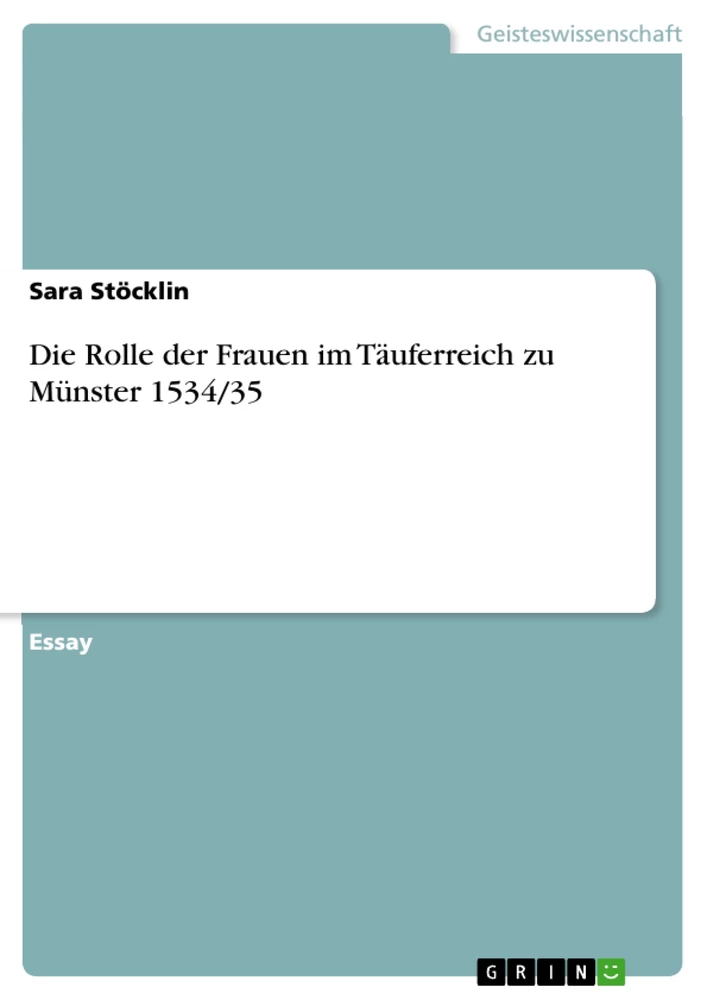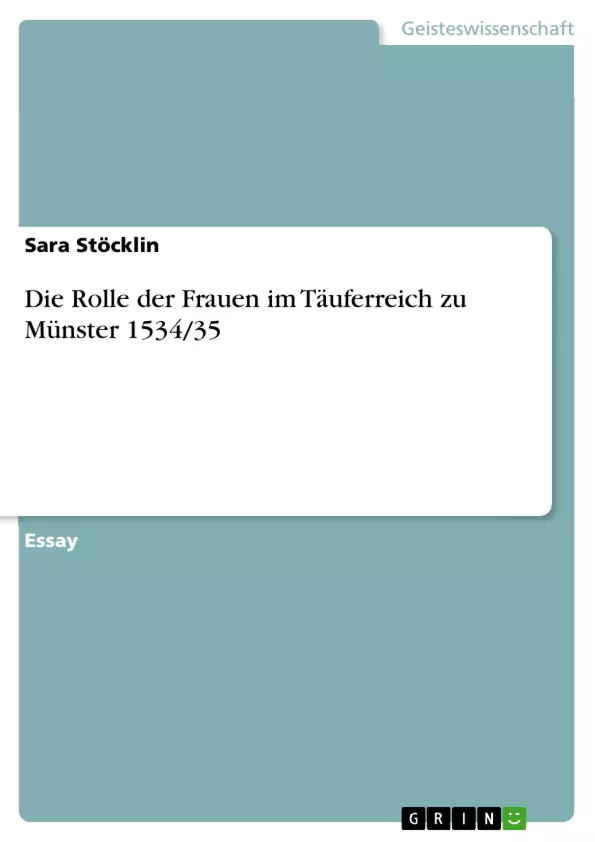Die drei eisernen Käfige, die weit oben am Lamberti-Kirchtum der Stadt Münster in Westfalen hängen, erinnern noch heute an die erschütternden Ereignisse, die sich in den Jahren 1534/35 dort zugetragen haben. Nicht wenige Historiker haben sich in den seither vergangenen Jahrhunderten die Frage gestellt, warum und wie es dazu kommen konnte, dass eine religiöse Bewegung eine Stadt bis zur völligen Verblendung überrollte und für sich einnahm. Es stellt sich jedoch nicht nur die Frage nach dem „Warum“, sondern auch die Frage nach dem „Wer“. Wer waren die Menschen, die das „Täuferreich zu Münster“ mit dessen Schreckensherrschaft errichteten, und wer waren die Menschen, die sich dieser Schreckensherrschaft beugten oder unter ihr litten? Im folgenden Aufsatz soll die Frage nach dem „Wer“ auf eine Gruppe eingeschränkt werden, ohne die das Täuferreich kaum hätte bestehen können: die Frauen. Wer waren die Frauen in Münster und was für eine Rolle spielten sie im Täuferreich? Nach einem historischen Abriss der Ereignisse soll sowohl auf überlieferte Einzelschicksale als auch auf die Frauen als Gruppierung eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Abriss
- Einzelne Frauenschicksale
- Divara von Haarlem
- Hille Feicken
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz befasst sich mit der Rolle der Frauen im Täuferreich zu Münster im Jahr 1534/35. Er analysiert die individuellen Schicksale von Frauen, die im Täuferreich eine Rolle spielten, und beleuchtet die Rolle von Frauen als Gruppierung in diesem historischen Kontext.
- Das Leben und Wirken von Frauen im Täuferreich
- Die verschiedenen Positionen, die Frauen innerhalb des Täuferreiches einnahmen
- Die Auswirkungen der eschatologischen Lehre des Täuferreichs auf die Rolle von Frauen
- Die Auswirkungen der Einführung der Vielehe auf das Leben von Frauen in Münster
- Die Rolle von Frauen im Widerstand gegen die Herrschaft von Jan Bockelson
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Frage nach der Rolle von Frauen im Täuferreich zu Münster in den Mittelpunkt und gibt eine kurze Einführung in die historischen Ereignisse.
Historischer Abriss
Dieser Abschnitt bietet einen historischen Überblick über die Entwicklungen, die zum Entstehen des Täuferreichs in Münster führten, von der Reformation bis hin zur Einführung der Gütergemeinschaft und der Vielehe.
Einzelne Frauenschicksale
Divara von Haarlem
Dieser Abschnitt beschreibt das Leben und Wirken von Divara von Haarlem, der Witwe von Jan Matthysz und Ehefrau von Jan Bockelson, als „oberste Königin“ im Täuferreich. Er beleuchtet ihre Rolle und ihren Einfluss im Täuferreich.
Hille Feicken
Dieser Abschnitt beleuchtet das Schicksal von Hille Feicken, einer Friesin, die nach Münster kam und sich der Täuferbewegung anschloss.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Aufsatzes umfassen: Täuferreich, Münster, Frauen, Geschichte, Religion, Reformation, Eschatologie, Vielehe, Divara von Haarlem, Hille Feicken, Jan Bockelson, Bernhard Rothmann.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Täuferreich zu Münster?
Das Täuferreich war eine radikal-religiöse Herrschaft in Münster (1534–1535), die auf apokalyptischen Vorstellungen basierte und durch die Einführung der Gütergemeinschaft und der Vielehe bekannt wurde.
Welche Rolle spielten Frauen im Täuferreich?
Frauen waren numerisch in der Mehrzahl und für das Bestehen des Reiches essenziell. Sie nahmen Rollen von der einfachen Gläubigen bis hin zur „Königin“ (wie Divara von Haarlem) ein.
Was bedeutete die Einführung der Vielehe für die Frauen in Münster?
Die Vielehe wurde zwangsweise eingeführt, was für viele Frauen einen massiven Verlust an Selbstbestimmung und sozialen Status bedeutete, während sie gleichzeitig in ein strenges hierarchisches System gepresst wurden.
Wer war Divara von Haarlem?
Divara von Haarlem war die Witwe des Täuferführers Jan Matthysz und spätere Ehefrau von Jan Bockelson. Sie wurde im Täuferreich als „Königin“ eingesetzt und nahm eine prominente öffentliche Rolle ein.
Gab es Widerstand von Frauen gegen die Täuferherrschaft?
Ja, es gab Berichte über Frauen, die sich der Vielehe widersetzten oder versuchten, aus der belagerten Stadt zu fliehen, was oft mit drakonischen Strafen bis hin zur Hinrichtung geahndet wurde.
- Quote paper
- Sara Stöcklin (Author), 2005, Die Rolle der Frauen im Täuferreich zu Münster 1534/35, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60221