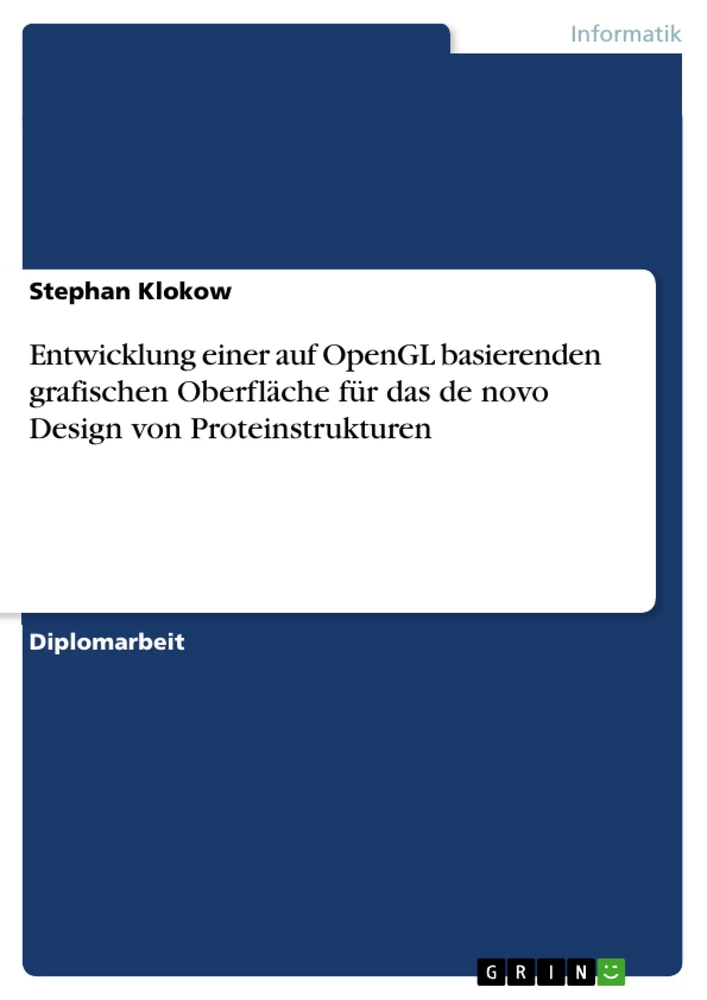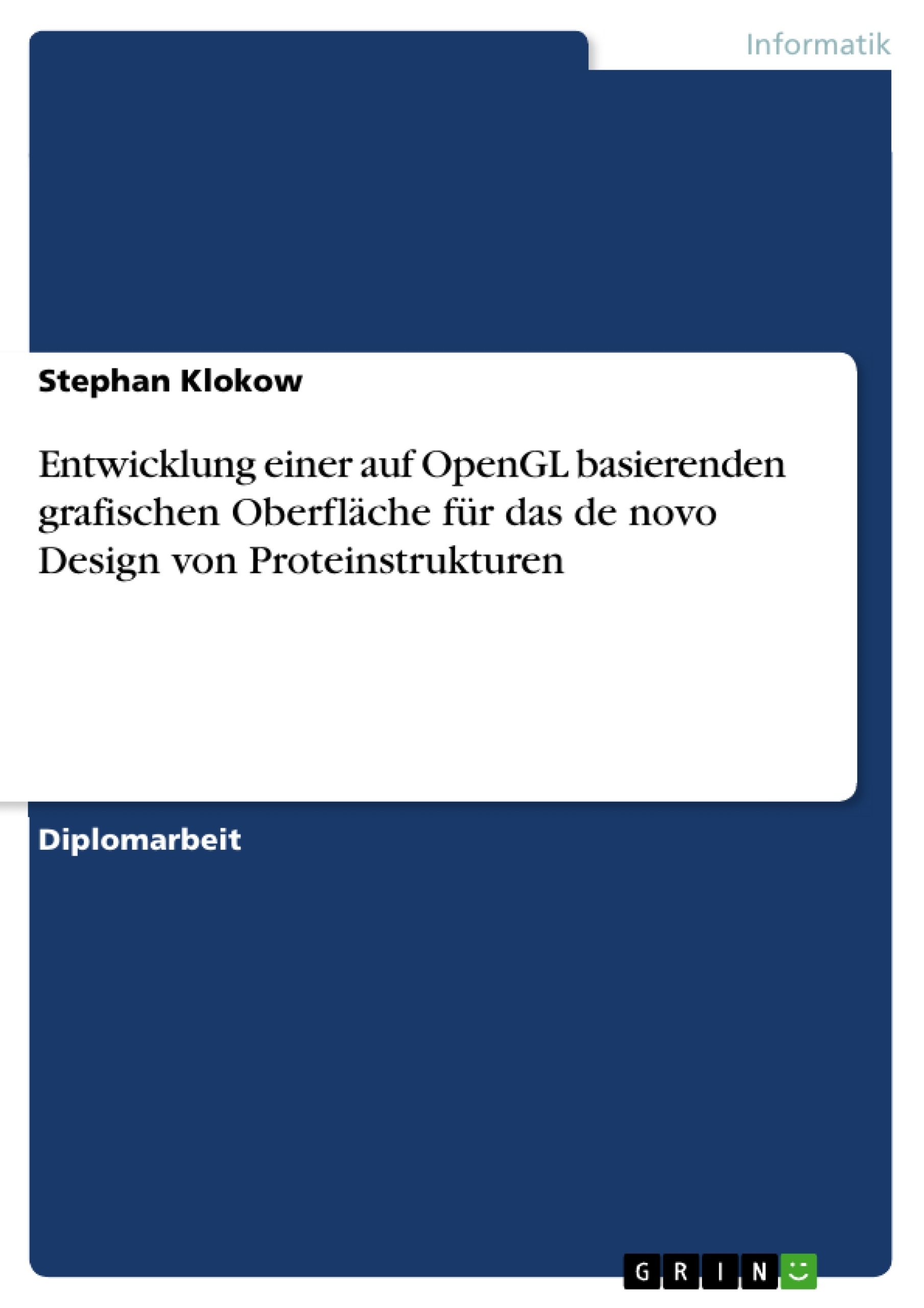Proteine sorgen dafür, dass chemische Reaktionen in Zellen katalysiert und reguliert werden (Enzyme), sie übermitteln Signale von Zelle zu Zelle (Hormone), erkennen Signale und leiten sie dem Zellinneren zu (Rezeptoren), transportieren schlecht wasserlösliche Stoffe wie Sauerstoff (Hämoglobin) oder Eisen (Transferrin) und leiten oder pumpen Ionen durch Zellmembranen (Ionenkanäle und pumpen) [Löffler, Petrides, 2003, 1]. Proteine verleihen der Zelle ihre jeweilige Gestalt. Ihre dreidimensionale Struktur oder Tertiärstruktur enthält die wesentlichen Informationen, um all diese Funktionen effizient und unter strenger Kontrolle ablaufen zu lassen. Die räumliche Struktur, also die Form, ist das Geheimnis der Funktionen von Proteinen. Ein wichtiges Thema in der Biologie der letzten Jahre ist deshalb die Bestimmung oder die Vorhersage solcher Proteinstrukturen. Der Schlüssel zum Verständnis der Funktionen von Proteinen heißt: Die Funktion ist von der dreidimensionalen Struktur abhängig, die wiederum durch die Aminosäuresequenz in einer definierten physikochemischen Umgebung festgelegt ist.
Die experimentelle Bestimmung von Proteinstrukturen ist sehr aufwendig. Für die Untersuchung der Struktur von Proteinen gibt es zwei Verfahren: Die Röntgenstrukturanalyse und die Kernmagnetresonanz-Spektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance, NMR). Bei Proteinen, die sich kristallisieren lassen, kann man mit der Röntgenstrukturanalyse (Beugung von Röntgenstrahlen) recht genau die Position jedes einzelnen Atoms in Bezug auf die anderen Atome des Moleküls bestimmen. Die NMR-Spektroskopie ergänzt die Röntgenstrukturanalyse, da sie Informationen über die dreidimensionale Struktur in Lösung liefert, etwa über die Flexibilität von Teilen des Proteins, die sich in kristalliner Form nicht zeigen [Nelson, Cox, 1]. Theoretische Aussagen, wie man von der Sequenz auf die Struktur schließen kann, sind nach dem heutigen Stand der Technik noch sehr unzuverlässig. So liegen zwar häufig die Sequenzen für Proteine vor, aber nicht deren dreidimensionale Strukturen. Spezielle biologische Funktionen können jedoch nur aus der räumlichen Struktur eines Proteins abgeleitet werden. Die Funktionen vieler Proteine erfordern die Bindung anderer Moleküle. Ein Molekül, das von einem Protein gebunden wird, bezeichnet man als Ligand. Ein Ligand kann ein beliebiges Molekül sein, aber auch ein anderes Protein.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Motivation und Grundlagen
- 1.1 Motivation
- 1.2 Das Protein
- 1.2.1 Aufbau von Proteinen
- 1.2.2 Faltung von Proteinen
- 1.2.3 Die α-Helix
- 1.2.4 Das β-Faltblatt
- 1.2.5 Das Rückgrat eines Proteins
- 1.2.6 Das Ramachandran-Diagramm
- 1.3 Die Tetrapeptidfunktionen der ACGT ProGenomics AG
- 1.4 Grundlagen der Grafikprogrammierung
- 1.4.1 OpenGL
- 1.4.1.1 Theoretische Grundlagen von OpenGL
- 1.4.2 DirectX
- 1.4.3 Das Tao-Framework
- 2 Herangehensweise
- 3 Programmierung
- 3.1 Das .NET-Framework
- 3.2 Softwareentwicklung
- 3.2.1 Phasen
- 3.2.2 Begriffe
- 4 Programmierung der grafischen Oberfläche
- 4.1 Erstellen der Sekundärstrukturelemente in OpenGL
- 4.2 Geometrische und topologische Eigenschaften der Sekundärstrukturelemente
- 5 Berechnen der Sequenz
- 5.1 Parameter für die Berechnung
- 5.2 Erstellen der Sequenz
- 5.3 Auswertung der Ergebnisse
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- 6.1 Zusammenfassung und offene Aufgaben
- 6.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit zielt auf die Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche ab, die auf OpenGL basiert und das de novo Design von Proteinstrukturen ermöglicht. Die Arbeit verbindet Aspekte der Bioinformatik mit der Computergrafik.
- Entwicklung einer OpenGL-basierten grafischen Oberfläche
- De novo Design von Proteinstrukturen
- Integration von bioinformatischen Daten
- Anwendung des .NET-Frameworks
- Algorithmen zur Proteinstrukturvorhersage
Zusammenfassung der Kapitel
1 Motivation und Grundlagen: Dieses Kapitel legt die Motivation für die Arbeit dar und liefert grundlegende Informationen über Proteine, ihren Aufbau, ihre Faltung und die relevanten Konzepte wie die α-Helix, das β-Faltblatt und das Ramachandran-Diagramm. Es werden die Tetrapeptidfunktionen der ACGT ProGenomics AG vorgestellt und die Grundlagen der Grafikprogrammierung mit Fokus auf OpenGL, DirectX und dem Tao-Framework erläutert. Die Kapitelteile liefern den notwendigen Kontext und das theoretische Fundament für die anschließende Entwicklung der grafischen Oberfläche.
2 Herangehensweise: Dieses Kapitel beschreibt den methodischen Ansatz zur Entwicklung der Software. Es wird die Gesamtstrategie und der Ablauf der Programmierung vorgestellt. Obwohl der Inhalt nicht im Detail spezifiziert ist, ist es essentiell, um das Verständnis der folgenden Kapitel über die Implementierung zu gewährleisten.
3 Programmierung: Hier wird das .NET-Framework als Basis der Softwareentwicklung vorgestellt und der Softwareentwicklungsprozess in einzelne Phasen unterteilt, sowie wichtige Begriffe erklärt. Dieses Kapitel dient als Brücke zwischen dem theoretischen Fundament und der praktischen Implementierung der grafischen Oberfläche.
4 Programmierung der grafischen Oberfläche: In diesem Kapitel wird detailliert beschrieben, wie die Sekundärstrukturelemente in OpenGL erstellt wurden und welche geometrischen und topologischen Eigenschaften dieser Elemente berücksichtigt wurden. Es ist das Kernstück der Arbeit, welches die praktische Umsetzung der theoretischen Konzepte aus Kapitel 1 zeigt.
5 Berechnen der Sequenz: Dieses Kapitel beschreibt die Berechnung der Aminosäuresequenz für das Protein Design. Es beinhaltet die Parameter für die Berechnung, den Prozess des Erstellens der Sequenz und schließlich die Auswertung der Ergebnisse. Die Ergebnisse dieses Kapitels sind entscheidend für das erfolgreiche Design der Proteinstruktur.
Schlüsselwörter
OpenGL, Proteinstruktur, de novo Design, Grafikprogrammierung, .NET-Framework, Aminosäuresequenz, Sekundärstruktur, α-Helix, β-Faltblatt, Ramachandran-Diagramm, Bioinformatik, Softwareentwicklung
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: De novo Design von Proteinstrukturen mit OpenGL
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zur Gestaltung von Proteinstrukturen (de novo Design). Die GUI basiert auf OpenGL und integriert bioinformatische Daten. Die Arbeit verbindet Aspekte der Bioinformatik und der Computergrafik.
Welche Software und Technologien werden verwendet?
Die Arbeit verwendet OpenGL für die grafische Darstellung, das .NET-Framework als Entwicklungsumgebung und verschiedene Algorithmen zur Proteinstrukturvorhersage. Zusätzlich werden DirectX und das Tao-Framework erwähnt, jedoch nicht im Detail beschrieben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: 1. Motivation und Grundlagen; 2. Herangehensweise; 3. Programmierung; 4. Programmierung der grafischen Oberfläche; 5. Berechnen der Sequenz; 6. Zusammenfassung und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Entwicklung und Implementierung der Software.
Was wird im Kapitel "Motivation und Grundlagen" behandelt?
Dieses Kapitel liefert die Motivation für das Projekt, grundlegende Informationen über Proteine (Aufbau, Faltung, α-Helix, β-Faltblatt, Ramachandran-Diagramm), die Tetrapeptidfunktionen der ACGT ProGenomics AG und die Grundlagen der Grafikprogrammierung (OpenGL, DirectX, Tao-Framework).
Was wird im Kapitel "Programmierung der grafischen Oberfläche" behandelt?
Hier wird detailliert die Erstellung der Sekundärstrukturelemente in OpenGL beschrieben, inklusive der geometrischen und topologischen Eigenschaften dieser Elemente. Es ist das Kernstück der Arbeit, welches die praktische Umsetzung der theoretischen Konzepte aus Kapitel 1 zeigt.
Wie wird die Aminosäuresequenz berechnet?
Kapitel 5 beschreibt die Berechnung der Aminosäuresequenz. Es werden die Parameter der Berechnung, der Prozess der Sequenzerstellung und die Auswertung der Ergebnisse erläutert. Die Ergebnisse dieses Kapitels sind essentiell für das erfolgreiche Design der Proteinstruktur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: OpenGL, Proteinstruktur, de novo Design, Grafikprogrammierung, .NET-Framework, Aminosäuresequenz, Sekundärstruktur, α-Helix, β-Faltblatt, Ramachandran-Diagramm, Bioinformatik, Softwareentwicklung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Diplomarbeit?
Die Zielsetzung ist die Entwicklung einer OpenGL-basierten GUI, welche das de novo Design von Proteinstrukturen ermöglicht. Die Arbeit integriert bioinformatische Daten und wendet das .NET-Framework an.
- Quote paper
- Diplom-Informatiker FH Stephan Klokow (Author), 2004, Entwicklung einer auf OpenGL basierenden grafischen Oberfläche für das de novo Design von Proteinstrukturen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60283