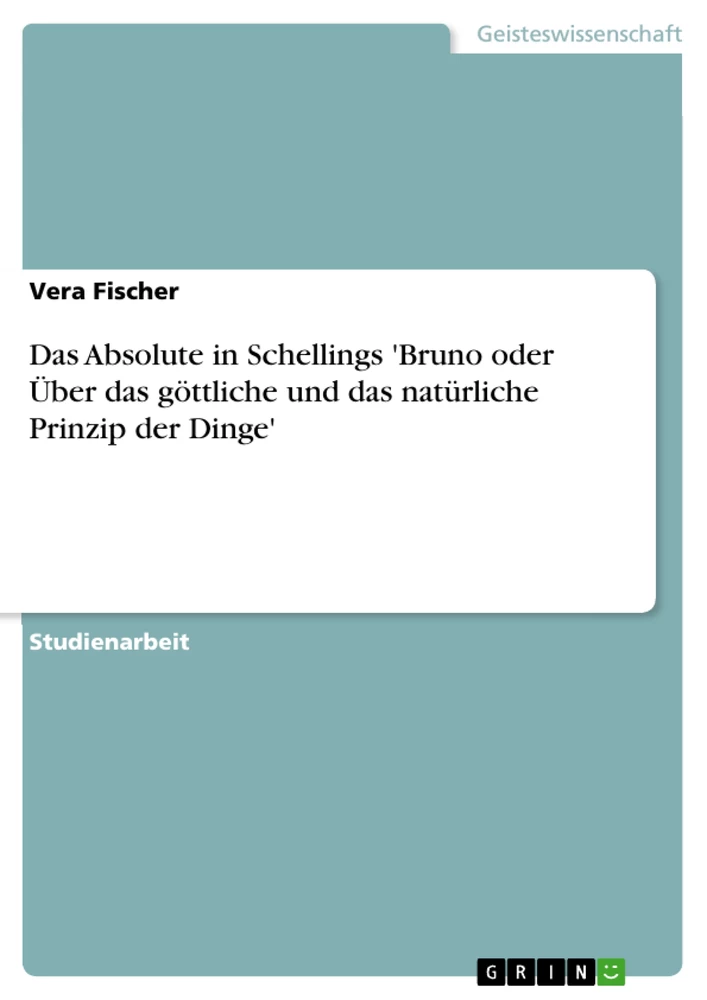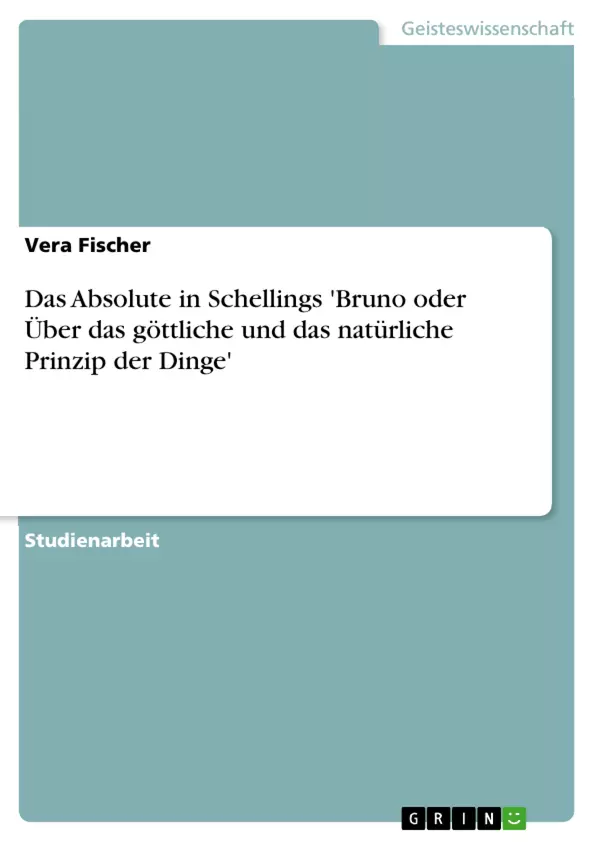Zwei Menschen unterhalten sich. Person A fragt Person B: „Ich habe meinem Chef heute gesagt, dass ich beabsichtige zu kündigen. Meinst du das war richtig?“ Person B antwortet: „Das war absolut richtig.“ „Du glaubst also auch, dass es das Richtige war, die Wahrheit zu sagen?“, fragt wieder Person A. „Absolut“ antwortet B.
Das Wort „absolut“ ist ein gern gebrauchtes Fremdwort in der deutschen Sprache. Etymologisch stammt es vom lateinischen Verb absolvere – loslösen ab. Das DUDEN Fremdwörterbuch sagt, dass etwas „absolut“ sei, das durch nichts beeinträchtigt, gestört oder eingeschränkt ist. Wenn, wie oben im Beispiel, jemand einem anderen also auf „absolute“ Weise zustimmt, dann ist seine Auffassung durch keinen Zweifel beeinträchtigt oder eingeschränkt. Er gibt seine Zustimmung losgelöst von allen möglichen Einwendungen.
Um Absolutes, Ungestörtes, Losgelöstes soll es auch in der vorliegenden Arbeit gehen. Ausgangspunkt ist der Text „Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge“, geschrieben von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling im Jahr 1802. Schelling, geboren 1775 in Leonberg, gestorben im Alter von 79 Jahren in Bad Raggaz, zählt man philosophiegeschichtlich zu den so genannten „Deutschen Idealisten“. In der Tradition Kants stehend, ordnet er sich ein zwischen Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) und G.W.F. Hegel (1770 – 1831).
Die zentrale Fragestellung im Bruno ist die Frage nach dem sog. Absoluten. Das Absolute ist für Schelling, was er die „Einheit von Einheit und Differenz“ nennt. Im Laufe des Dialogs gibt er verschiedene Bestimmungen dieser einen Einheit, welche in dieser Arbeit einzeln nachvollzogen und zueinander in Beziehung gesetzt werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wie kommt es zur Frage nach dem Absoluten?
- 3. Das Absolute als Einheit aller Gegensätze
- 3.1 Das Absolute als Einheit von Denken und Anschauen
- 3.2 Das Absolute als Einheit von Unendlichem und Endlichem
- 3.3 Das Absolute als das Prinzip des Wissens
- 3.4 Das Absolute als der unendliche fruchtbare Keim
- 3.5 Das Absolute und seine verschiedenen Modifikationen
- 3.6 Vom Erkennen des Absoluten
- 4. Versuch einer Gesamtdarstellung des Absoluten
- 5. Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Schellings „Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge“ mit dem Fokus auf das Konzept des Absoluten. Ziel ist es, Schellings verschiedene Bestimmungen des Absoluten nachzuvollziehen und in Beziehung zueinander zu setzen. Die Arbeit analysiert, wie Schelling das Absolute als Einheit von Gegensätzen konzipiert und wie dieser Begriff sich zu anderen philosophischen Positionen verhält.
- Das Absolute als Einheit von Gegensätzen
- Der Übergang vom Absoluten zum Bedingten
- Schellings Auseinandersetzung mit anderen philosophischen Positionen (Materialismus, Idealismus etc.)
- Die Rolle des Dialogformats in Schellings Argumentation
- Der Bezug zu Nikolaus von Kues' „coincidentia oppositorum“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem alltäglichen Beispiel zur Verwendung des Wortes „absolut“, um dann den Fokus auf Schellings „Bruno“ zu lenken. Sie stellt Schelling als deutschen Idealisten vor und situiert „Bruno“ in seinen biographischen und philosophischen Kontext, hervorhebend die Entstehungszeit in Jena und die Zusammenarbeit mit Hegel. Die zentrale Frage nach dem Absoluten wird eingeführt und als leitendes Thema der Arbeit benannt. Die Einleitung legt den Grundstein für die Analyse von Schellings Konzeption des Absoluten, indem sie den historischen und philosophischen Rahmen skizziert. Der Bezug zu Nikolaus von Kues und der Ankündigung der Kapitelstruktur zeigen die methodischen Ansätze der Arbeit.
2. Wie kommt es zur Frage nach dem Absoluten?: Dieses Kapitel analysiert den Weg zur Frage nach dem Absoluten, der durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen philosophischen Positionen und den Grenzen des menschlichen Wissens geprägt ist. Es geht um die Notwendigkeit, über den empirischen Bereich hinauszugehen und nach einer umfassenderen Erklärung der Wirklichkeit zu suchen. Der Leser wird auf die zentralen Fragen vorbereitet und der philosophische Hintergrund für das Verständnis des Absoluten gelegt. Dieses Kapitel dient somit als Brücke zwischen der Einleitung und der eingehenden Auseinandersetzung mit Schellings Konzept des Absoluten in den folgenden Kapiteln.
3. Das Absolute als Einheit aller Gegensätze: Dieses umfangreiche Kapitel erörtert Schellings vielschichtige Konzeption des Absoluten als Einheit von Gegensätzen. Es werden verschiedene Facetten des Absoluten beleuchtet, wie zum Beispiel die Einheit von Denken und Anschauen, Unendlichem und Endlichem, sowie die Beziehung des Absoluten zum Wissen. Das Kapitel untersucht, wie diese scheinbaren Widersprüche im Absoluten aufgehoben werden und wie sich daraus ein umfassendes Weltbild ergibt. Die verschiedenen Unterkapitel beleuchten das Absolute aus unterschiedlichen Perspektiven, welche schließlich in einem zusammenhängenden Bild münden. Der Bezug zu anderen Denkern, vor allem zu Nikolaus von Kues, wird hergestellt und differenziert.
4. Versuch einer Gesamtdarstellung des Absoluten: Dieses Kapitel versucht, die verschiedenen Aspekte des Absoluten, die in den vorherigen Kapiteln behandelt wurden, zu einem kohärenten Ganzen zusammenzufügen. Es präsentiert eine Synthese von Schellings Gedanken zum Absoluten und versucht, ein umfassendes Bild seiner Philosophie zu zeichnen. Hier wird versucht, die verschiedenen Facetten des Absoluten zu integrieren und die Konsequenzen dieser philosophischen Konzeption aufzuzeigen. Es dient als Zusammenfassung und Synthese der vorherigen Kapitel, bereitet aber auch den Weg zum Schlusskapitel.
Schlüsselwörter
Schelling, Absolut, Einheit der Gegensätze, coincidentia oppositorum, Deutscher Idealismus, Bruno, Denken und Anschauen, Unendliches und Endliches, Philosophiegeschichte, Materialismus, Idealismus, Metaphysik.
Häufig gestellte Fragen zu Schellings "Bruno"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schellings Werk "Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge" mit Schwerpunkt auf seinem Konzept des Absoluten. Sie untersucht Schellings verschiedene Definitionen des Absoluten, setzt diese zueinander in Beziehung und analysiert, wie Schelling das Absolute als Einheit von Gegensätzen versteht. Die Arbeit beleuchtet den Bezug zu anderen philosophischen Positionen und untersucht die Rolle des Dialogformats in Schellings Argumentation. Sie beinhaltet eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, die Zielsetzung und die wichtigsten Themen, sowie ein abschließendes Nachwort und Schlüsselbegriffe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung; 2. Wie kommt es zur Frage nach dem Absoluten?; 3. Das Absolute als Einheit aller Gegensätze (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Facetten des Absoluten); 4. Versuch einer Gesamtdarstellung des Absoluten; und 5. Nachwort.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist das Verständnis von Schellings Konzept des Absoluten. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Schellings verschiedene Bestimmungen des Absoluten nachzuvollziehen und in ihren Beziehungen zueinander zu analysieren.
Wie wird das Absolute bei Schelling konzipiert?
Schelling konzipiert das Absolute als Einheit von Gegensätzen. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte dieser Einheit, darunter die Einheit von Denken und Anschauen, Unendlichem und Endlichem, und die Beziehung des Absoluten zum Wissen. Es wird analysiert, wie scheinbare Widersprüche im Absoluten aufgehoben werden und wie daraus ein umfassendes Weltbild entsteht.
Welche philosophischen Positionen werden behandelt?
Die Arbeit setzt sich mit Schellings Konzept des Absoluten im Kontext anderer philosophischer Positionen auseinander, darunter Materialismus und Idealismus. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich mit Nikolaus von Kues' "coincidentia oppositorum".
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine interpretative und analytische Methode. Sie analysiert Schellings Text, setzt seine Argumentation in den philosophischen Kontext und untersucht die Beziehungen zwischen den verschiedenen Aspekten seines Konzepts des Absoluten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schelling, Absolut, Einheit der Gegensätze, coincidentia oppositorum, Deutscher Idealismus, Bruno, Denken und Anschauen, Unendliches und Endliches, Philosophiegeschichte, Materialismus, Idealismus, Metaphysik.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser bestimmt, die sich für Schellings Philosophie, den Deutschen Idealismus und die Metaphysik interessieren. Sie eignet sich besonders für Studierende und Wissenschaftler im Bereich der Philosophie.
Wo wird der Bezug zu Nikolaus von Kues hergestellt?
Der Bezug zu Nikolaus von Kues und seinem Konzept der "coincidentia oppositorum" wird an mehreren Stellen der Arbeit hergestellt. Dies geschieht sowohl im Kontext der Einleitung, als auch in der eingehenden Analyse von Schellings Konzept des Absoluten als Einheit von Gegensätzen. Die Arbeit differenziert und vergleicht die jeweiligen Konzepte.
Welche Rolle spielt das Dialogformat in Schellings Argumentation?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Dialogformats in Schellings Argumentation in "Bruno" und analysiert, wie dieses Format zu seinem Verständnis des Absoluten beiträgt.
- Quote paper
- Vera Fischer (Author), 2006, Das Absolute in Schellings 'Bruno oder Über das göttliche und das natürliche Prinzip der Dinge', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60359