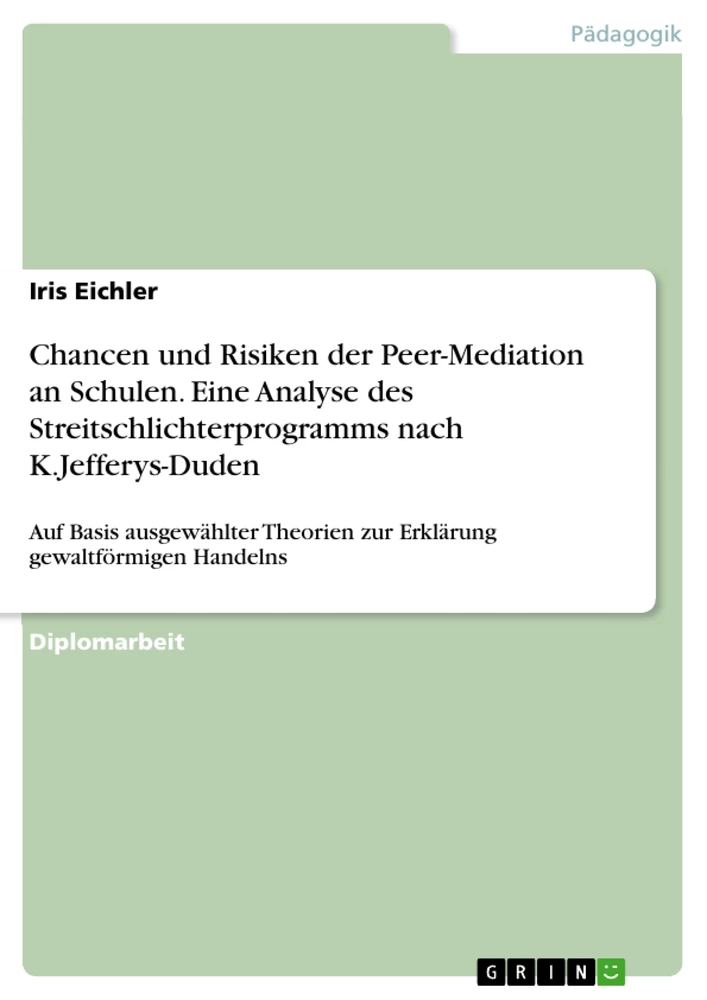Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: in einen theoretischen Teil, der sich der Definition der grundlegenden Begriffe und einigen ausgewählten Theorien zur Erklärung gewaltförmigen Handelns widmet sowie einen kurzen Einblick in den Gegenstand der Gewaltprävention gewährt, einen zweiten Teil, der sich mit dem Verfahren der Peer-Mediation anhand des eines konkreten Beispiel auseinandersetzt und einen letzten Teil, der Bezüge zwischen der Peer-Mediation und den im ersten Teil erläuterten theoretischen Annahmen herstellt und darauf basierend die Möglichkeiten und eventuellen Risiken des Mediationsverfahrens offen legt. Der erste Teil dient der Einführung in verschiedene Perspektiven bezüglich der Ursachenbestimmung gewaltförmigen Verhaltens. Als Ausgangsbasis hierfür wird der Versuch einer detaillierten Bestimmung des Gewaltbegriffs unternommen (Kapitel 2) und weitere für diese Arbeit relevante Begriffe erläutert. Im Anschluss daran werden ausgewählte psychologische Theorieansätze zur Erklärung gewaltförmigen Verhaltens - das psychoanalytische Modell, die Frustrations-Aggressions-Hypothese, der lerntheoretische und der entwicklungspsychologische Ansatz -, außerdem soziologische Theorieansätzeder Subkulturansatz und die Modernisierungs- und Individualisierungstheorie - sowie integrative Modelle - der schulbezogene sozialökologische und der sozialisationstheoretische Ansatz - unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung für den schulischen Kontext erörtert (Kapitel 3). Das dritte Kapitel beinhaltet zudem zwei Exkurse, die für die konkrete Fragestellung dieser Arbeit zwar weniger relevant sind, aber dennoch zur Erklärung der Entstehungsbedingungen von Gewalt beitragen können und daher nicht unbeachtet bleiben (Kapitel 3.1.2 und Kapitel 3.3.3). Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Ge-genstand der Gewaltprävention und ihren unterschiedlichen Ausprägungen und Zielen. Der konkrete Einsatz von gewaltpräventiven Maßnahmen wird anhand ausgewählter schulischer Programme gezeigt (Kapitel 4). Der zweite Teil dieser Arbeit widmet sich dem spezifischen schulischen und gewaltpräventiv orientierten Konfliktregelungsmodell der Peer-Mediation. Dazu werden zunächst die konzeptionelle Gestaltung der Mediation und die ihr zugrunde liegenden Prämissen, Ziele und Bedingungen sowie die Möglichkeit der Übertragbarkeit auf den schulischen Kontext erläutert (Kapitel 5). [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in die Thematik
- 1.2 Fragestellung und Anliegen der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Implikationen des Gewaltbegriffs
- 2.1 Zum Begriff der Aggression
- 2.2 Personale Gewalt
- 2.2.1 Physische Elemente personaler Gewalt
- 2.2.2 Psychische Elemente personaler Gewalt
- 2.2.3 Expressive und instrumentelle Gewalt
- 2.3 Strukturelle und institutionelle Gewalt
- 2.4 Sozialkonflikte
- 2.4.1 Interpersonale und intrapersonale Konflikte
- 2.4.2 Destruktive und konstruktive Konfliktaustragung
- 2.5 Gewalt und Aggression – eine Abgrenzung der Begriffe
- 3. Theoretische Ansätze zur Erklärung gewaltförmigen Handelns
- 3.1 Psychologisch orientierte Ansätze
- 3.1.1 Der psychoanalytische Ansatz
- 3.1.2 Exkurs: Der Einfluss von Erziehungsstilen auf die Genese der Aggression
- 3.1.3 Die Frustrations-Aggressions-Theorie
- 3.1.4 Der lerntheoretische Ansatz
- 3.1.5 Der entwicklungspsychologische Ansatz
- 3.2 Soziologisch orientierte Ansätze
- 3.2.1 Die Subkulturtheorie
- 3.2.2 Sozio-ökonomische Begründungszusammenhänge
- 3.3 Integrativ orientierte Ansätze
- 3.3.1 Der sozialökologische Ansatz
- 3.3.2 Der sozialisationstheoretische Ansatz
- 3.3.3 Exkurs: Der Einfluss der Medien
- 4. Schulische Gewaltprävention
- 4.1 Gegenstand und Ziele der Gewaltprävention
- 4.2 Darstellung ausgewählter Gewaltpräventionsprogramme
- 4.2.1 Das Sozialtraining in der Schule
- 4.2.2 Das Konflikttraining nach Gordon
- 4.2.3 Das Olweus-Programm
- 4.2.4 Der Täter-Opfer-Ausgleich
- 5. Mediation
- 5.1 Mediation als Konfliktregelungsverfahren
- 5.2 Gegenstand der Peer-Mediation
- 5.3 Methodischer Ansatz des Mediationsverfahrens
- 5.3.1 Techniken der Peer-Mediation
- 5.3.2 Schritte des Mediationsverfahrens
- 5.3.3 Die Rolle des Mediators
- 5.3.4 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Mediation
- 6. Peer-Mediation am Beispiel des Streitschlichterprogramms nach K. Jefferys-Duden
- 6.1 Konzeptioneller Ansatz
- 6.2 Methodische Schritte des Streitschlichterprogramms
- 6.2.1 Unterrichtseinheit 1: Begründung und Einstieg
- 6.2.2 Unterrichtseinheit 2: Konfliktverhalten
- 6.2.3 Unterrichtseinheit 3: Konflikte aushandeln
- 6.2.4 Unterrichtseinheit 4: Streitschlichtung
- 7. Kritische Würdigung der Peer-Mediation auf der Basis der vorgestellten Theorien zur Erklärung gewaltförmigen Handelns
- 7.1 Bezüge der Peer-Mediation zu den theoretischen Ansätzen zur Erklärung gewaltförmigen Handelns
- 7.1.1 Peer-Mediation und der psychoanalytische Ansatz
- 7.1.2 Peer-Mediation und die Frustrations-Aggressions-Theorie
- 7.1.3 Peer-Mediation und die lerntheoretische Ansatz
- 7.1.4 Peer-Mediation und der entwicklungspsychologische Ansatz
- 7.1.5 Peer-Mediation und die Subkulturtheorie
- 7.1.6 Peer-Mediation und sozio-ökonomische Begründungszusammenhänge
- 7.1.7 Peer-Mediation und der sozialökologische Ansatz
- 7.1.8 Peer-Mediation und der sozialisationstheoretische Ansatz
- 7.1.9 Zusammenfassung: Bezüge der Peer-Mediation zu den theoretischen Ansätzen zur Entstehung gewaltförmigen Handelns
- 7.2 Chancen und Risiken der Peer-Mediation
- 7.2.1 Möglichkeiten der Peer-Mediation
- 7.2.2 Grenzen der Peer-Mediation
- 7.3 Peer-Mediation an Schulen – eine Bilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Chancen und Risiken von Peer-Mediation an Schulen anhand des Streitschlichterprogramms nach K. Jefferys-Duden. Ziel ist es, die Wirksamkeit dieses Ansatzes im Kontext verschiedener Theorien zur Erklärung gewaltförmigen Handelns zu untersuchen.
- Gewaltbegriff und seine Implikationen
- Theoretische Ansätze zur Erklärung gewaltförmigen Handelns (psychologisch, soziologisch, integrativ)
- Gewaltprävention an Schulen
- Mediation als Konfliktregelungsverfahren
- Peer-Mediation nach Jefferys-Duden: Konzeption und methodische Schritte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Peer-Mediation an Schulen ein, definiert die Fragestellung der Arbeit und beschreibt den Aufbau der folgenden Kapitel. Sie skizziert den Fokus auf das Streitschlichterprogramm nach Jefferys-Duden und dessen Einbettung in relevante Theorien zu Gewalt und Aggression.
2. Implikationen des Gewaltbegriffs: Dieses Kapitel analysiert den Gewaltbegriff umfassend, differenziert zwischen Aggression, personaler, struktureller und institutioneller Gewalt, sowie zwischen inter- und intrapersonalen Konflikten und deren konstruktiver bzw. destruktiver Austragung. Es liefert eine klare Abgrenzung zwischen Gewalt und Aggression und bildet die Grundlage für das Verständnis der folgenden theoretischen Ansätze.
3. Theoretische Ansätze zur Erklärung gewaltförmigen Handelns: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene psychologische, soziologische und integrative Ansätze zur Erklärung gewaltförmigen Handelns. Es werden der psychoanalytische Ansatz, die Frustrations-Aggressions-Theorie, der lerntheoretische Ansatz, der entwicklungspsychologische Ansatz, die Subkulturtheorie, sozio-ökonomische Faktoren, der sozialökologische Ansatz und der sozialisationstheoretische Ansatz detailliert erläutert und in ihren jeweiligen Erklärungsansätzen verglichen. Der Einfluss von Erziehungsstilen und Medien wird ebenfalls berücksichtigt.
4. Schulische Gewaltprävention: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Gegenstand und den Zielen schulischer Gewaltprävention. Es werden ausgewählte Gewaltpräventionsprogramme wie Sozialtraining, Konflikttraining nach Gordon, das Olweus-Programm und der Täter-Opfer-Ausgleich vorgestellt und ihre jeweiligen Strategien und Ansätze zur Gewaltprävention beschrieben. Die Kapitel unterstreicht die Bedeutung präventiver Maßnahmen im schulischen Kontext.
5. Mediation: Dieses Kapitel definiert Mediation als Konfliktregelungsverfahren und beschreibt den Gegenstand der Peer-Mediation im Detail. Es erläutert den methodischen Ansatz, die Techniken, die Schritte des Mediationsverfahrens, die Rolle des Mediators und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Mediation. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse des Streitschlichterprogramms.
6. Peer-Mediation am Beispiel des Streitschlichterprogramms nach K. Jefferys-Duden: Dieses Kapitel beschreibt den konzeptionellen Ansatz und die methodischen Schritte des Streitschlichterprogramms nach K. Jefferys-Duden. Es analysiert die einzelnen Unterrichtseinheiten und deren Zielsetzungen, um den praktischen Ablauf und die didaktischen Prinzipien des Programms zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der praktischen Umsetzung des Peer-Mediations-Ansatzes.
Schlüsselwörter
Peer-Mediation, Gewaltprävention, Schule, Konfliktlösung, Mediation, Jefferys-Duden, Aggression, Gewalt, Theorien gewaltförmigen Handelns, Sozialisation, Sozialökologie, Konflikttraining.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Peer-Mediation an Schulen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Chancen und Risiken von Peer-Mediation an Schulen, insbesondere anhand des Streitschlichterprogramms nach K. Jefferys-Duden. Sie untersucht die Wirksamkeit dieses Ansatzes im Kontext verschiedener Theorien zur Erklärung gewaltförmigen Handelns.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Gewaltbegriff und seine Implikationen (Aggression, personale, strukturelle und institutionelle Gewalt, Konflikte), theoretische Ansätze zur Erklärung gewaltförmigen Handelns (psychologische, soziologische und integrative Ansätze), Gewaltprävention an Schulen, Mediation als Konfliktregelungsverfahren, und detailliert die Peer-Mediation nach Jefferys-Duden (Konzeption und methodische Schritte).
Welche theoretischen Ansätze werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene psychologische Ansätze (psychoanalytischer Ansatz, Frustrations-Aggressions-Theorie, lerntheoretischer Ansatz, entwicklungspsychologischer Ansatz), soziologische Ansätze (Subkulturtheorie, sozio-ökonomische Faktoren) und integrative Ansätze (sozialökologischer Ansatz, sozialisationstheoretischer Ansatz). Der Einfluss von Erziehungsstilen und Medien wird ebenfalls diskutiert.
Welche Gewaltpräventionsprogramme werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Gewaltpräventionsprogramme vor, darunter Sozialtraining in der Schule, Konflikttraining nach Gordon, das Olweus-Programm und den Täter-Opfer-Ausgleich. Ihre Strategien und Ansätze zur Gewaltprävention werden beschrieben.
Wie wird Mediation definiert und dargestellt?
Mediation wird als Konfliktregelungsverfahren definiert. Die Arbeit beschreibt detailliert die Peer-Mediation, ihren methodischen Ansatz, Techniken, Schritte des Verfahrens, die Rolle des Mediators und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Mediation.
Wie wird das Streitschlichterprogramm nach Jefferys-Duden dargestellt?
Das Streitschlichterprogramm nach K. Jefferys-Duden wird in Bezug auf seinen konzeptionellen Ansatz und seine methodischen Schritte (unterteilt in Unterrichtseinheiten) detailliert beschrieben. Der praktische Ablauf und die didaktischen Prinzipien des Programms werden erläutert.
Wie wird die Peer-Mediation kritisch gewürdigt?
Die Arbeit würdigt die Peer-Mediation kritisch, indem sie Bezüge zur Entstehung gewaltförmigen Handelns herstellt (Bezüge zu den zuvor vorgestellten Theorien). Sie analysiert die Chancen und Risiken der Peer-Mediation und zieht eine Bilanz ihrer Anwendung an Schulen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Peer-Mediation, Gewaltprävention, Schule, Konfliktlösung, Mediation, Jefferys-Duden, Aggression, Gewalt, Theorien gewaltförmigen Handelns, Sozialisation, Sozialökologie, Konflikttraining.
Welches ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist es, die Wirksamkeit des Streitschlichterprogramms nach Jefferys-Duden im Kontext verschiedener Theorien zur Erklärung gewaltförmigen Handelns zu untersuchen und die Chancen und Risiken dieses Ansatzes zu analysieren.
- Quote paper
- Iris Eichler (Author), 2006, Chancen und Risiken der Peer-Mediation an Schulen. Eine Analyse des Streitschlichterprogramms nach K.Jefferys-Duden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60509