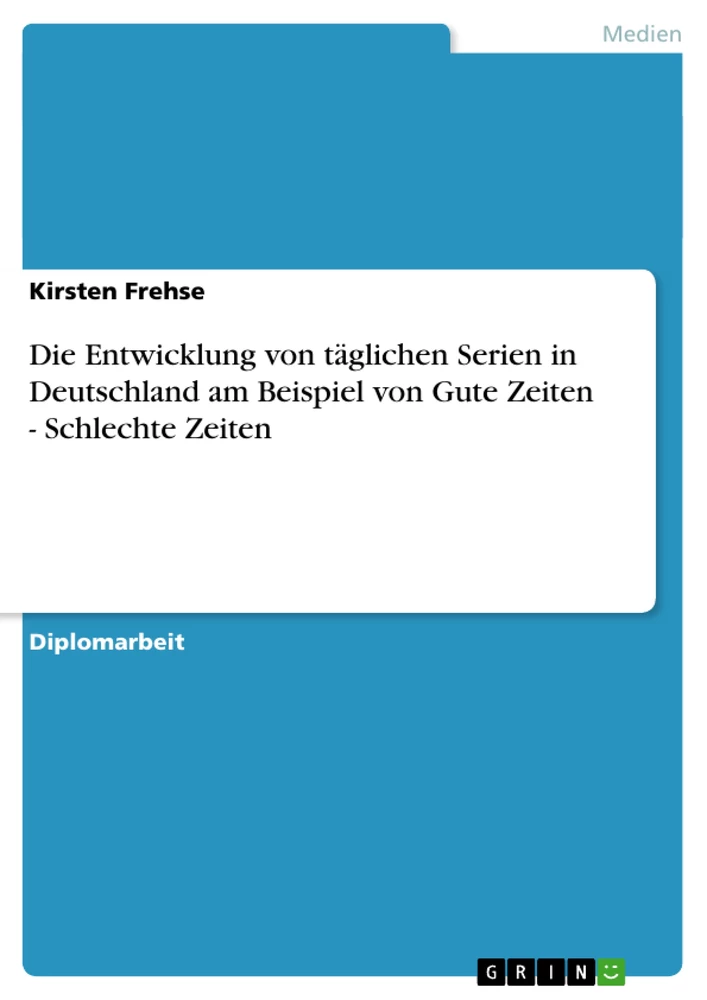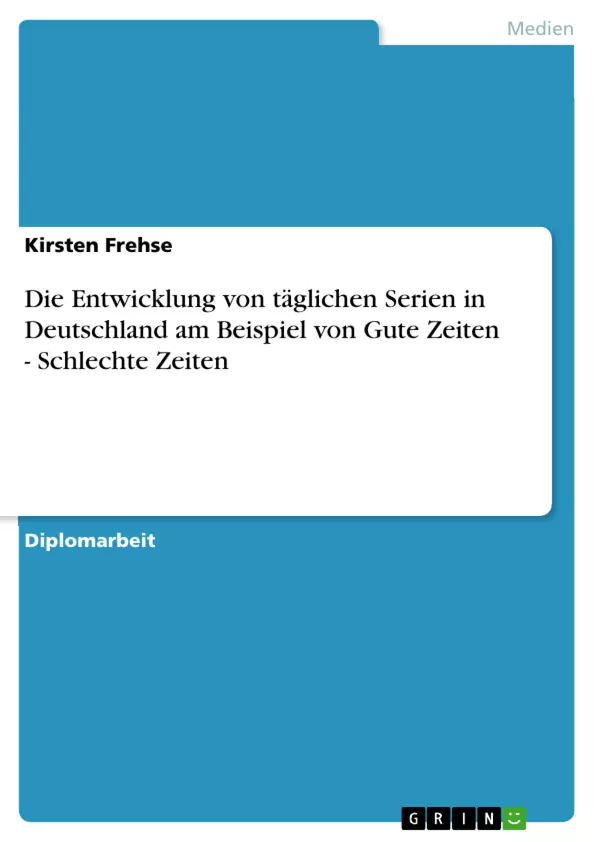In Amerika bereits seit den 50er Jahren bekannt, hat die Produktion von täglichen Serien in Deutschland noch keine lange Tradition. Nachdem der private Fernsehsender RTL im Mai 1992 mit der ersten deutschen Eigenproduktion "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" auf Sendung ging, verhielten sich andere Fernsehsender bis in die jüngste Zeit in dieser Sparte eher zurückhaltend. Erst der in nun fast drei Jahren Produktion stetig gestiegene Erfolg des Versuchsballons "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" mit einer Einschaltquote von inzwischen vier bis fünf Millionen Zuschauern täglich, führt neuerdings zu einem wahren Boom in der Herstellung von "Daily Soaps" auch hierzulande. So wurden im März 1995 bereits sechs in Deutschland produzierte tägliche Serien ausgestrahlt.
Diese Entwicklung läßt es lohnend erscheinen, das Phänomen "Daily Soap" genauer zu untersuchen.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird auf die historische Entwicklung von täglichen Serien eingegangen. Mangels einer deutschen Tradition der Produktion täglicher Serien soll dabei insbesondere auf die Entwicklungen im Ausland eingegangen werden.
Im zweiten Teil dieser Arbeit soll die technische Seite der Produktion täglicher Serien dargestellt werden. Mit der Produktion der "Daily Soaps" sind spezifische Schwierigkeiten und Eigenarten verbunden, die sich im gesamten Produktionsapparat niederschlagen. Deren Darstellung soll besondere Berücksichtigung erfahren. In diesem Teil sollen auch verstärkt Beispiele aus der Produktion der Serie "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" einfließen, bei der die Verfasserin der vorliegenden Arbeit für 16 Monaten als Produktionsassistentin und Aufnahmeleiterin am Außendrehort mitgewirkt hat.
Der letzte Teil der Arbeit soll sich mit den inhaltlichen Einschränkungen bei täglichen Serien beschäftigen. In diesem Teil soll aufgezeigt werden, welche Einflüsse auf den Inhalt unter Berücksichtigung der Faktoren Zeit und Kosten ausgeübt werden. Die Komplexität der Anforderungen und Einschränkungen in Hinblick auf die Inhalte einer täglichen Serie wird anhand einiger Beispiele deutlich gemacht.
Im Verlauf der Arbeit soll aufgezeigt werden, daß sich klassische Produktionsmethoden nur sehr eingeschränkt auf die Produktion täglicher Serien übertragen lassen. Es ist jedoch nicht Ziel der Arbeit, Unterschiede zu herkömmlichen Spielfilmproduktionen aufzuzeigen. Der Schwerpunkt soll stattdessen darauf liegen, die Besonderheiten der zu untersuchenden Produktionsart zusammenzustellen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil 1: Historische Entwicklung der täglichen Serien
- I. Entwicklungsgeschichte
- II. Entwicklung von täglichen Serien im Ausland
- III. Entwicklung von täglichen Serien in Deutschland
- IV. Entstehungsgeschichte der Serie „Gute Zeiten - schlechte Zeiten“
- V. Ausblick in die Zukunft
- Teil 2: Produktion von täglichen Serien
- I. Einführung und Problemstellung
- I.1. Zeitfaktor
- I.2. Kostenfaktor
- I.3. Inhalte
- I.4. Verhältnismäßigkeiten Kosten, Zeit und Inhalt
- I.4.1. Zeitliche Komponente
- I.4.2. Inhaltliche Komponente
- I.4.3. Finanzielle Komponente
- I.4.4. Personalpolitik
- II. Planung und Logistik
- III. Ablauf der Dreharbeiten
- IV. Einzelne Organisationseinheiten
- IV.1. Erstellung der Storylines
- IV.2. Erstellung der Dialogbücher
- IV.3. Script-Editoren
- IV.4. Redaktionsassistenz
- IV.5. Regie, Regieassistenz und Script-Continuity
- IV.6. Disponent und Disposition
- IV.7. Aufnahmeleitung Außendreh
- IV.8. Produktionsleitung
- IV.9. Aufgabenbereiche des Producers
- V. Kosten
- VI. Zusammenfassung der Zwischenergebnisse
- I. Einführung und Problemstellung
- Teil 3: Erzählerische Einschränkungen bei täglichen Serien
- I. Einführung und Problemstellung
- II. Kostenabhängige Inhalte und deren Darstellungsform
- II.1. Außendreh
- II.2. Innendreh
- II.3. Ergebnis
- III. Zeitabhängige Inhalte und deren Darstellungsform
- III.1. Außendreh
- III.2. Innendreh
- III.3. Ergebnis
- IV. Kosten- und zeitunabhängige Inhalte
- IV.1. Außendreh
- IV.2. Innendreh
- IV.3. Ergebnis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Entwicklung und Produktion täglicher Serien in Deutschland, am Beispiel von „Gute Zeiten - schlechte Zeiten“. Ziel ist es, die komplexen Produktionsabläufe und die damit verbundenen erzählerischen Einschränkungen zu analysieren.
- Historische Entwicklung der täglichen Serie
- Produktionsabläufe und -logistik
- Einfluss von Kosten und Zeit auf die Inhalte
- Erzählerische Möglichkeiten und Grenzen
- Fallstudie „Gute Zeiten - schlechte Zeiten“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung sowie die Methodik der Untersuchung. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentrale Fragestellung bezüglich der Entwicklung und Produktion täglicher Serien in Deutschland, insbesondere im Kontext von „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“.
Teil 1: Historische Entwicklung der täglichen Serien: Dieser Teil beleuchtet die historische Entwicklung von täglichen Serien, beginnend mit ihren Ursprüngen und ihrer Entwicklung im Ausland. Es wird ein umfassender Überblick über die Genese dieses Fernsehformats gegeben und die spezifischen Entwicklungen in Deutschland detailliert beschrieben. Die Entstehungsgeschichte von „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ wird im Detail dargestellt, einschließlich der relevanten Faktoren und Einflüsse, die zu ihrem Erfolg und ihrer spezifischen Ausgestaltung geführt haben. Schließlich wird ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Genres gegeben, wobei Trends und Herausforderungen diskutiert werden.
Teil 2: Produktion von täglichen Serien: Dieser Teil analysiert die Produktion täglicher Serien. Er beginnt mit einer Einführung in die Problematik der Produktion, wobei der Fokus auf dem komplexen Zusammenspiel von Zeit, Kosten und inhaltlichen Vorgaben liegt. Die detaillierte Beschreibung der Planung und Logistik, des Ablaufs der Dreharbeiten und der jeweiligen Aufgaben verschiedener Organisationseinheiten (von der Storyline-Erstellung bis zur Produktionsleitung) gibt einen umfassenden Einblick in den Produktionsprozess. Es wird auf die Kostenfaktoren eingegangen und die Zwischenergebnisse werden zusammengefasst, um einen ganzheitlichen Überblick über die Produktion von täglichen Serien zu ermöglichen.
Teil 3: Erzählerische Einschränkungen bei täglichen Serien: Dieser Teil befasst sich mit den erzählerischen Einschränkungen, die durch die Produktionsbedingungen von täglichen Serien entstehen. Die Analyse konzentriert sich auf die Abhängigkeit der Inhalte von Kosten und Zeitfaktoren, sowohl bei Außen- als auch bei Innendrehs. Dabei werden konkrete Beispiele herangezogen, um die Auswirkungen dieser Einschränkungen auf die Gestaltung der Handlung und die erzählerische Gestaltung zu verdeutlichen. Die Untersuchung differenziert zwischen kosten- und zeitabhängigen sowie -unabhängigen Inhalten und wertet die Ergebnisse aus, um die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Erzählgestaltung in diesem Format zu belegen.
Schlüsselwörter
Tägliche Serien, Fernsehproduktion, „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“, Produktionsablauf, Kostenfaktoren, Zeitfaktoren, Erzählstrukturen, Genrekonventionen, deutsche Fernsehgeschichte, Medienökonomie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Entwicklung und Produktion täglicher Serien am Beispiel von „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Entwicklung und Produktion täglicher Serien in Deutschland, insbesondere am Beispiel der Serie „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“. Der Fokus liegt auf der Analyse der komplexen Produktionsabläufe und der daraus resultierenden erzählerischen Einschränkungen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung täglicher Serien (national und international), die detaillierte Produktionslogistik (Planung, Dreharbeiten, Organisationseinheiten), den Einfluss von Kosten und Zeitfaktoren auf die Inhalte und die daraus resultierenden erzählerischen Möglichkeiten und Grenzen. Eine Fallstudie zu „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ veranschaulicht die theoretischen Erkenntnisse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Teil 1 behandelt die historische Entwicklung täglicher Serien, einschließlich der Entstehungsgeschichte von „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“. Teil 2 analysiert die Produktionsprozesse, von der Planung bis zur Kostenrechnung. Teil 3 konzentriert sich auf die erzählerischen Einschränkungen, die durch Kosten und Zeitfaktoren entstehen. Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und endet mit einer Zusammenfassung und Schlüsselwörtern.
Welche konkreten Produktionsaspekte werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet detailliert die Planung und Logistik der Produktion, den Ablauf der Dreharbeiten (Außendreh und Innendreh) und die Aufgaben verschiedener Organisationseinheiten, wie z.B. Storyline-Erstellung, Dialogbuchschreibung, Regie, Produktionsleitung etc. Es werden auch die Kostenfaktoren im Detail analysiert.
Wie werden die erzählerischen Einschränkungen dargestellt?
Die Arbeit analysiert, wie Kosten und Zeitfaktoren die Inhalte und deren Darstellungsform beeinflussen. Es wird unterschieden zwischen kosten- und zeitabhängigen sowie -unabhängigen Inhalten, wobei die Auswirkungen auf die Handlungsführung und die erzählerische Gestaltung anhand von Beispielen verdeutlicht werden.
Welche Bedeutung hat die Serie „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ für die Arbeit?
„Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ dient als Fallstudie, um die theoretischen Erkenntnisse der Arbeit zu veranschaulichen und zu konkretisieren. Ihre Entstehungsgeschichte und ihre Produktionsprozesse werden detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Tägliche Serien, Fernsehproduktion, „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“, Produktionsablauf, Kostenfaktoren, Zeitfaktoren, Erzählstrukturen, Genrekonventionen, deutsche Fernsehgeschichte, Medienökonomie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Produktionsabläufe und die damit verbundenen erzählerischen Einschränkungen täglicher Serien zu analysieren und zu verstehen. Sie liefert einen umfassenden Überblick über die Entwicklung und Produktion dieses Fernsehformats in Deutschland.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Medienwissenschaften, Filmwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und anderer verwandter Disziplinen, sowie für alle, die sich für die Produktion und die erzählerischen Strukturen von Fernsehserien interessieren.
- Citation du texte
- Kirsten Frehse (Auteur), 1995, Die Entwicklung von täglichen Serien in Deutschland am Beispiel von Gute Zeiten - Schlechte Zeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6056