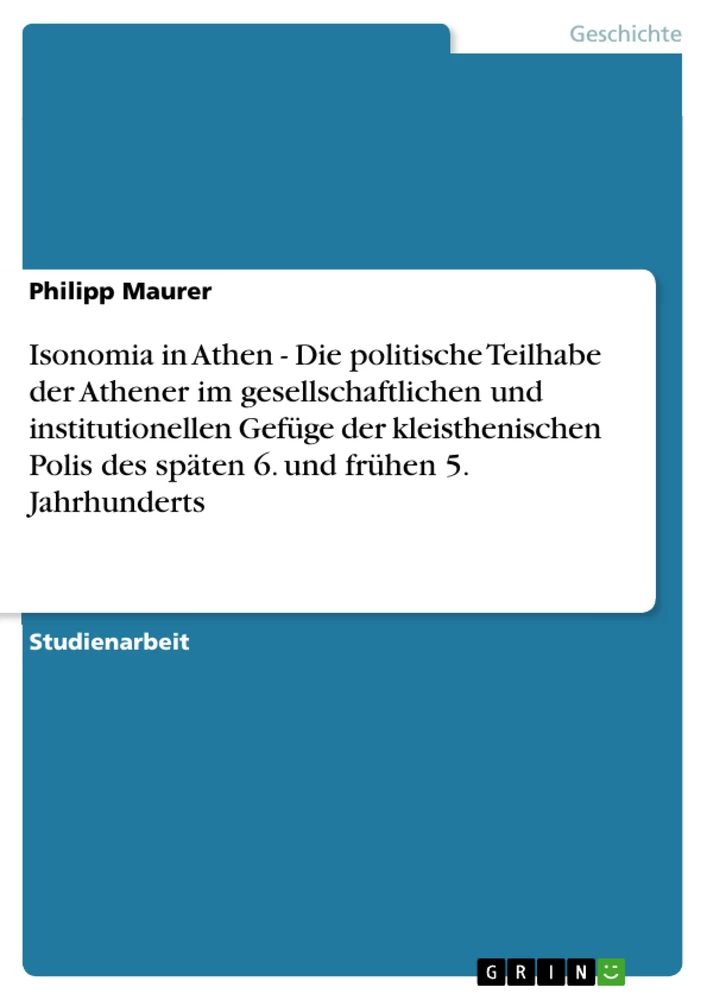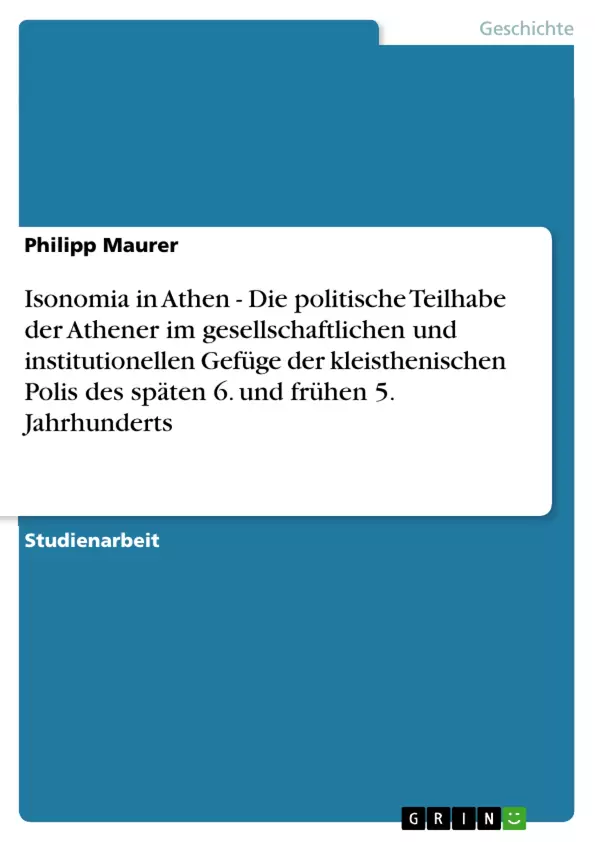Es erschien mir zweckmäßig, den inhaltlichen Aufbau meiner Untersuchung an der triadischen Struktur der kleisthenischen Reform zu orientieren. Beginnend mit den kleinsten politischen Einheiten, den Demen und den sich auf dieser Ebene befindenden politischen Institutionen, über das System der Trittyen bis hin zu den Phylen sollen die einzelnen Bereiche politischen Handelns in der Optik ihrer Repräsentationspotentiale betrachtet werden. Diese Perspektive vereint die institutionalisierten Knotenpunkte politischer Kommunikation, als auch die sozialgeschichtlichen Hintergründe, wie etwa wirtschaftliche Abhängigkeiten oder Formen politischer Ungleichheit, die auf bestimmte Entscheidungsprozesse eingewirkt haben könnten. Im letzten Kapitel werden die Einzelergebnisse der vorangegangenen Abschnitte gleichsam aufgegriffen und zu einer abschließenden Beurteilung geformt. Wenn ich von Repräsentation spreche, meine ich das Verhältnis der politischen Macht einzelner und den institutionellen Formen und politischen Strukturen, die diese Macht an die Gemeinschaft aller politisch Berechtigten zurück binden. Mich interessiert, wer an welchen Entscheidungen beteiligt war, welche Möglichkeiten der politischen Einflussnahme sich welchen Bevölkerungsgruppen, in welchem Umfang boten. Neben dem Modus der Machtverteilung bzw. der Mandatsvergabe und ihrer Kontrolle, soll es um die institutionellen Strukturen des kleisthenischen Staates und vor allem um die Frage gehen, wie es in dem, in geographischer Hinsicht, vergleichsweise großen Staat gelang, Bevölkerungsgruppen aus den verschiedenen Regionen des Landes unter dem Gesichtspunkt der politischen Gleichheit an der Machtausübung und politischen Entscheidungsbildung zu beteiligen. Die politische Gleichheit, bereits in kleisthenischer Zeit fassbar im Begriff der Isonomia, wurde in jüngerer Zeit immer wieder gebraucht, um die kleisthenische Ordnung zu charakterisieren. Es wird zu fragen sein, in wie weit diese Begrifflichkeit angemessen sein kann, mit Blick auf die politische Praxis des 6. und 5. Jahrhunderts .
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- 1.0 Der Aufbau des kleisthenischen Staates
- 2.0 Der Demos
- 2.1 Wirtschaftliche Strukturen des Demos
- 2.2 Demenversammlung
- 2.3 Wahl und Losung
- 2.4 Beamte und Ämter im Demos
- 2.5 Der Demarchos
- 3.0 Die Trittye
- 4.0 Die Phyle
- 4.1 Boule
- 4.2 Ekklesia
- 5.0 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die politische Teilhabe der Athener im kleisthenischen Staat des späten 6. und frühen 5. Jahrhunderts v. Chr. Im Fokus steht dabei das Repräsentationspotenzial der einzelnen Institutionen des attischen Staates und die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungen.
- Der Aufbau und die Struktur des kleisthenischen Staatsgebildes
- Die Rolle der Demen, Trittyen und Phylen im politischen System
- Die Bedeutung des Begriffs der Isonomia für die politische Gleichheit in Athen
- Die Mechanismen der politischen Teilhabe und Einflussnahme der Athener
- Die politische Praxis des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. in Athen
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorbemerkung: Die Einleitung liefert einen historischen Kontext für die kleisthenische Reform, skizziert die Vorgeschichte und die Herausforderungen, die zu ihrer Entstehung führten.
- 1.0 Der Aufbau des kleisthenischen Staates: Dieses Kapitel beschreibt die wichtigsten Strukturen des kleisthenischen Staatsgebildes und setzt die Reform in den Kontext der vorangegangenen politischen Strukturen.
- 2.0 Der Demos: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die kleinste politische Einheit des kleisthenischen Staates, die Demen, und analysiert deren wirtschaftliche Struktur, politische Institutionen, sowie die Rolle von Beamten und Ämtern.
- 3.0 Die Trittye: Dieses Kapitel analysiert die Trittyen, die sich aus mehreren Demen zusammensetzten, und beleuchtet deren Bedeutung im politischen System.
- 4.0 Die Phyle: Dieses Kapitel analysiert die Phylen, die aus drei Trittyen aus unterschiedlichen Regionen Attikas bestanden, und untersucht die Rolle der Boule und der Ekklesia im politischen Prozess.
Schlüsselwörter
Kleisthenische Reform, Athen, Isonomia, politische Teilhabe, Demos, Demen, Trittyen, Phylen, Boule, Ekklesia, Repräsentation, politische Strukturen, politische Praxis, 6. Jahrhundert v. Chr., 5. Jahrhundert v. Chr.
- Citar trabajo
- Philipp Maurer (Autor), 2005, Isonomia in Athen - Die politische Teilhabe der Athener im gesellschaftlichen und institutionellen Gefüge der kleisthenischen Polis des späten 6. und frühen 5. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60606