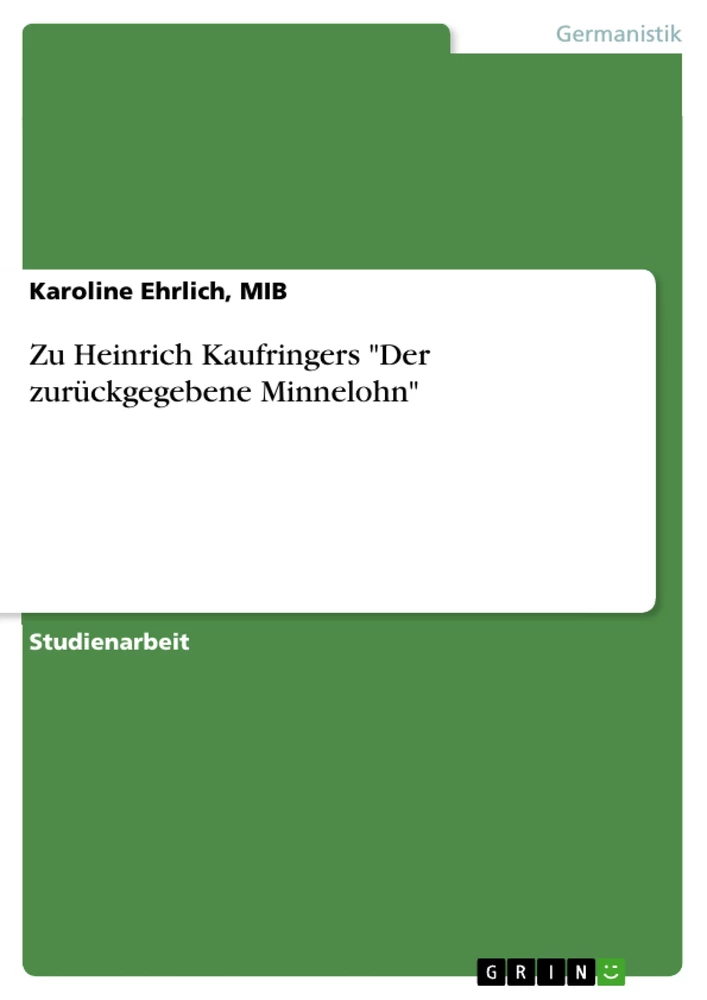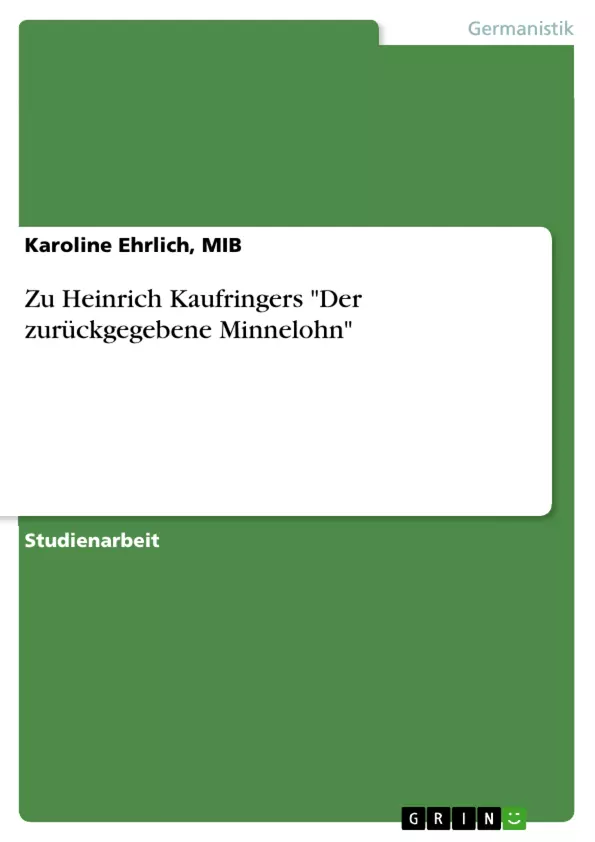Die Diskussion um die mittelalterlichen Mären kreist vornehmlich um Fragen der Überlieferung, der Gattungsbestimmung, der narrativen Muster und schließlich um solche des sozialhistorischen Gehalts. Zwar werden Mären gegenüber der idealen Welt des Artus Romans nicht mehr als realistischer Ausdruck volkstümlicher Kultur gelesen – dem höfischen Roman als positivem Entwurf feudaladeligen Lebens stehen sie dennoch verdächtig gegenüber.1 Gerade solche Texte, die sich in Thema und Motivik konventionellen Erwartungen widersetzen, deren Didaxe über die Thematisierung von Obszönitäten erfolgt, blieben (mit einigen Ausnahmen2) lange am Rande der Forschung. Demgegenüber erfreuen sich die Mären eines Strickers gerade ob ihrer didaktischen Einsinnigkeit des ausgesuchten Interesses. Der spätmittelalterliche Autor Heinrich Kaufringer gehört darum erst seit jüngster Zeit nicht mehr zu den vernachlässigten Autoren des Märengenres an. Nicht zuletzt weil sich einige seiner Texte einsinnigen Didaktisierungen entziehen und herkömmliche Rezeptionsmuster und Rezeptionserwartungen irritieren. Heute geniest er wegen seiner Erzählkunst ein solides Ansehen. „Gediegenes Erzählen das einerseits entschieden funktional bleibt, andererseits aber Einzelmomente und kleinere Zusammenhänge reich ausgestaltet und verdichtet“ 3 rühmt etwa Sappler, und auch Cramer findet lobende Worte, wobei dieser als Begründung das eher inhaltliche Argument „selbstständige(r) Reflexion und literarische(r) Erörterung aktueller Probleme“4 anführt. Was den Gattungscharakter des Märes betrifft, sind sich die Forscher noch immer uneinig, nach welchen Kriterien man das Märe von anderen Gattungen abgrenzen solle, da bereits Hanns Fischer in seinen grundlegenden Arbeiten zu dem Ergebnis gelangte, dass weder quantitative, noch klassifikatorische Kriterien für eine solche Abgrenzung ausreichen würden.5
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Gang der Forschung um Kaufringer und seine Mären
- Inhalt des Märes Der zurückgegebene Minnelohn
- Höfisch-ritterliche Konventionen und Kaufringers Bruch mit ihnen
- Kaufringers Thematisierung der Verschiebung innerhalb der ritterlichen Ethik
- Der Konflikt zwischen den adligen `seniores` und `iuvenes`
- Die Frage nach der Überlegenheit im zurückgegebene(n) Minnelohn
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Heinrich Kaufringers Märe "Der zurückgegebene Minnelohn" und befasst sich insbesondere mit Kaufringers Abkehr von höfisch-ritterlichen Konventionen und der Darstellung des Konflikts zwischen den adligen `seniores` und `iuvenes`. Dabei wird die Frage nach einer möglichen Kritik an der spätmittelalterlichen Moral sowie der Überlegenheit im Märe behandelt.
- Kaufringers Bruch mit höfisch-ritterlichen Konventionen
- Kritik an der spätmittelalterlichen Moral
- Konflikt zwischen den adligen `seniores` und `iuvenes`
- Die Frage nach der Überlegenheit im Märe
- Die literarische Verarbeitung des Konflikts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die aktuelle Forschungslage zu Heinrich Kaufringer und seinen Mären. Es werden die wichtigsten Themen und Debatten in der Literaturwissenschaft aufgezeigt, insbesondere hinsichtlich der Gattungsfrage und des sozialhistorischen Gehalts. Die Analyse des Märes "Der zurückgegebene Minnelohn" konzentriert sich auf die Darstellung der Handlung, die Beziehung zwischen dem jungen Ritter und der Burgherrin und die Auswirkungen des Minnelohns auf die Handlung.
Die folgenden Kapitel untersuchen die in der Arbeit hervorgehobenen Themenschwerpunkte. Im Zentrum der Betrachtung stehen Kaufringers Abkehr von höfisch-ritterlichen Konventionen, die Kritik an der spätmittelalterlichen Moral, der Konflikt zwischen den adligen `seniores` und `iuvenes` und die Frage nach der Überlegenheit im Märe. Dabei werden die Ergebnisse der Literaturwissenschaftler Udo Friedrich und André Schnyder in Bezug auf diese Themen gegenübergestellt und kritisch reflektiert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit fokussiert auf folgende Schlüsselwörter: Heinrich Kaufringer, Märe, "Der zurückgegebene Minnelohn", höfisch-ritterliche Konventionen, spätmittelalterliche Moral, Konflikt zwischen den adligen `seniores` und `iuvenes`, Überlegenheit im Märe, literarische Verarbeitung des Konflikts.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Heinrich Kaufringer?
Heinrich Kaufringer war ein spätmittelalterlicher Autor, der für seine Erzählkunst im Genre des Märes bekannt ist und aktuelle moralische Probleme seiner Zeit literarisch verarbeitete.
Worum geht es in „Der zurückgegebene Minnelohn“?
Das Märe thematisiert die Beziehung zwischen einem jungen Ritter und einer Burgherrin und bricht dabei mit traditionellen höfisch-ritterlichen Konventionen der Minne.
Was ist das Besondere an Kaufringers Didaktik?
Im Gegensatz zu vielen einsinnigen Mären seiner Zeit entziehen sich Kaufringers Texte oft einfachen Deutungsmustern und irritieren Rezeptionserwartungen durch die Thematisierung von Obszönitäten oder moralischen Grauzonen.
Welcher soziale Konflikt wird im Text dargestellt?
Ein zentrales Thema ist der Konflikt zwischen den adligen „seniores“ (Älteren) und „iuvenes“ (Jüngeren) sowie die Verschiebung innerhalb der ritterlichen Ethik im Spätmittelalter.
Wie definiert die Forschung das Genre „Märe“?
Die Gattungsbestimmung ist schwierig; Kriterien wie Umfang oder Inhalt reichen oft nicht aus, um Mären klar von anderen mittelalterlichen Kurz-Erzählformen abzugrenzen.
- Citar trabajo
- Mag.phil. Karoline Ehrlich, MIB (Autor), 2004, Zu Heinrich Kaufringers "Der zurückgegebene Minnelohn", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60819