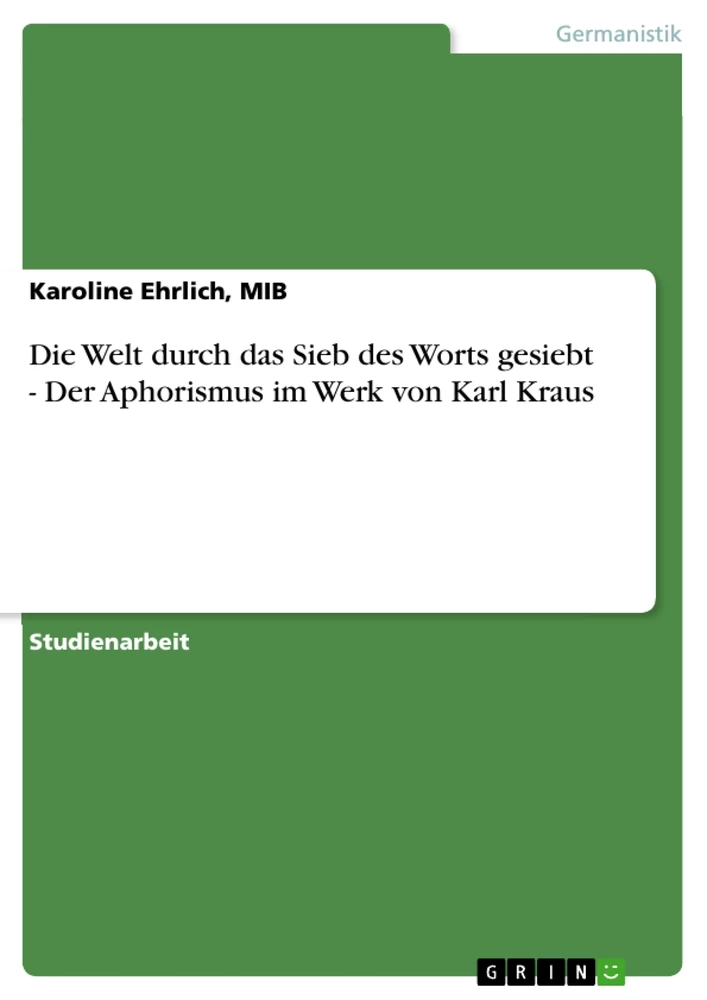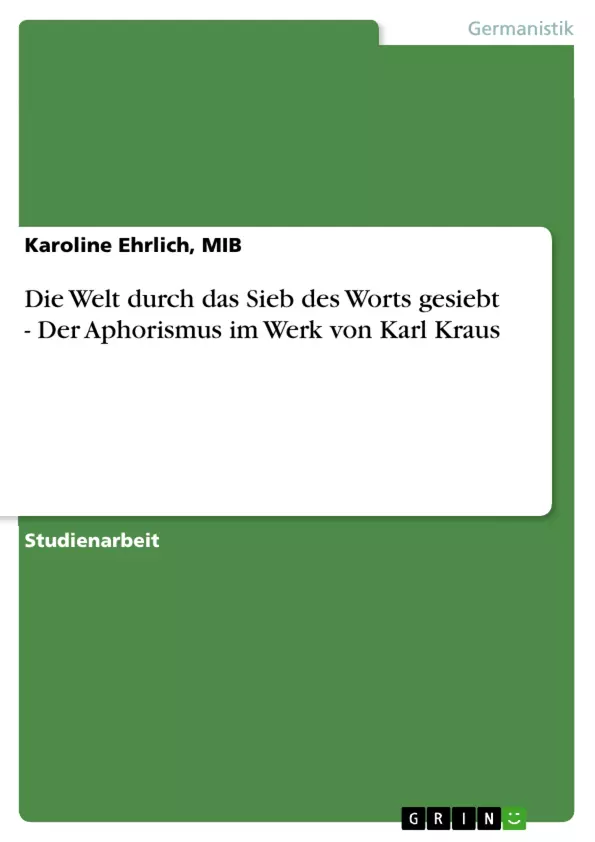Das aphoristische Schaffen von Karl Kraus (1874 – 1936) umfasst die Jahre 1906- 1919. Es wächst aus der Glosse und verwandten journalistischen Formen heraus und mündet in die gebundene Form des Epigramms. Als er 1906 von verschiedenen längeren satirischen Formen zu „Abfällen“ oder „Splittern“ übergeht, bewegt er sich damit terminologisch noch in bekannten Bahnen. Bald aber werden die Texte durchweg als Tagebuch oder Persönliches bezeichnet und geben nicht nur die angemessene Wertschätzung durch ihren Autor zu erkennen, sondern auch den bibliographischen Hintergrund. So entstehen die ersten Aphorismen aus seiner Beziehung mit Bertha Maria Denk. 1908 umfassen sie ein ganzes Heft der Fackel.2
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Aphorismus, die spontanste Aufnahme des Augenblicks
- Über den Aphorismus
- Der österreichische Aphorismus nach der Jahrhundertwende
- Die Verwendung des Aphorismus im Werk von Karl Kraus
- Die Sprachauffassung – zum Verständnis der Sprachkultur
- Sprachauffassung – Sprachkritik
- Sprachenergie - Sprachkunst
- Spracharchitektonik – Sprachmystik
- Das Wortspiel - Die Analogie der Sprache mit der mathematischen Formel
- Amphibolie, Klangwortspiel - Variationswortspiel, Chiasmus
- Kontamination, Interferenz
- Kürzung, Negation, Klimax, Parallelführung
- Der Aphorismus in den Kriegsfackeln
- Beispiele aus Nachts inklusive Besprechung
- Aufbau des Buches Nachts/ Wo liegt der Schwerpunkt
- Das Verhältnis der Geschlechter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Aphorismus im Werk von Karl Kraus, beleuchtet dessen Entstehung und Entwicklung im Kontext der österreichischen Literatur um die Jahrhundertwende, und analysiert die sprachliche Gestaltung und die zentralen Themen in Kraus' aphoristischem Schaffen.
- Der Aphorismus als literarische Gattung und seine Entwicklung im Werk von Karl Kraus
- Kraus' Sprachauffassung und Sprachkritik
- Die Rolle des Wortspiels und der sprachlichen Gestaltung in Kraus' Aphorismen
- Der Aphorismus im Kontext der „Kriegsfackeln“
- Der Einfluss von Otto Stoessl auf die Entstehung der Aphorismenbände
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Zeitraum und die Entwicklung des aphoristischen Schaffens von Karl Kraus (1906-1919), seinen Ursprung in journalistischen Formen und die spätere Entwicklung zum gebundenen Epigramm. Sie erwähnt auch den bibliographischen Hintergrund und die Bedeutung der Beziehung Kraus' zu Bertha Maria Denk für die Entstehung der ersten Aphorismen.
Der Aphorismus, die spontanste Aufnahme des Augenblicks: Dieses Kapitel beleuchtet den Aphorismus als literarische Gattung. Es beginnt mit der etymologischen Herleitung des Begriffs "Aphorismus" und seiner Verbindung zum Wort "Horizont". Der historische Kontext wird dargestellt, von Hippokrates bis zu den französischen Moralisten und der weiteren Entwicklung im deutschsprachigen Raum, mit Autoren wie Lichtenberg, Goethe, Nietzsche und Adorno. Besonders wird die Bedeutung des Aphorismus im österreichischen Kontext nach der Jahrhundertwende erörtert, mit Bezug auf die Arbeiten von R. Gray und Stefan Kaszynski, die den Aphorismus als Ausdruck von Sprachskepsis und krisenhaftem Zeitgeist interpretieren. Abschließend wird Kraus' Verwendung des Aphorismus beschrieben, als verdichtete Gedanken, die als Knotenpunkt eines Gedankensystems fungieren und einen ganzen Essay in einem Satz zusammenfassen. Die schubweise Entstehung der Aphorismen und deren thematische Verknüpfung wird ebenfalls hervorgehoben, ebenso wie der Einfluss Otto Stoessls auf die Herausgabe eines Aphorismusbandes.
Die Sprachauffassung - zum Verständnis der Sprachkultur: Das Kapitel analysiert Kraus' besondere Beziehung zur Sprache und seine Sprachkritik. Es beschreibt Kraus als einen Sprachskeptiker, der nicht an der Mitteilungskraft der Sprache, sondern an ihrem Missbrauch, insbesondere im Journalismus, zweifelt. Kraus' Erkenntnis über den Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch und Machtausübung sowie sein Widerstand gegen Sprachbeherrschung als Bewusstseinsmanipulation werden dargestellt. Das Kapitel hebt hervor, dass Kraus sich selbst als Diener und Verwalter der Sprache sah.
Schlüsselwörter
Karl Kraus, Aphorismus, österreichische Literatur, Jahrhundertwende, Sprachauffassung, Sprachkritik, Wortspiel, Kriegsfackeln, Otto Stoessl, Sprachskepsis.
Häufig gestellte Fragen zu "Karl Kraus' Aphorismen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Aphorismen von Karl Kraus, beleuchtet deren Entstehung und Entwicklung im Kontext der österreichischen Literatur um die Jahrhundertwende und untersucht die sprachliche Gestaltung und zentralen Themen in Kraus' aphoristischem Schaffen. Der Fokus liegt auf der literarischen Gattung des Aphorismus, Kraus' Sprachauffassung und -kritik, der Rolle des Wortspiels, den Aphorismen im Kontext der „Kriegsfackeln“ und dem Einfluss von Otto Stoessl.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über den Aphorismus als literarische Gattung und seine Entwicklung bei Kraus, ein Kapitel über Kraus' Sprachauffassung und Sprachkritik, ein Kapitel zum Wortspiel und der sprachlichen Gestaltung in seinen Aphorismen, ein Kapitel über die Aphorismen in den „Kriegsfackeln“, und abschließend ein Kapitel mit Schlüsselbegriffen und einer Zusammenfassung.
Wie wird der Aphorismus in der Arbeit behandelt?
Der Aphorismus wird als literarische Gattung etymologisch hergeleitet und historisch von Hippokrates bis zu modernen Autoren wie Nietzsche und Adorno betrachtet. Der österreichische Kontext nach der Jahrhundertwende wird besonders hervorgehoben, wobei die Interpretation des Aphorismus als Ausdruck von Sprachskepsis und krisenhaftem Zeitgeist im Mittelpunkt steht. Kraus' Verwendung des Aphorismus als verdichtete Gedanken, die als Knotenpunkt eines Gedankensystems fungieren, wird detailliert beschrieben.
Welche Rolle spielt Kraus' Sprachauffassung?
Kraus' Sprachauffassung und Sprachkritik bilden einen zentralen Aspekt der Arbeit. Er wird als Sprachskeptiker dargestellt, der den Missbrauch der Sprache, besonders im Journalismus, kritisiert. Sein Verständnis vom Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch und Machtausübung sowie sein Widerstand gegen Sprachbeherrschung als Bewusstseinsmanipulation werden analysiert. Kraus sah sich selbst als Diener und Verwalter der Sprache.
Welche Bedeutung hat das Wortspiel in Kraus' Aphorismen?
Das Kapitel zum Wortspiel analysiert verschiedene Techniken wie Amphibolie, Klangwortspiel, Variationswortspiel, Chiasmus, Kontamination, Interferenz, Kürzung, Negation, Klimax und Parallelführung. Es untersucht, wie diese Mittel in Kraus' Aphorismen eingesetzt werden und zur Wirkung beitragen.
Welche Rolle spielen die „Kriegsfackeln“?
Die „Kriegsfackeln“ werden als Kontext für die Analyse von Kraus' Aphorismen herangezogen. Das Kapitel untersucht Beispiele aus „Nachts“, analysiert den Aufbau des Werkes und dessen Schwerpunkt, und betrachtet das Verhältnis der Geschlechter in den Aphorismen dieses Bandes.
Wer war Otto Stoessl und welche Bedeutung hat er?
Otto Stoessl wird als wichtige Einflussgröße auf die Entstehung und Herausgabe der Aphorismenbände von Karl Kraus dargestellt. Die Arbeit geht auf seinen Einfluss genauer ein.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Karl Kraus, Aphorismus, österreichische Literatur, Jahrhundertwende, Sprachauffassung, Sprachkritik, Wortspiel, Kriegsfackeln, Otto Stoessl, Sprachskepsis.
- Quote paper
- Mag.phil. Karoline Ehrlich, MIB (Author), 2005, Die Welt durch das Sieb des Worts gesiebt - Der Aphorismus im Werk von Karl Kraus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60820