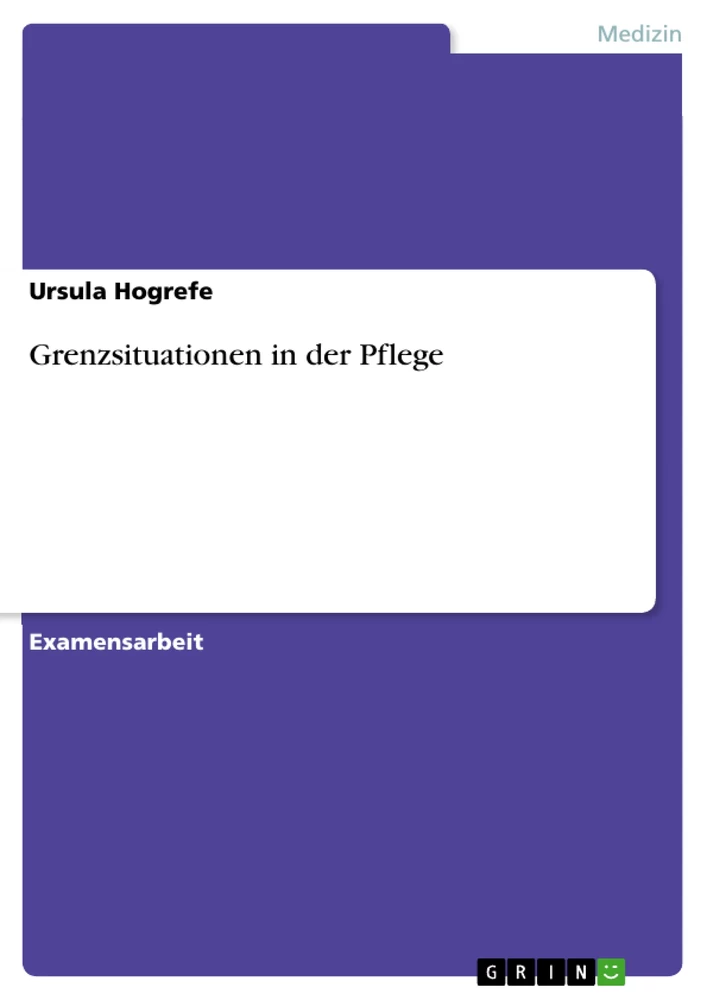Im Jahre 1969 begann ich meine Ausbildung an der Schwesternvorschule des Kreiskrankenhauses Hoya. Zu damaliger Zeit wurden bestimmte Themen im Pflegealltag tabuisiert. „Über Gefühle spricht man nicht.“ „Eine Schwester ekelt sich nicht.“ ungefähr so lauteten die Anweisungen unserer Unterrichtsschwester.
Gefühlsregungen, vor allem wenn sie negativer Art sind, gelten heute wie damals in der Berufswelt der Pflegenden als meist nicht vorhanden. Schamgefühl, Angst und Ekel hat eine Pflegekraft nicht zu artikulieren. Im heutigen Berufsalltag kommen wir durch die Arbeitverdichtung immer mehr an unsere Grenzen. Aber nicht nur die Grenzen der Leistungsfähigkeit werden überschritten. Auch unsere inneren Grenzen der Erziehung, des kulturellen Umfeldes oder unsere eigenen Schutzgrenzen müssen wir oft mehrmals täglich überschreiten. Sei es bei Kontakt mit Exkrementen oder nur dadurch dass wir einem fremden Menschen körperlich nahe kommen müssen. Wir überschreiten unsere, sowie seine Grenzen. Machen uns die damit verbundenen Emotionen nicht bewusst, verdrängen sie oder leiten sie unbewusst um.
Ich glaube; ein Mensch kann Leid, Schmutz oder unangenehme Gerüche nur in begrenztem Umfang bei anderen ertragen, wenn er sich nicht aktiv mit den damit verbundenen Gefühlen auseinander setzt.
Ich habe während meiner pflegerischen Tätigkeit viel unterschwellige und auch direkte Gewalt an Patienten/Altenheimbewohnern beobachtet. Oft war den pflegenden Mitarbeitern oder auch Angehörigen ihr Handeln nicht bewusst. Ich glaube es gibt einen Zusammenhang zwischen verdrängten Gefühlen und Erkrankungen bei Pflegenden.
In welchen Situationen fühlen sich Pflegende überfordert? Wo kommen sie an ihre Grenzen und wo müssen sie diese überschreiten? Welche Gefühle sind damit verbunden? Macht die Verdrängung von negativen Gefühlen krank? Hat die Verdrängung Auswirkungen auf unser pflegerisches Handeln? Und, wenn ja ? Wie kann man als Leitungskraft in der Pflege, dem entgegen wirken?
Um diese Fragen soll es in meiner Hausarbeit gehen. Ich verstehe diese Arbeit als Hilfestellung für Mitarbeiter in Pflegeberufen. Ich möchte der Sprachlosigkeit in meinem Berufsumfeld ein Ende bereiten und einen Anstoß geben, sich mit unliebsamen Gefühlen/Emotionen auseinander zu setzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Vorgehensweise der eigenen Untersuchung
- 2.1 Fragestellungen
- 2.2 Kriterien der Auswahl
- 2.3 Auswertungen
- 3 Definitionen des Begriffes Grenzsituation
- 4 Der Pflegeberuf im Zusammenhang von Grenzsituationen
- 5 Pflegesituationen als Auslöser von Scham, Ekel oder Angst
- 5.1 Angst als Ursprungsemotion
- 5.2 Abwehr/Schutzemotion Ekel
- 5.3 Körperschamentwicklung
- 5.4 Schamgrenzen
- 6 Bewusstsein von negativen Gefühlen
- 6.1 Drei Ebenen der Gefühlsarbeit
- 7 Körperliche, seelische Symptomatik
- 8 Auswirkung auf uns und unser pflegerisches Handeln
- 8.1 Distanzierungsstrategien
- 8.2 Angst und Aggression
- 8.3 Autoaggressionen
- 8.4 Aphasien in der Pflege
- 9 Krankheit durch Verdrängung
- 10 Gefühlsbewältigung und Abgrenzung
- 10.1 Indirekte Bewältigungsstrategien
- 10.2 Direkte Bewältigungsstrategien
- 10.3 Strategien der befragten Pflegerinnen und Pfleger
- 10.4 Hilfreiche Bewältigungsstrategien
- 11 Institutionelle Erfordernisse
- 12 Fazits
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Grenzsituationen im Pflegeberuf und deren Auswirkungen auf das pflegerische Handeln und die Gesundheit der Pflegenden. Sie basiert auf einer eigenen empirischen Untersuchung mittels Fragebögen und beleuchtet die Zusammenhänge zwischen verdrängten Gefühlen (Angst, Scham, Ekel) und psychosomatischen Erkrankungen. Die Arbeit zielt darauf ab, Hilfestellungen für Mitarbeiter im Pflegebereich zu bieten und die Sprachlosigkeit bezüglich emotionaler Belastung zu überwinden.
- Grenzüberschreitungen im Pflegealltag und deren emotionale Folgen
- Zusammenhang zwischen verdrängten Gefühlen und psychosomatischen Erkrankungen bei Pflegenden
- Bewältigungsstrategien von Pflegenden im Umgang mit Grenzsituationen
- Institutionelle Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsklimas und des Umgangs mit emotionalen Belastungen
- Die Rolle von Angst, Scham und Ekel im Pflegeberuf.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation der Autorin, die während ihrer langjährigen Tätigkeit im Pflegebereich die Tabuisierung von Gefühlen und die damit verbundenen Probleme beobachtet hat. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor, die sich auf die Herausforderungen im Umgang mit Grenzsituationen, die damit verbundenen Gefühle und deren Auswirkungen auf die Gesundheit und das pflegerische Handeln konzentrieren.
2 Vorgehensweise der eigenen Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es wurden sechzig Fragebögen an Pflegende verschiedener Einrichtungen verteilt. Die Auswertung der anonymisierten Fragebögen bildete die Grundlage der Analyse. Das Kapitel beschreibt die demografischen Daten der Befragten sowie die Vorgehensweise bei der Auswertung der Fragebögen.
3 Definitionen des Begriffes Grenzsituation: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Grenzsituation" anhand der Arbeiten von Karl Jaspers. Es beschreibt Grenzsituationen als unüberschreitbare Grenzen des menschlichen Daseins, die existenzielle Erfahrungen auslösen. Die Definition bildet die theoretische Grundlage für die Analyse der im Pflegeberuf auftretenden Grenzsituationen.
4 Der Pflegeberuf im Zusammenhang von Grenzsituationen: Dieses Kapitel untersucht die spezifischen Grenzsituationen im Pflegeberuf, insbesondere im Kontext der Alten-, Kranken- und Behindertenpflege. Es wird die besondere Nähe zwischen Pflegern und Patienten als Faktor für die Entstehung von Ekel und anderen negativen Gefühlen hervorgehoben. Die Ergebnisse einer eigenen Befragung verdeutlichen häufige Grenzsituationen im Pflegealltag.
5 Pflegesituationen als Auslöser von Angst, Scham oder Ekel: Das Kapitel analysiert verschiedene Pflegesituationen, die Angst, Scham und Ekel auslösen können, basierend auf den Ergebnissen der Befragung. Zeitmangel, Umgang mit Körperausscheidungen und der Sterbeprozess werden als häufige Auslöser genannt. Der Zusammenhang zwischen Gerüchen und Ekel sowie die verschiedenen Intensitätsstufen des Ekels werden diskutiert. Die Rolle der eigenen Aggressivität als Auslöser negativer Emotionen wird ebenfalls untersucht.
6 Bewusstsein von negativen Gefühlen: Dieses Kapitel untersucht, inwieweit Pflegende sich ihrer negativen Gefühle bewusst sind und wie häufig diese auftreten. Anhand der Ergebnisse der Befragung wird die Tendenz zur Verdrängung von Gefühlen analysiert. Das Konzept der "Gefühlsarbeit" nach Arlie Hochschild wird eingeführt und auf den Pflegeberuf angewendet.
7 Körperliche, seelische Symptomatik: In diesem Kapitel werden die körperlichen und seelischen Symptome von Angst, Scham und Ekel beschrieben, sowohl allgemein als auch basierend auf den Angaben der befragten Pflegenden. Die Ergebnisse zeigen ein breites Spektrum an Symptomen von körperlichem Unbehagen bis hin zu schweren psychischen Belastungen.
8 Auswirkungen auf uns und unser pflegerisches Handeln: Dieses Kapitel behandelt die Auswirkungen von Angst, Scham und Ekel auf das pflegerische Handeln. Es wird die Notwendigkeit von Distanzierungsstrategien erläutert, aber auch die Gefahren von Verdrängung, Aggression und Autoaggression hervorgehoben. Der Begriff der "Aphasie in der Pflege" wird eingeführt und im Kontext des weiblichen Rollenbildes diskutiert.
9 Krankheit durch Verdrängung: Der Zusammenhang zwischen der Verdrängung negativer Gefühle und dem Auftreten von psychosomatischen Erkrankungen wird untersucht. Statistische Daten zum Krankenstand im Pflegebereich werden vorgestellt und mit den Ergebnissen der eigenen Befragung verglichen.
10 Gefühlsbewältigung und Abgrenzung: Dieses Kapitel analysiert Bewältigungsstrategien von Pflegenden im Umgang mit negativen Gefühlen. Es werden indirekte und direkte Strategien unterschieden und deren positive und negative Aspekte diskutiert. Die Ergebnisse der Befragung zeigen verschiedene Bewältigungsmechanismen, von denen einige als hilfreich, andere als problematisch eingestuft werden.
11 Institutionelle Erfordernisse: Das Kapitel widmet sich den institutionellen Erfordernissen, um ein offenes Klima für den Umgang mit emotionalen Belastungen zu schaffen. Es werden Empfehlungen für Pflegeschulen, Altenpflegeeinrichtungen und Führungskräfte gegeben, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Gesundheit der Pflegenden zu schützen.
Schlüsselwörter
Grenzsituationen, Pflegeberuf, Angst, Scham, Ekel, Gefühlsarbeit, Verdrängung, psychosomatische Erkrankungen, Bewältigungsstrategien, Arbeitsbedingungen, Institutionelle Maßnahmen, Kommunikation, Frauenrolle, Stress, Burnout.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Grenzsituationen im Pflegeberuf
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht Grenzsituationen im Pflegeberuf und deren Auswirkungen auf das pflegerische Handeln und die Gesundheit der Pflegenden. Sie basiert auf einer empirischen Untersuchung mittels Fragebögen und beleuchtet den Zusammenhang zwischen verdrängten Gefühlen (Angst, Scham, Ekel) und psychosomatischen Erkrankungen. Ein zentrales Ziel ist es, Hilfestellungen für Pflegekräfte zu bieten und die Sprachlosigkeit bezüglich emotionaler Belastung zu überwinden.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Methode. 60 Fragebögen wurden an Pflegekräfte verschiedener Einrichtungen verteilt. Die anonymisierten Ergebnisse bildeten die Grundlage der Analyse. Die Methodik umfasst die Beschreibung demografischer Daten der Befragten und die Vorgehensweise bei der Auswertung der Fragebögen.
Wie wird der Begriff "Grenzsituation" definiert?
Der Begriff "Grenzsituation" wird anhand der Arbeiten von Karl Jaspers definiert. Grenzsituationen werden als unüberschreitbare Grenzen des menschlichen Daseins beschrieben, die existenzielle Erfahrungen auslösen. Diese Definition bildet die theoretische Grundlage für die Analyse der im Pflegeberuf auftretenden Grenzsituationen.
Welche Grenzsituationen im Pflegeberuf werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht spezifische Grenzsituationen in der Alten-, Kranken- und Behindertenpflege. Die besondere Nähe zwischen Pflegenden und Patienten wird als Faktor für die Entstehung negativer Gefühle wie Ekel hervorgehoben. Die Ergebnisse der Befragung verdeutlichen häufige Grenzsituationen im Pflegealltag.
Welche Gefühle werden im Zusammenhang mit Grenzsituationen analysiert?
Die Hausarbeit analysiert Angst, Scham und Ekel als Auslöser von Grenzsituationen. Basierend auf den Befragungsergebnissen werden Situationen wie Zeitmangel, Umgang mit Körperausscheidungen und der Sterbeprozess als häufige Auslöser genannt. Der Zusammenhang zwischen Gerüchen und Ekel sowie die Rolle der eigenen Aggressivität werden ebenfalls untersucht.
Wie wird das Bewusstsein der Pflegenden für negative Gefühle betrachtet?
Die Arbeit untersucht das Bewusstsein der Pflegenden für ihre negativen Gefühle und die Häufigkeit deren Auftretens. Die Tendenz zur Verdrängung von Gefühlen wird anhand der Befragungsergebnisse analysiert. Das Konzept der "Gefühlsarbeit" nach Arlie Hochschild wird eingeführt und auf den Pflegeberuf angewendet.
Welche körperlichen und seelischen Symptome werden beschrieben?
Die Hausarbeit beschreibt körperliche und seelische Symptome von Angst, Scham und Ekel, sowohl allgemein als auch basierend auf den Angaben der befragten Pflegenden. Die Ergebnisse zeigen ein breites Spektrum an Symptomen, von körperlichem Unbehagen bis hin zu schweren psychischen Belastungen.
Wie beeinflussen negative Gefühle das pflegerische Handeln?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen von Angst, Scham und Ekel auf das pflegerische Handeln. Die Notwendigkeit von Distanzierungsstrategien wird erläutert, aber auch die Gefahren von Verdrängung, Aggression und Autoaggression hervorgehoben. Der Begriff der "Aphasie in der Pflege" wird eingeführt und im Kontext des weiblichen Rollenbildes diskutiert.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Verdrängung und Krankheit?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Verdrängung negativer Gefühle und dem Auftreten psychosomatischer Erkrankungen. Statistische Daten zum Krankenstand im Pflegebereich werden vorgestellt und mit den Ergebnissen der eigenen Befragung verglichen.
Welche Bewältigungsstrategien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Bewältigungsstrategien von Pflegenden im Umgang mit negativen Gefühlen. Indirekte und direkte Strategien werden unterschieden und deren positive und negative Aspekte diskutiert. Die Ergebnisse der Befragung zeigen verschiedene Bewältigungsmechanismen, die als hilfreich oder problematisch eingestuft werden.
Welche institutionellen Maßnahmen werden empfohlen?
Die Hausarbeit widmet sich institutionellen Erfordernissen, um ein offenes Klima für den Umgang mit emotionalen Belastungen zu schaffen. Es werden Empfehlungen für Pflegeschulen, Altenpflegeeinrichtungen und Führungskräfte gegeben, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Gesundheit der Pflegenden zu schützen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grenzsituationen, Pflegeberuf, Angst, Scham, Ekel, Gefühlsarbeit, Verdrängung, psychosomatische Erkrankungen, Bewältigungsstrategien, Arbeitsbedingungen, Institutionelle Maßnahmen, Kommunikation, Frauenrolle, Stress, Burnout.
- Arbeit zitieren
- Ursula Hogrefe (Autor:in), 2006, Grenzsituationen in der Pflege, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61093