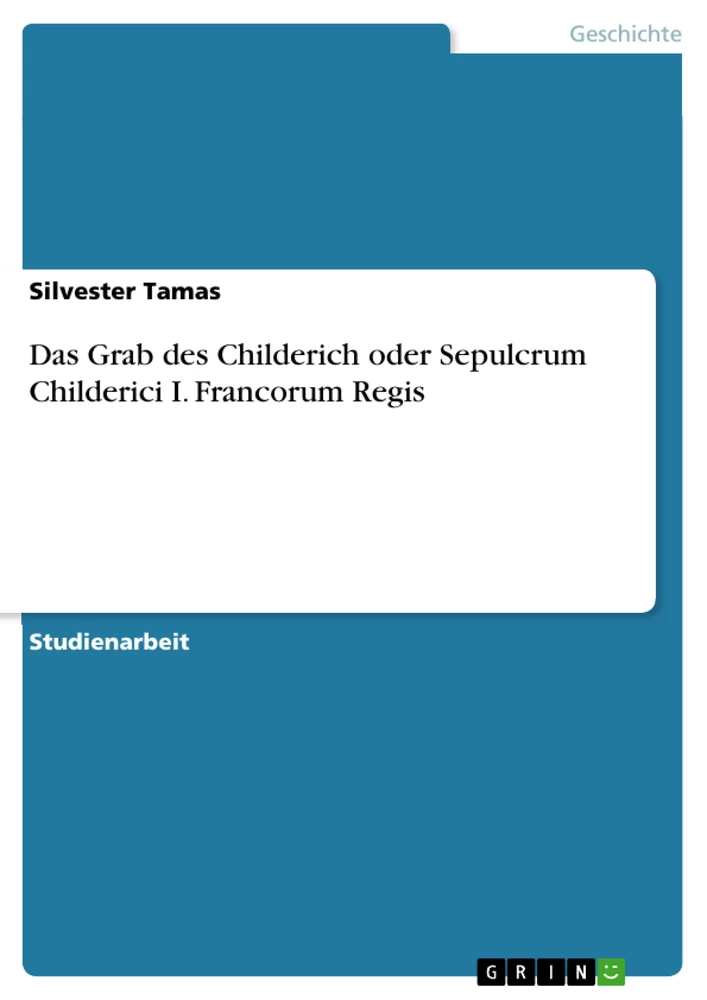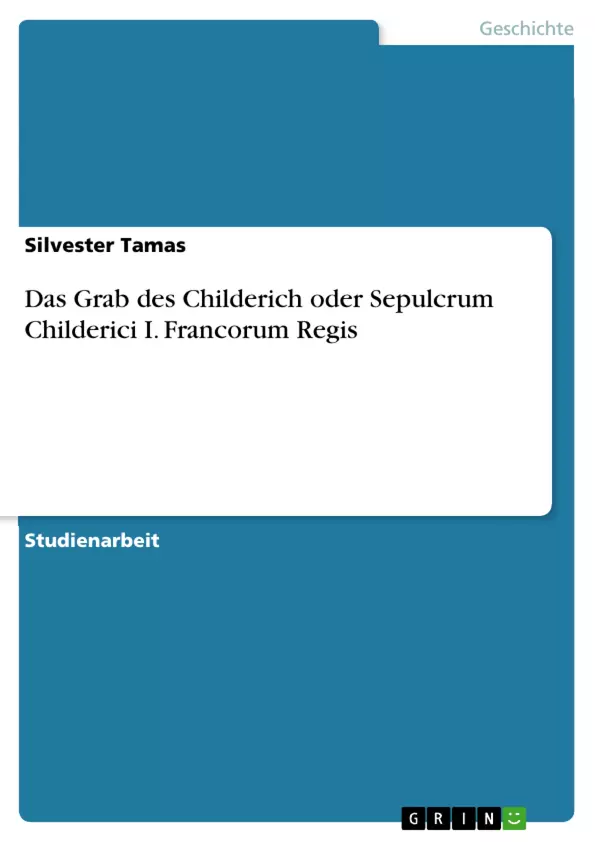Im Wintersemester des Jahres 2005 auf 2006, sollten im Rahmen eines Hauptseminars des Institutes für Altertumswissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität zu Jena, am Lehrstuhl der Alten Geschichte, Fragen und Problemen, hinsichtlich altertümlicher Bestattungssitten und Jenseitsvorstellungen in der Antike nachgegangen werden. Verschiedene Themen und Schwerpunkte wurden so ausgewählt, dass überblicksmäßig die herangezogenen Quellen vorgestellt und anschließend die Problematik in einem Referat zusammenfassend erörtert wurde. Das Grundproblem in der Handhabung eines Themas, dass sich mit Jenseitsvorstellungen in einer soweit zurückreichenden Epoche der Menschheitsgeschichte auseinandersetzt, besteht hauptsächlich darin, dass über die spärlichen schriftlichen und etwas reicher ausfallenden archäologischen – also materiellen – Quellen, nur der Ansatz bzw. die Tendenz von ehemals bestandenen Glaubensmustern und Ritualen erkennbar werden kann. Schließlich haben wir es mit einem psychologischen und metaphysischen Phänomen zu tun, wenn es darum geht, sich mit dem Tod und der Frage „was kommt danach“ zu beschäftigen. An diesem Punkt wird sofort deutlich, dass den prä-/historischen Wissenschaften und ihren Nachbardisziplinen Grenzen auferlegt sind, die nicht überwunden werden können. Es gelingen lediglich Erklärungsversuche, die dahin zielen, Argumente und Indizien mit einander zu vergleichen, um letztlich festzustellen, dass der Tod genauso wie die Geburt ein immanenter Bestandteil des Lebens in allen Kulturen war und ist. Der pietätvolle Umgang mit einem Verstorbenen während eines Bestattungsvorganges – innerhalb eines wie auch immer sozial gearteten Verbandes – setzt das Vorhandensein von Empfindungen wie Trauer, Mitgefühl und – nicht zwingend – den Glauben oder das Vorstellungsvermögen an bzw. über eine jenseitige Sphäre voraus. In meinen Ausführungen war es mir ein Anliegen, die Quellen hinsichtlich der kulturellen Situation der Bestattung eines der ersten nachweislichen Frankenkönige, namentlich Childerich I., darzulegen und zu beurteilen. Es ging mir ursächlich darum, die einzelnen Elemente der Grablege des Regis francorum, also des Befundes und der Funde, für meine Arbeit heranzuziehen und sowohl auf lokale, als auch überregionale Indizien für die eigens verstandene Identität des Verstorbenen und seine Überlieferungsvorstellungen in das Totenreich, zu untersuchen und schließlich im übergeordneten kulturhistorischen Kontext anschaulich darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Childerich I. - Personengeschichte
- III. Forschungsgeschichte
- IV. Der Fundplatz
- V. Die Funde und ihre Zuordnung
- VI. Datierung des Grabes im historisch-archäologischen Kontext
- VII. Die Funde im Kontext
- VIII. Grabbrauch im Umfeld des Childerich-Grabes
- IX. Die Interpretation der Bestattung Childerichs
- X. Das Grab und die Funde als Politikum
- XI. Bewertung der schriftlichen Quellen
- XII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bestattung des fränkischen Königs Childerich I. und zielt darauf ab, die kulturellen Hintergründe seiner Grablege im Kontext der Spätantike und des beginnenden Mittelalters zu beleuchten.
- Die Personengeschichte Childerichs I.
- Die Analyse der Funde und ihre Zuordnung.
- Die Interpretation der Bestattung im Lichte der damaligen Jenseitsvorstellungen.
- Die Bedeutung der Grablege als politisches Statement.
- Die Bewertung der schriftlichen Quellen und die Herausforderungen der Rekonstruktion von Glaubensmustern.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bestattungssitten und Jenseitsvorstellungen in der Antike ein und erläutert die Herausforderungen der Quellenforschung in diesem Bereich. Sie betont die Bedeutung der Grablege als ein Indiz für den Umgang mit dem Tod und die Entstehung von Jenseitsvorstellungen.
Kapitel II präsentiert die Personengeschichte Childerichs I. und beschreibt seine Rolle als fränkischer Kleinkönig und römischer Offizier. Es beleuchtet seine politische Stellung und die Einflüsse, die seine Lebensweise auf seine Bestattung hatten.
Kapitel III, IV, V, VI und VII befassen sich mit der Forschung zum Grab Childerichs I. Sie erläutern die archäologischen Funde, ihre Zuordnung und Datierung sowie die Bedeutung der Fundstücke im Kontext der damaligen Zeit.
Kapitel VIII untersucht die Bestattungssitten in der Umgebung des Childerich-Grabes und stellt Parallelen und Unterschiede zu anderen Bestattungsformen der Zeit heraus.
Kapitel IX widmet sich der Interpretation der Bestattung Childerichs I. und analysiert die Grablege als Ausdruck seiner politischen und religiösen Zugehörigkeit.
Kapitel X betrachtet die Grablege und die Funde als politische Aussagen und untersucht die Intentionen, die hinter der Auswahl der Beigaben und der Gestaltung des Grabes steckten.
Kapitel XI bewertet die schriftlichen Quellen und die Schwierigkeit, aus ihnen die damaligen Jenseitsvorstellungen und Bestattungsrituale zu rekonstruieren.
Schlüsselwörter
Childerich I., Franken, Merowinger, Spätantike, Frühmittelalter, Bestattung, Grablege, Jenseitsvorstellungen, Funde, Archäologie, Geschichte, Religion, Politik.
- Citation du texte
- Silvester Tamas (Auteur), 2006, Das Grab des Childerich oder Sepulcrum Childerici I. Francorum Regis , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61106