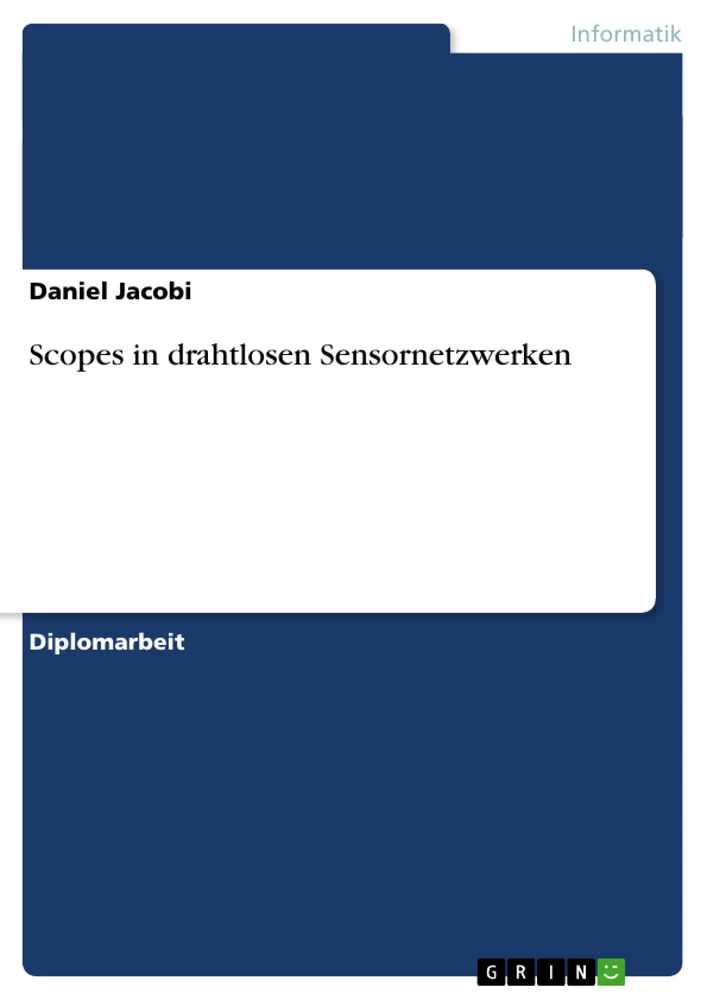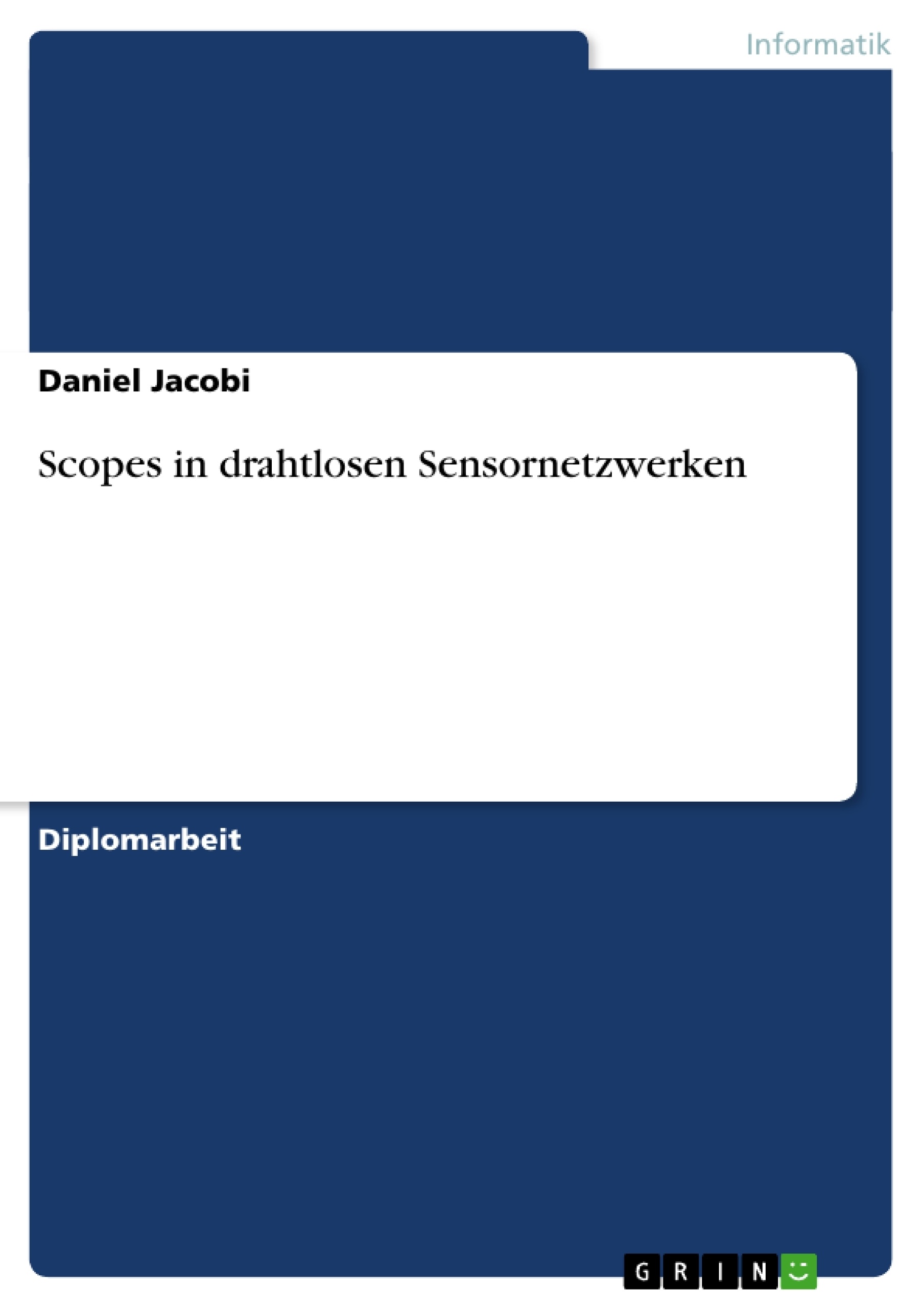Drahtlose Sensornetze bestehen aus vielen kleinen, separaten Computern, den so genannten Sensorknoten. Sie sind in der Regel kleiner als eine Zigarettenschachtel und verfügen über weniger Prozessorkapazität als beispielsweise ein aktueller Game Boy. Dafür besitzen sie eine lange Lebensdauer und kommen mit der Leistung von zwei Mignon Batterien häufig bis zu einem Jahr aus. Kommunizieren können diese kleinen Maschinen über eine Funkschnittstelle miteinander. Das alles macht Sensorknoten sehr billig und flexibel in der Anwendung. Durch ihre beschränkten Ressourcen müssen die für sie entwickelten Anwendungen allerdings stark spezialisiert und auf Effizienz optimiert werden. Daher werden Sensornetze meist für eine einziges Szenario entwickelt. Dies geht auf Kosten der Flexibilität und führt zudem zu einer starken Kostensteigerung. Dennoch stellen viele Anwendungsgebiete für Sensornetzwerke einen hohen Anspruch gerade an die Flexibilität. Überwachung ist z.B. eine der Killerapplikationen für Sensornetze (vgl. [36]): Es können die unterschiedlichsten Daten, über lange Zeiträume z.B. in den unzugänglichsten Gebieten, überwacht werden. Während der Laufzeit kann auf neue Entwicklungen reagiert werden oder es können die Überwachungsparameter geändert werden, wenn andere Sensorwerte interessant werden. Dies ist mit Sensornetzen, die für ein Szenario entworfen worden sind, nicht möglich. Eine Lösung für dieses (Flexibilitäts-)Problem sind Mehrzweck-Sensornetze, die auf Kosten von etwas leistungsfähigerer Hardware, die benötigte Flexibilität wieder bereitstellen und durch das Einführen einer zusätzlichen Abstraktionsschicht die Entwicklung von Anwendungen vereinfachen.
Einen Teil dieser Flexibilität stellt das gezielte Ansprechen einer Gruppe von Knoten dar. Dies kann mit Hilfe von Scopes sogar während der Laufzeit erreicht werden. Über frei definierbare Eigenschaften können auf dieseWeise Knoten zu Gruppen (sog. Scopes) zusammengefasst werden. Das Festlegen der Eigenschaften eines Scopes geschieht auf dem sogenannten Wurzelknoten, von dem die Erstellung des Scopes dann auch ausgeht. Die Scopes ermöglichen es auf aktuelle Ereignisse oder geänderte Überwachungsparameter im Sensornetz flexibel zu reagieren.
Da Sensornetze in vielen Fällen an nur schwer zugänglichen Orten angebracht sind, sind die angesprochenen Laufzeiten ein wichtiges Kriterium. Genauso wichtig ist auch das Erweitern oder Umprogrammieren des Sensornetzes im laufenden Betrieb.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation
- Ziele
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen und Existierende Ansätze
- Einleitung
- Drahtlose Sensornetze
- Hardware der Sensorknoten
- Beispiele und Szenarien für drahtlose Sensornetze
- Routingverfahren
- Multicast
- Directed Diffusion
- Interests und Gradienten
- Datenübertragung
- Reinforcements zum Anlegen und Unterbrechen von Pfaden
- Gradient-Based Routing
- Verfahren zur Gruppierung von Sensorknoten
- Lokale Cluster
- Rollen
- Region Streams
- Multicast
- Zusammenfassung
- Architektur für drahtlose Mehrzweck-Sensornetze
- Einführung
- Scopes
- Spezifizierung von Scopes
- Ausbreitung und Wartung von Scopes
- Scopes in Beispielen
- Das SOS Betriebssystem
- Module
- Scheduling
- Speicherverwaltung
- Zusammenfassung
- Realisierung
- Entwicklungsumgebung
- Basisimplementierung
- Aufbau
- Probleme
- Erweiterte Implementierung
- Aufbau
- Multihop-Routing
- Die Scope Module
- Verbesserungen
- Aufbau
- Simulation eines Drahtlosen Sensornetzes
- Einführung
- Simulationsumgebung
- SOS-native
- Avrora
- Simulationen
- Auswertung der gesammelten Daten
- Simulation auf Nachrichtenebene
- Simulation auf Instruktionsebene
- Fazit
- Zusammenfassung und Ausblick
- Umgesetzte Anforderungen
- Offene Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Implementierung von Scopes in drahtlosen Sensornetzwerken, um Mehrzweck-Sensornetze zu ermöglichen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Effizienz und Flexibilität von Sensornetzwerken zu verbessern, indem sie die gleichzeitige Nutzung für verschiedene Anwendungen ermöglicht.
- Scopes als Methode zur Unterteilung von Sensornetzwerken in Gruppen
- Entwicklung eines Routing-Algorithmus für Scopes
- Simulation der Effizienz von Scopes in realen Szenarien
- Analyse der Auswirkungen von Scopes auf die Performance des Sensornetzwerks
- Evaluierung der Praktikabilität von Scopes in heutigen Sensornetzwerken
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Motiviert die Notwendigkeit für Mehrzweck-Sensornetze.
- Definiert die Ziele und den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Grundlagen und Existierende Ansätze
- Stellt die grundlegenden Konzepte von drahtlosen Sensornetzwerken vor.
- Beschreibt verschiedene Routingverfahren und Verfahren zur Gruppierung von Sensorknoten.
- Kapitel 3: Architektur für drahtlose Mehrzweck-Sensornetze
- Führt das Konzept der Scopes zur Realisierung von Mehrzweck-Sensornetzwerken ein.
- Beschreibt die Spezifizierung, Ausbreitung und Wartung von Scopes.
- Präsentiert das SOS Betriebssystem, welches die Scopes unterstützt.
- Kapitel 4: Realisierung
- Beschreibt die Entwicklungsumgebung und die Implementierung der Scopes.
- Erörtert die Herausforderungen und Lösungen bei der Implementierung.
- Kapitel 5: Simulation eines Drahtlosen Sensornetzes
- Beschreibt die Simulationsumgebung und die Durchführung von Simulationen.
- Analysiert die Ergebnisse der Simulationen und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Effizienz von Scopes.
Schlüsselwörter
Drahtlose Sensornetze, Scopes, Mehrzweck-Sensornetze, Routing, Simulation, SOS Betriebssystem, Gradient-Based Routing, Directed Diffusion, Multicast, Sensorknoten, Hardware, Anwendung, Performance, Effizienz, Flexibilität.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Scopes in drahtlosen Sensornetzwerken?
Scopes ermöglichen das gezielte Ansprechen von Gruppen von Sensorknoten basierend auf frei definierbaren Eigenschaften, was die Flexibilität des Netzwerks erhöht.
Warum sind herkömmliche Sensornetze oft unflexibel?
Die meisten Sensornetze werden für ein spezifisches Szenario entwickelt und auf extreme Effizienz optimiert, was Änderungen der Parameter während der Laufzeit erschwert.
Was ist ein Mehrzweck-Sensornetzwerk?
Ein Netzwerk, das durch zusätzliche Abstraktionsschichten so flexibel ist, dass es gleichzeitig für verschiedene Anwendungen oder sich ändernde Überwachungsaufgaben genutzt werden kann.
Welche Rolle spielt das SOS Betriebssystem in dieser Arbeit?
Das SOS Betriebssystem dient als Basis für die Implementierung der Scopes, da es modulare Erweiterungen und dynamisches Scheduling unterstützt.
Wie wurde die Effizienz der Scopes überprüft?
Die Überprüfung erfolgte durch Simulationen in Umgebungen wie Avrora, sowohl auf Nachrichten- als auch auf Instruktionsebene.
- Quote paper
- Daniel Jacobi (Author), 2006, Scopes in drahtlosen Sensornetzwerken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61267