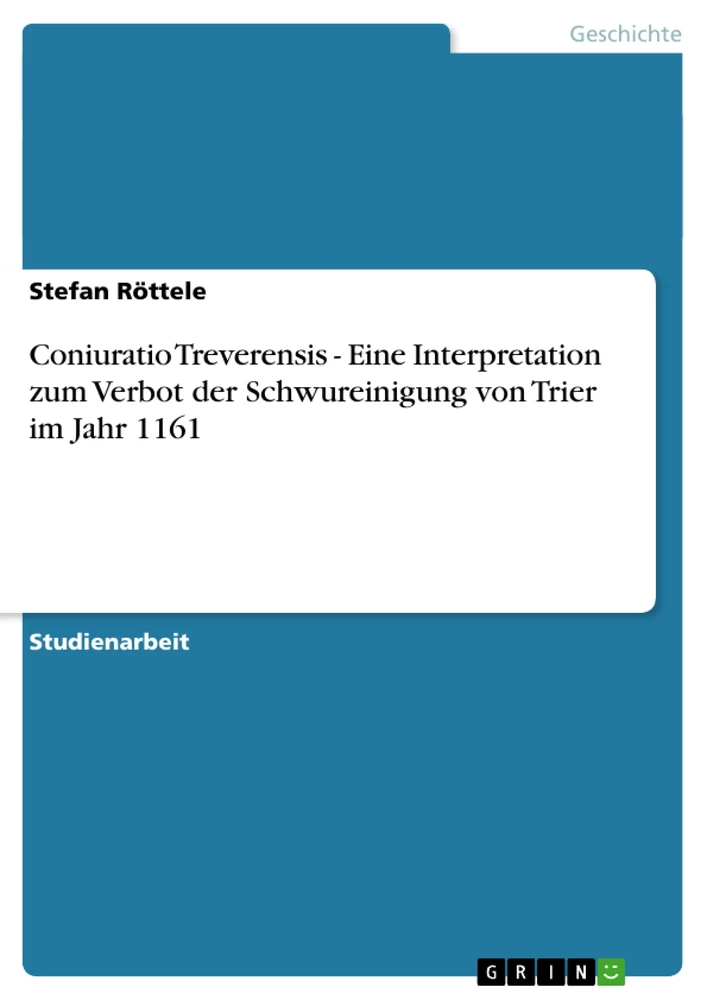Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Verbot „einer gewissen Schwureinung“ bzw. Kommune (cuiusdam communionis) zu Trier im Jahre 1161.
Dieses Verbot war ein Beschluss des „allgemeinen Hoftages“ und des Kaisers Friedrich I. „Barbarossa“. Der zu interpretierende Brief wurde von Konrad, Pfalzgraf bei Rhein, an die „Bürger“ der Stadt Trier (burgensibus de Treveri) gerichtet. In ihm verbietet er der Kommune, in seinem Namen gegen den erzbischöflichen Stadtherrn vorzugehen. Ziel der vorliegenden Arbeit soll eine Interpretation des von Konrad geschriebenen Briefes sein. Dazu müssen erst die historischen Rahmenbedingungen geklärt werden. Der übergeordnete historische Kontext, die Emanzipation der Ministerialität und, übertragen auf den konkreten Fall, die Ausbildung der Trierer Kommune bis zum Verbot 1161 werden im Anschluss erläutert und beleuchtet. Fast noch wichtiger jedoch ist es, die für die historischen Vorgänge um 1161 wichtigen Handlungsträger vorzustellen, ihre diversen Interessen zu erklären und ihre Beziehungen zueinander aufzuzeigen. Dies sind Kaiser Friedrich I. „Barbarossa“, Hillin von Fallemagne, Erzbischof von Trier, Konrad von Staufen, Pfalzgraf bei Rhein und, eingeschränkt, Ludwig von der Brücke (de Ponte). Auf diese Weise wird eine Interpretation der Quelle verständlich und nachvollziehbar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Begriff „coniuratio“
- 3. Der historische Kontext
- 3.1 Die „Großwetterlage“ zur Zeit des Verbotes
- 3.2 Die Emanzipation der städtischen Ministerialität
- 3.3 Die Herausbildung der Trierer Kommune
- 3.4 Die Protagonisten beim Verbot der Kommune 1161 und ihre Beziehungen zueinander
- 4. Quelleninterpretation zum Verbot der Schwureinigung zu Trier 1161
- 5. Abschließende Bewertung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Verbot einer „Schwureinigung“ (Kommune) in Trier im Jahr 1161, basierend auf einem Brief von Konrad, Pfalzgraf bei Rhein. Ziel ist die Interpretation dieses Briefes vor dem Hintergrund der damaligen historischen Bedingungen. Die Arbeit beleuchtet den Begriff „coniuratio“, den historischen Kontext des Verbots und die beteiligten Akteure mit ihren jeweiligen Interessen und Beziehungen.
- Interpretation des Verbots der Trierer Kommune 1161
- Der Begriff „coniuratio“ im Kontext des Hochmittelalters
- Die politische und soziale Situation in Trier um 1161
- Die Rolle der städtischen Ministerialität bei der Kommunenbildung
- Beziehungen zwischen Kaiser, Erzbischof und Pfalzgraf
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext des Verbots der „Schwureinigung“ (Kommune) in Trier 1161 durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Sie benennt den zu interpretierenden Brief und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Klärung der historischen Rahmenbedingungen, die Emanzipation der Ministerialität, die Ausbildung der Trierer Kommune und die Darstellung der wichtigsten Akteure mit ihren Interessen und Beziehungen umfasst. Das erklärte Ziel ist eine nachvollziehbare Interpretation der Quelle.
2. Der Begriff coniuratio: Dieses Kapitel beleuchtet den vielschichtigen Begriff „coniuratio“. Es werden verschiedene Bedeutungen und Interpretationen aus der Forschung präsentiert, beispielsweise als Eidgenossenschaft, Schwurverband oder communio. Die Arbeit differenziert zwischen „coniuratio“ und Gilde, wobei die „coniuratio“ als eine territorial gebundene Genossenschaft aller Bewohner eines Gebietes beschrieben wird, die einen neuen Stand, den Bürger, begründet. Die Anwendbarkeit dieser Definitionen auf die Trierer „coniuratio“ des 12. Jahrhunderts wird als Aufgabe für die folgenden Kapitel angekündigt.
3. Der historische Kontext: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den historischen Kontext des Verbots. Es beginnt mit der Beschreibung der politischen Lage unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa, einschließlich seiner Kriege in Italien und dem Aufkommen norditalienischer Städtebünde. Die Situation in Trier wird in Bezug auf diese „Großwetterlage“ gesetzt, wobei die Mainzer „coniuratio“ als abschreckendes Beispiel genannt wird. Im Weiteren wird die zunehmende Emanzipation der städtischen Ministerialität vom Stadtherrn im 11. und 12. Jahrhundert analysiert, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Lehnsfähigkeit, Privilegien im Geldhandel und wirtschaftliche Aktivitäten der Ministerialen. Die Verflechtung dieser Ministerialen mit dem politischen und wirtschaftlichen Leben der Stadt wird als entscheidend für deren Rolle bei der Kommunenbildung dargestellt.
4. Quelleninterpretation zum Verbot der Schwureinigung zu Trier 1161: (Der Inhalt dieses Kapitels kann nicht in einer Zusammenfassung wiedergegeben werden, um Spoiler zu vermeiden.)
Schlüsselwörter
Trier, Kommune, coniuratio, Schwureinigung, Hochmittelalter, Kaiser Friedrich I. Barbarossa, Pfalzgraf bei Rhein, Erzbischof von Trier, städtische Ministerialität, Emanzipation, Italienpolitik, Quelleninterpretation.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Das Verbot der Trierer Kommune 1161
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert das Verbot einer „Schwureinigung“ (Kommune) in Trier im Jahr 1161 durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Die Analyse basiert auf einem Brief von Konrad, Pfalzgraf bei Rhein, und untersucht den historischen Kontext, die beteiligten Akteure und die Bedeutung des Begriffs „coniuratio“.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist ein Brief von Konrad, Pfalzgraf bei Rhein, der das Verbot der Trierer Kommune dokumentiert. Die Arbeit bezieht sich außerdem auf die Sekundärliteratur, um den historischen Kontext und den Begriff „coniuratio“ zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Die Interpretation des Verbots der Trierer Kommune 1161; Der Begriff „coniuratio“ im Kontext des Hochmittelalters; Die politische und soziale Situation in Trier um 1161; Die Rolle der städtischen Ministerialität bei der Kommunenbildung; Die Beziehungen zwischen Kaiser, Erzbischof und Pfalzgraf.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit besteht aus fünf Kapiteln: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Begriff „coniuratio“, ein Kapitel zum historischen Kontext (inklusive der politischen Lage, der Emanzipation der Ministerialität und der Herausbildung der Trierer Kommune), ein Kapitel zur Quelleninterpretation des Verbots von 1161 und abschließend eine Bewertung und ein Ausblick.
Was ist der historische Kontext des Verbots?
Der historische Kontext umfasst die politische Lage unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa (seine Kriege in Italien und das Aufkommen norditalienischer Städtebünde), die zunehmende Emanzipation der städtischen Ministerialität in Trier und die Herausbildung der Trierer Kommune selbst. Die Mainzer „coniuratio“ wird als vergleichendes Beispiel angeführt.
Welche Rolle spielt der Begriff „coniuratio“?
Die Arbeit untersucht den vielschichtigen Begriff „coniuratio“ und dessen verschiedene Bedeutungen (Eidgenossenschaft, Schwurverband, communio). Sie differenziert zwischen „coniuratio“ und Gilde und beschreibt die „coniuratio“ als eine territorial gebundene Genossenschaft aller Bewohner eines Gebietes, die einen neuen Stand, den Bürger, begründet. Die Anwendbarkeit dieser Definitionen auf die Trierer „coniuratio“ wird diskutiert.
Welche Akteure sind beteiligt?
Die wichtigsten Akteure sind Kaiser Friedrich I. Barbarossa, der Erzbischof von Trier und der Pfalzgraf bei Rhein. Die Arbeit untersucht deren Beziehungen und Interessen im Zusammenhang mit dem Verbot der Kommune.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel der Hausarbeit ist eine nachvollziehbare Interpretation des Briefes des Pfalzgrafen und des Verbots der Trierer Kommune 1161 vor dem Hintergrund der damaligen historischen Bedingungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Trier, Kommune, coniuratio, Schwureinigung, Hochmittelalter, Kaiser Friedrich I. Barbarossa, Pfalzgraf bei Rhein, Erzbischof von Trier, städtische Ministerialität, Emanzipation, Italienpolitik, Quelleninterpretation.
- Citation du texte
- Stefan Röttele (Auteur), 2001, Coniuratio Treverensis - Eine Interpretation zum Verbot der Schwureinigung von Trier im Jahr 1161, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61271