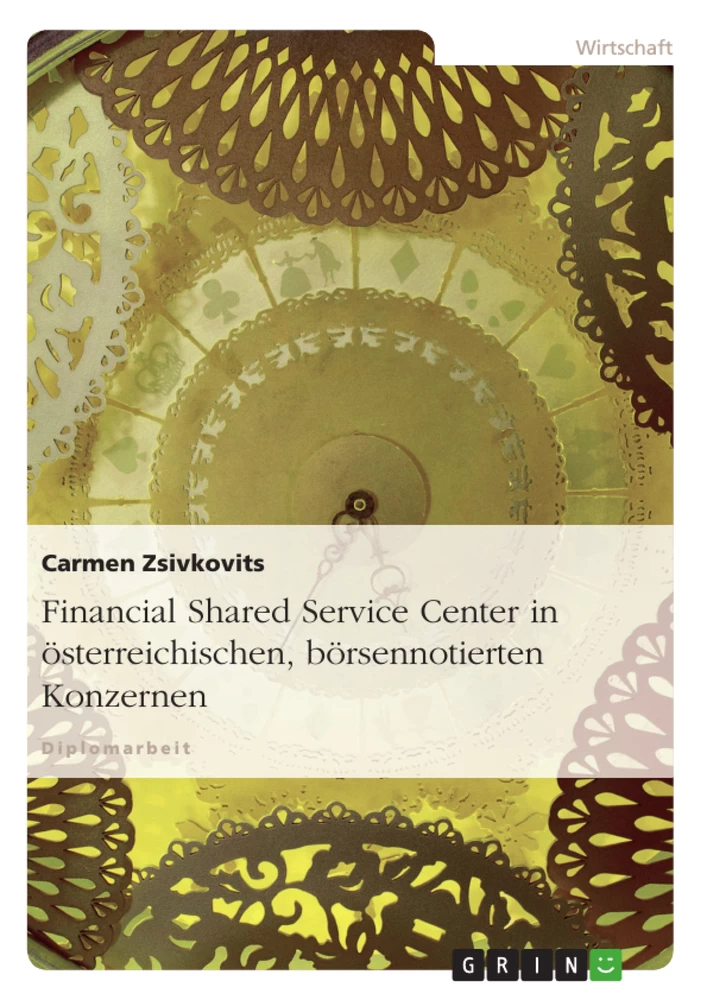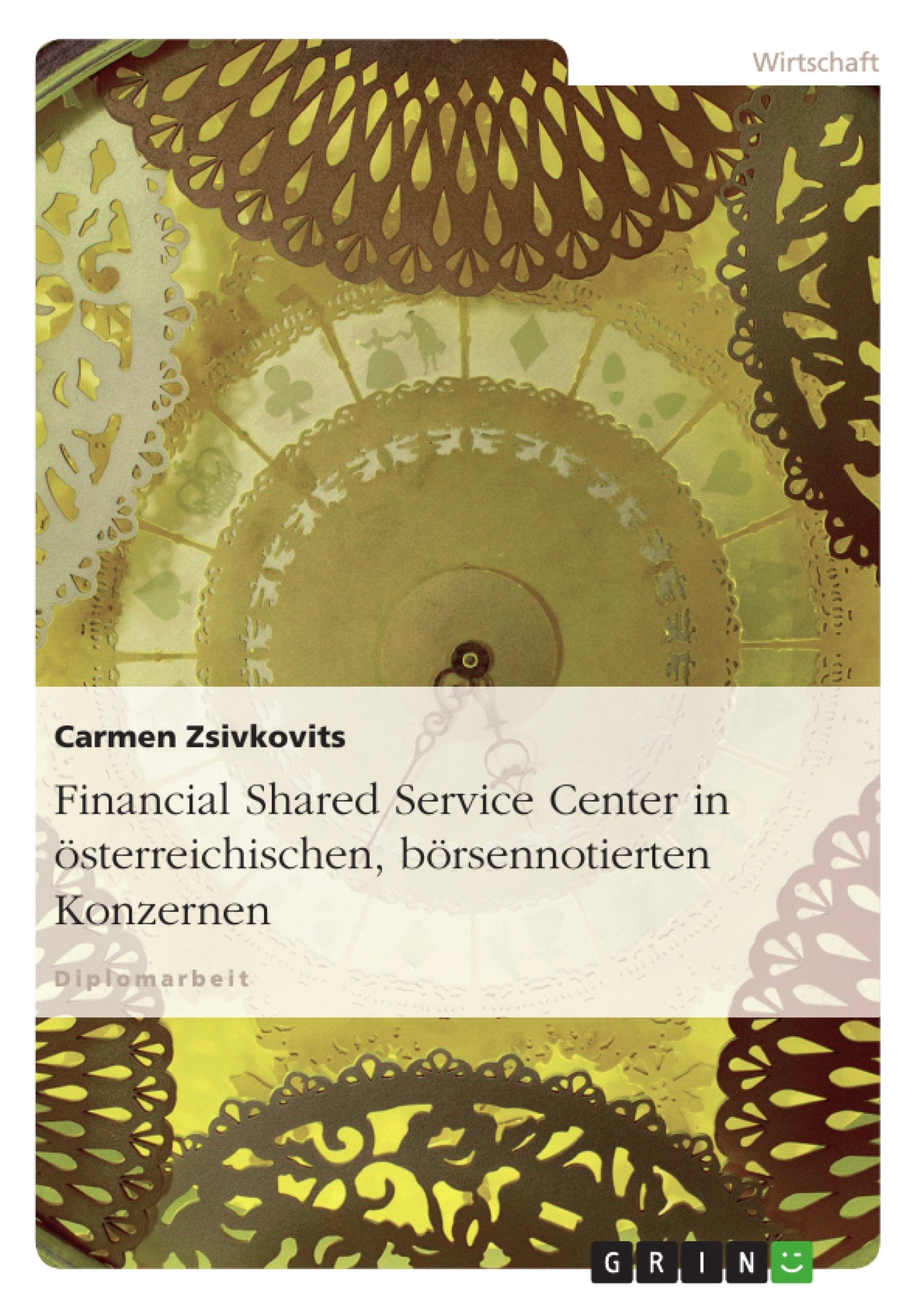Diese Arbeit stellt das SSC-Konzept als alternative Organisationsform für Finanzfunktionen innerhalb eines Unternehmens dar. Gemäß der Definition dieser Arbeit sind FSSC interne Dienstleistungsstellen, welche Controlling-, Rechnungswesen-, Treasury- und/oder steuerliche Funktionen an mehrere andere Unternehmenseinheiten gegen Leistungsverrechung ausführen. Mit der Einführung von FSSC wird durch Prozessstandardisierung und -reengineering sowie mit der Institutionalisierung von Marktprinzipien eine Erhöhung der Effizienz, Qualität und des Kostenbewusstseins in den betroffenen Finanzprozessen bezweckt. In dieser Arbeit werden das SSC-Konzept und die Anforderungen an einen „Financial Shared Service“ sowie die Vorgehensweise bei der Implementierung und der Steuerung von FSSC beschrieben. Anhand österreichischer, börsennotierter Konzerne werden FSSC in Österreich identifiziert und untersucht.
Eine umfassende Literaturanalyse wurde durchgeführt. Unter den leitenden Angestellten des Finanz- oder Controllingbereichs österreichischer, börsennotierter Konzerne wurde eine quantitative Fragebogenbefragen durchgeführt, um Unternehmen mit FSSC zu identifizieren und jene Unternehmen, ohne FSSC, nach deren Beweggründe gegen eine bisherige Implementierung zu fragen. Im Anschluss wurden fünf der acht identifizierten Konzerne mit zumindest einem FSSC im Rahmen einer leitfadengestützten qualitativen Befragung auf deren Ziele der Implementierung und organisatorische Gestaltung der Center untersucht.
20 % der 39 mittels Fragebogen befragten Unternehmen gaben an, zumindest über ein FSSC zu verfügen. Ein Drittel erklärte jedoch, wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein SSC im Finanzbereich zu implementieren. Als Hauptgründe gegen eine FSSC-Implementierung nannten die Unternehmen, dass es dazu bisher keinen Anlass gab, die Unternehmen zu klein sind und/oder den Aufwand solch einer Reorganisation höher als den Nutzen einschätzen. Fast mit allen der näher untersuchten FSSC wurde erstens Kostensenkungen und zweitens eine Erhöhung der Servicequalität angestrebt. Auch wenn fast alle FSSC Rechnungswesen- und Treasuryfunktionen anbieten, unterscheiden sie sich in Hinblick auf deren organisatorische Gestaltung, Leistungsvereinbarungen und –verrechnung, Implementierungsstrategien und Erfolgskontrolle etc.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINFÜHRUNG
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Ziele und Nutzen der Arbeit
- 1.3. Methodik und Vorgehensweise
- 1.4. Aufbau der Arbeit
- 2. DEFINITIONEN UND DARSTELLUNG DES SSC-KONZEPTS
- 2.1. Definition „Konzern“
- 2.2. Finanzfunktionen
- 2.2.1. Beschreibung „Finanzfunktionen“ in der Literatur
- 2.2.2. Controlling im Konzern
- 2.2.3. Arbeitsdefinition „Finanzfunktionen“
- 2.3. Das Shared Service Center-Konzept (SSC)
- 2.3.1. Begriffsdefinition
- 2.3.2. Treiber der Entwicklung von SSC
- 2.3.3. Ziele der Errichtung von SSC im Allgemeinen
- 2.3.4. Einsatzbereiche des SSC-Konzepts in der Praxis
- 3. OPERATIVE UND STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN IN DER PLANUNGSPHASE EINES FSSC IN KONZERNEN
- 3.1. SSC im Finanz- und Controllingbereich (FCB)
- 3.1.1. Problemhintergrund und Ziele
- 3.1.2. Definition „Financial Shared Service Center“ (FSSC)
- 3.1.3. Abgrenzung zu traditionellen Organisationsformen
- 3.1.4. Zusammenfassende Darstellung der Vor- und Nachteile einer FSSC-Implementierung
- 3.1.5. Vor- und Nachteile im Besonderen für das Controlling im Konzern
- 3.1.6. Gründe gegen eine SSC-Implementierung
- 3.2. Strategische Entscheidungen zum FSSC
- 3.2.1. Die FSSC-Strategie
- 3.2.2. Organisatorische Gestaltung
- 3.2.3. Geografische Verteilung der SSC und Standortentscheidung
- 3.2.4. Schaffung „marktähnlicher Bedingungen“ im Unternehmen
- 3.3. Eignung des SSC-Konzepts für FCB
- 3.3.1. Shared Services (SS) in der Theorie
- 3.3.2. Beispiele für Financial Shared Services (FSS)
- 3.3.3. Stakeholder des FSSC
- 3.3.4. Kontextfaktoren des FSSC
- 3.3.5. Entscheidungstheoretische Fundierung nach Frese
- 4. STEUERUNG UND IMPLEMENTIERUNG VON FSSC
- 4.1. Steuerungsinstrumente
- 4.1.1. Überblick
- 4.1.2. Service Level Agreement (SLA)
- 4.1.3. Kennzahlen im FSSC
- 4.1.4. Verrechnungspreismodelle (VP-Modelle)
- 4.1.5. Management interner Kunden/Lieferanten-Beziehungen (iKLB)
- 4.2. Risiken der FSSC-Reorganisation
- 4.2.1. Finanzielle Risiken
- 4.2.2. Prozessrisiken
- 4.2.3. Mitarbeiterbezogene Risiken
- 4.2.4. Kundenbezogene Risiken
- 4.2.5. Empirische Erfahrungen und sonstige Risiken
- 4.3. Implementierungsstrategien
- 4.3.1. Implementierungsstrategien in der Theorie
- 4.3.2. Implementierung einer SSC-Organisation
- 4.3.3. Migration der Prozesse in das FSSC
- 4.3.4. Business Process Reengineering (BPR)
- 4.3.5. Erfolgskriterien der SSC-Implementierung
- 4.4. Erfolgskontrolle
- 5. GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN
- 5.1. Strategische und operative Aspekte der Planung
- 5.1.1. Zielsetzung des FSSC und Entscheidungsunterstützung
- 5.1.2. Centerform und Centerstandort
- 5.1.3. Financial Shared Services
- 5.2. Steuerung von FSSC
- 5.2.1. Leistungsvereinbarung
- 5.2.2. Leistungsverrechnung
- 5.2.3. Management der iKLB
- 5.3. Implementierung und Erfolgskontrolle
- 5.3.1. Implementierungsstrategien
- 5.3.2. Erfolgsermittlung
- 6. EMPIRISCHE FORSCHUNG
- 6.1. Forschungsproblem
- 6.2. Forschungsplan für die quantitative Fragebogenbefragung
- 6.2.1. Forschungsdesign
- 6.2.2. Datenerhebung
- 6.2.3. Analyse der Ergebnisse
- 6.3. Forschungsplan für die qualitativen Interviews
- 6.3.1. Forschungsdesign und Datenerhebung
- 6.3.2. Analyse der Ergebnisse
- 6.3.3. Das FSSC-Konzept im Unternehmen A
- 6.3.4. Das FSSC-Konzept im Unternehmen B
- 6.3.5. Das FSSC-Konzept im Unternehmen C
- 6.3.6. Das FSSC-Konzept im Unternehmen D
- 6.3.7. Das FSSC-Konzept im Unternehmen E
- 6.3.8. Unternehmen X
- 6.4. Forschungsplan für das Expertengespräch
- 6.4.1. Forschungsdesign und Datenerhebung
- 6.4.2. Auswertung
- 7. ANALYSE DER WICHTIGSTEN EMPIRISCHEN ERGEBNISSE UND VERGLEICH MIT DER THEORIE
- 7.1. Verbreitung von FSSC in österreichischen Konzernen
- 7.2. Beweggründe für und gegen eine FSSC-Implementierung österreichischer Konzerne
- 7.2.1. Gründe gegen eine FSSC-Implementierung
- 7.2.2. Gründe für eine FSSC-Implementierung
- 7.3. Aufgaben österreichischer FSSC sowie deren Gestaltung
- 7.3.1. Aufgaben österreichischer FSSC
- 7.3.2. Strategische Gesichtspunkte
- 7.3.3. Steuerung
- 7.3.4. Implementierung und Kontrolle
- 7.3.5. Eindrücke und Zukunftsausblicke
- 8. RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht das Financial Shared Service Center (FSSC) in börsennotierten österreichischen Konzernen. Ziel ist es, die Entstehung, die Funktionsweise und die Implementierung von FSSC in diesem Kontext zu beleuchten.
- Die Arbeit analysiert die Bedeutung von FSSC für die Optimierung von Finanz- und Controllingprozessen in Konzernen.
- Sie untersucht die verschiedenen Treiber der Entwicklung von FSSC und die damit verbundenen Herausforderungen.
- Die Arbeit beleuchtet die strategischen und operativen Entscheidungen, die bei der Planung und Implementierung eines FSSC getroffen werden müssen.
- Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der empirischen Analyse von FSSC-Konzepten in österreichischen Konzernen.
- Die Arbeit diskutiert die wichtigsten empirischen Ergebnisse im Kontext der theoretischen Erkenntnisse und bietet Empfehlungen für die Gestaltung und Steuerung von FSSC.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik des FSSC ein und stellt die Problemstellung, die Ziele und den Aufbau der Arbeit dar. Kapitel 2 definiert wichtige Begriffe wie „Konzern“ und „Finanzfunktionen“ und erläutert das Shared Service Center-Konzept (SSC). Es werden die Treiber der Entwicklung von SSC, die Ziele der Errichtung sowie die Einsatzbereiche in der Praxis beschrieben.
Kapitel 3 widmet sich den operativen und strategischen Überlegungen bei der Planung eines FSSC in Konzernen. Hierbei werden die Problematik, Ziele und Definition des FSSC im Finanz- und Controllingbereich (FCB) sowie die Abgrenzung zu traditionellen Organisationsformen behandelt. Die Vor- und Nachteile einer FSSC-Implementierung werden umfassend dargestellt, und es werden Strategien für die organisatorische Gestaltung, die geographische Verteilung und die Schaffung „marktähnlicher Bedingungen“ im Unternehmen erläutert.
Kapitel 4 befasst sich mit der Steuerung und Implementierung von FSSC. Es werden die verschiedenen Steuerungsinstrumente, wie Service Level Agreements (SLA), Kennzahlen, Verrechnungspreismodelle und das Management interner Kunden/Lieferanten-Beziehungen (iKLB) vorgestellt. Darüber hinaus werden die Risiken der FSSC-Reorganisation und verschiedene Implementierungsstrategien diskutiert.
Kapitel 5 liefert Gestaltungsempfehlungen für die Planung, Steuerung und Implementierung von FSSC. Es werden sowohl strategische als auch operative Aspekte der Planung behandelt und detaillierte Empfehlungen für die Gestaltung von Leistungsvereinbarungen, Leistungsverrechnung und dem Management der iKLB gegeben.
Kapitel 6 beschreibt die empirische Forschung, die im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführt wurde. Die Forschungsmethodik umfasst eine quantitative Fragebogenbefragung, qualitative Interviews mit Unternehmen und ein Expertengespräch.
Schlüsselwörter
Financial Shared Service Center, FSSC, Konzern, Finanzfunktionen, Controlling, Shared Services, SSC, Implementierung, Steuerung, Risikomanagement, Gestaltungsempfehlungen, empirische Forschung, Österreich
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Financial Shared Service Center (FSSC)?
Ein FSSC ist eine interne Dienstleistungsstelle im Konzern, die Finanzfunktionen wie Buchhaltung, Controlling oder Treasury für mehrere Unternehmenseinheiten zentral bündelt.
Welche Ziele verfolgen Unternehmen mit der Einführung eines FSSC?
Hauptziele sind Kostensenkungen durch Skaleneffekte, die Erhöhung der Servicequalität durch Prozessstandardisierung und eine gesteigerte Effizienz.
Wie verbreitet sind FSSC in österreichischen Konzernen?
Etwa 20 % der befragten börsennotierten Konzerne in Österreich verfügen über ein FSSC, wobei ein Drittel eine künftige Implementierung plant.
Was sind typische Gründe gegen ein FSSC?
Unternehmen nennen oft eine zu geringe Größe, den hohen Reorganisationsaufwand im Vergleich zum Nutzen oder das Fehlen eines konkreten Anlasses für die Umstellung.
Was ist ein Service Level Agreement (SLA)?
Ein SLA ist eine Leistungsvereinbarung zwischen dem FSSC und den internen Kunden, die den Umfang, die Qualität und die Kosten der erbrachten Dienstleistungen festlegt.
Welche Risiken birgt eine FSSC-Reorganisation?
Zu den Risiken zählen finanzielle Unsicherheiten, Prozessstörungen während der Migration sowie mitarbeiterbezogene Widerstände gegen die Veränderung.
- Citation du texte
- Mag. (FH) Carmen Zsivkovits (Auteur), 2006, Financial Shared Service Center in österreichischen, börsennotierten Konzernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61396