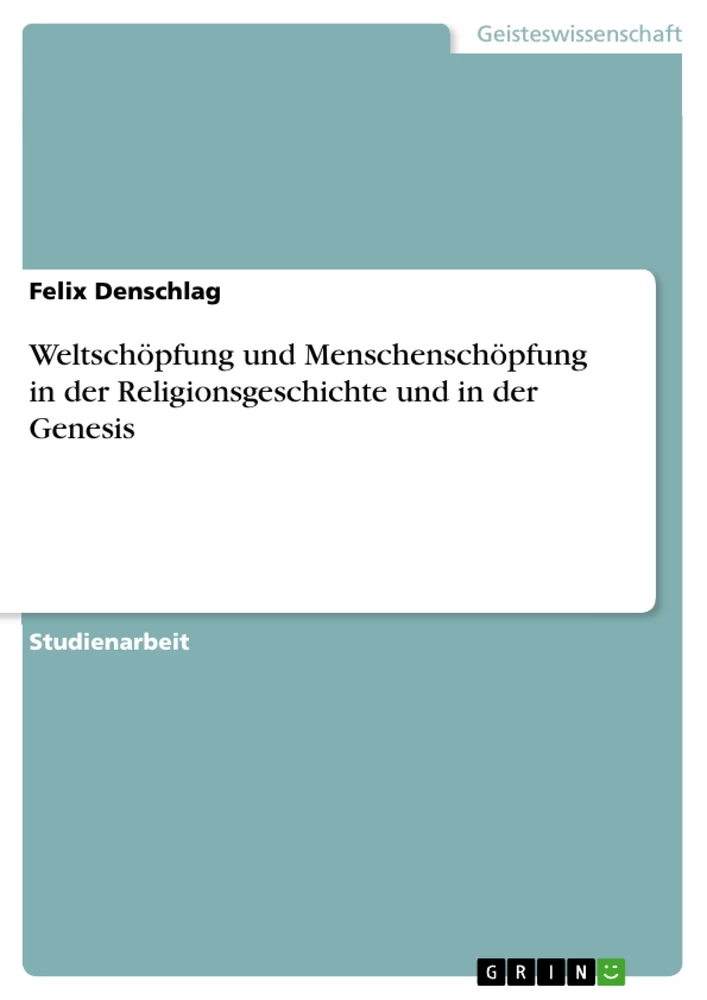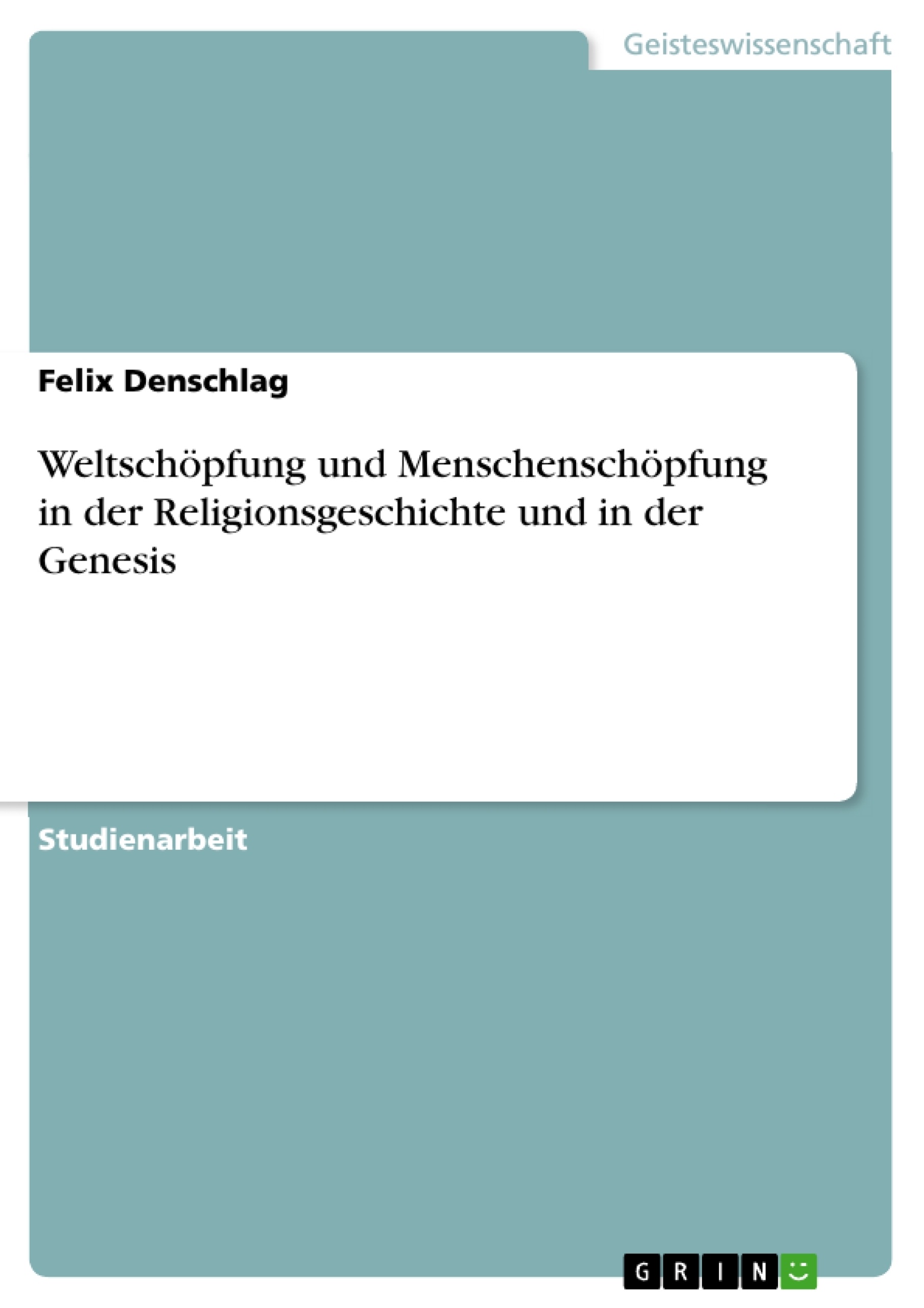Das erste Buch der Bibel heißt im Hebräischen bere´sit nach dem ersten Wort des Buches, „am Anfang“. Das Buch handelt also vom Anfang, jedoch nicht vom Anfang von irgendetwas Speziellem, sondern vom Anfang schlechthin. Alles hat mit Gott angefangen. Der Name Genesis entstammt der griechischen Bibelübersetzung, der LXX.
Die Genesis ist in drei Teile gegliedert: die Urgeschichte, die in den Kapiteln 1-11 von den Anfängen von Welt und Menschheit erzählt; die Erzelternsagen, die in den Kapiteln 12-36 und 38 von den Anfängen der menschlichen Gemeinschaft erzählt; und die Josephsgeschichte, Kapitel 37, 39-48, 50.
Die Geschichten sind in einem langen Wachstumsprozess in zwei Stadien, einem mündlichen und einem schriftlichen, entstanden. Dabei sind in beiden Stadien viele Stimmen zusammen gekommen. Für die schriftliche Phase ist im Allgemeinen anerkannt, dass die Urgeschichte Genesis 1-11 die Zusammenarbeit zweier schriftlicher Werke, des älteren „Jahwisten“ (J, 10.-9. Jahrhundert) und der jüngeren „Priesterschrift“ (P, 6.-5. Jahrhundert) ist. Doch die Geschichten haben als Erzählungen schon Jahrzehnte und Jahrhunderte gelebt, bevor sie aufgeschrieben wurden. Sie waren Bestandteil des Lebens, des Denkens, der Kultur und des Gottesglaubens des Volkes Israel und seiner Vorfahren.
Entgegen der Vorstellung eines geschichtlichen Charakters der biblischen Erzählungen besteht die Urgeschichte zu einem großen Teil aus Mythen und die Forschung hat eine große Menge an religionsgeschichtlichen Parallelen, besonders mit den Religionen des Nahen Orient, festgestellt. Diese Mythen beschäftigen sich mit demselben Gegenstand, mit dem Ursprung des Weltalls und der Menschheit. Dabei geht es nicht so sehr darum, auf intellektuelle Weise zu erklären, warum gewisse Dinge in bestimmter Art und Weise entstanden und geschehen sind, sondern die Texte kümmern sich in erster Linie um die Sicherung und den Erhalt des Bestehenden. Die Frage nach der Existenz ist der nach der Herkunft vorgeordnet, was sich auch in der häufigen Verbindung von Mythos und ritueller Handlung, bzw. rituellen Vorschriften zeigt. Diese ursprüngliche Funktion der Schöpfungs- und Entstehungsmythen macht die weltweite Verbreitung verständlich und man muss auch von daher verstehen, dass eine ganze Reihe von Motiven, so z.B. das Bilden des ersten Menschen aus Lehm, sehr weit verbreitet sind.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Typen des Redens von Schöpfer und Schöpfung
- I. Schöpfung des Ganzen und Schöpfung eines Einzelnen
- II. Schöpfung und Entstehung
- III. Die Arten des Schaffens
- 1) Schöpfung durch Geburt bzw. Geburtenfolge
- 2) Schöpfung auf Grund eines Kampfes oder Sieges
- 3) Schöpfung durch ein Handeln oder Wirken
- 4) Schöpfung durch das Wort
- 5) Das Ruhen des Schöpfers
- C. Abschließendes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt das Ziel, einen Überblick über die verschiedenen Arten des Redens von Schöpfung und Schöpfer in der Menschheitsgeschichte zu geben. Sie untersucht, wie sich diese Erzählungen von den Stammeskulturen bis in die Hochkulturen erstrecken und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Darstellung verschiedener Schöpfungstypen und deren Verbreitung, ohne den Offenbarungscharakter der biblischen Schöpfungsgeschichte zu bewerten.
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Schöpfungserzählungen verschiedener Kulturen
- Entwicklung des Schöpfungsglaubens von der Einzelschöpfung zur Gesamtschöpfung
- Analyse verschiedener Arten des Schaffens in Schöpfungsmythen
- Religionsgeschichtliche Parallelen und der Einfluss des Nahen Ostens
- Der Prozess der Entmythisierung im Judentum
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Schöpfungsgeschichte ein, indem sie auf die Genesis als das erste Buch der Bibel eingeht und dessen Dreiteilung in Urgeschichte, Erzelternsagen und Josephsgeschichte beschreibt. Sie betont den langen Entstehungsprozess dieser Geschichten, der mündliche und schriftliche Phasen umfasst und die Einbeziehung verschiedener Stimmen hervorhebt. Die Autorin erwähnt die Zusammenarbeit des Jahwisten und der Priesterschrift in der schriftlichen Phase, während sie die lange Vorgeschichte der mündlichen Überlieferung betont. Es wird deutlich, dass die Urgeschichte aus Mythen besteht und zahlreiche religionsgeschichtliche Parallelen, insbesondere im Nahen Osten, aufweist. Im Fokus steht nicht eine intellektuelle Erklärung des Entstehungsprozesses, sondern die Sicherung und der Erhalt des Bestehenden. Die Verbindung von Mythos und Ritual wird hervorgehoben, ebenso wie die weite Verbreitung ähnlicher Motive, wie z.B. die Erschaffung des Menschen aus Lehm. Die Bibel wird als verbindendes Element zwischen den Religionen der Menschheit dargestellt, wobei die Hauptmotive der Genesis 1-11 in der Frühzeit der Völker weltweit vorkommen.
B. Typen des Redens von Schöpfer und Schöpfung: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Arten, wie Schöpfung und Schöpfer beschrieben werden, wobei die Frage nach dem Gegenstand der Schöpfung im Vordergrund steht. Westermann's Unterscheidung zwischen der Schöpfung des Ganzen (Welt und Mensch) und der Schöpfung des Einzelnen wird vorgestellt. Die Schöpfung des Ganzen wird als spätere Form dargestellt, während die Einzelschöpfung in frühen Erzählungen eine erklärende Funktion für die jeweilige Gegenwart hatte. Babylonische Schöpfungsmythen werden als Beispiel angeführt, die auf Einzelerzählungen basieren, wie das Gilgamesch-Epos und Enuma elisch, welche Einzelmythen der sumerischen Mythologie zugrundeliegen. Sumerische Mythen zeigen eine Trennung von Welt- und Menschenschöpfung, und Einzelschöpfungen wie die von Vieh, Getreide oder Werkzeugen überwiegen. Durch Vergleich mit frühen afrikanischen Schöpfungsideen wird die ältere Vorstellung von der Erschaffung des Einzelnen im Gegensatz zur Gesamtschöpfung veranschaulicht. Obwohl die Schöpfung des Ganzen vorherrscht, bleiben auch Erzählungen von Einzelschöpfungen, wie die Menschenschöpfung in Babylon, bestehen.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Typen des Redens von Schöpfer und Schöpfung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit bietet einen Überblick über verschiedene Arten, wie Schöpfung und Schöpfer in der Menschheitsgeschichte beschrieben werden. Sie untersucht Schöpfungserzählungen verschiedener Kulturen, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, von Stammeskulturen bis zu Hochkulturen, ohne den Offenbarungscharakter der biblischen Schöpfungsgeschichte zu bewerten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung verschiedener Schöpfungstypen und deren Verbreitung. Wichtige Themen sind: Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Schöpfungserzählungen, die Entwicklung des Schöpfungsglaubens von der Einzelschöpfung zur Gesamtschöpfung, die Analyse verschiedener Arten des Schaffens in Schöpfungsmythen, religionsgeschichtliche Parallelen und der Einfluss des Nahen Ostens, sowie der Prozess der Entmythisierung im Judentum.
Welche Arten des Redens von Schöpfung und Schöpfer werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten des Schaffens, wie Schöpfung durch Geburt, Kampf/Sieg, Handeln/Wirken, das Wort und das Ruhen des Schöpfers. Ein zentraler Aspekt ist die Unterscheidung zwischen der Schöpfung des Ganzen (Welt und Mensch) und der Schöpfung des Einzelnen, wobei letztere als ältere Form dargestellt wird.
Wie wird die Schöpfung des Ganzen von der Einzelschöpfung abgegrenzt?
Westermann's Unterscheidung zwischen der Schöpfung des Ganzen und der Schöpfung des Einzelnen bildet einen wichtigen Rahmen. Die Schöpfung des Ganzen wird als spätere Entwicklung betrachtet, während die Einzelschöpfung in frühen Erzählungen eine erklärende Funktion für die jeweilige Gegenwart hatte. Beispiele aus babylonischen Mythen (Gilgamesch-Epos, Enuma elisch) und sumerischen Mythen veranschaulichen diese Unterscheidung.
Welche Rolle spielen babylonische und sumerische Mythen?
Babylonische Schöpfungsmythen, basierend auf Einzelerzählungen, werden als Beispiele für die Einzelschöpfung angeführt. Sumerische Mythen zeigen eine Trennung von Welt- und Menschenschöpfung, wobei Einzelschöpfungen von Vieh, Getreide oder Werkzeugen überwiegen. Der Vergleich mit afrikanischen Schöpfungsideen unterstreicht die ältere Vorstellung von der Einzelschöpfung.
Welche Bedeutung hat die Einleitung?
Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie die Genesis und deren Dreiteilung beschreibt. Sie betont den langen Entstehungsprozess der Schöpfungsgeschichte, die mündliche und schriftliche Phasen, und die Einbeziehung verschiedener Stimmen (Jahwist, Priesterschrift). Die Verbindung von Mythos und Ritual und die weite Verbreitung ähnlicher Motive werden hervorgehoben. Die Bibel wird als verbindendes Element zwischen den Religionen der Menschheit dargestellt.
Was ist die Zusammenfassung des Kapitels "Typen des Redens von Schöpfer und Schöpfung"?
Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Arten, wie Schöpfung und Schöpfer beschrieben werden, wobei der Gegenstand der Schöpfung im Mittelpunkt steht. Es werden Beispiele aus verschiedenen Kulturen herangezogen, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Schöpfungsnarrativen zu verdeutlichen. Die unterschiedlichen Arten des Schaffens werden detailliert analysiert und im Kontext der jeweiligen Kultur interpretiert.
Welche Rolle spielt der Nahe Osten in der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht religionsgeschichtliche Parallelen und den Einfluss des Nahen Ostens auf die Entwicklung von Schöpfungsglauben und -erzählungen. Die Parallelen zwischen Schöpfungsmythen des Nahen Ostens und anderen Kulturen werden analysiert, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die Verbreitung bestimmter Motive zu beleuchten.
- Citation du texte
- Felix Denschlag (Auteur), 2004, Weltschöpfung und Menschenschöpfung in der Religionsgeschichte und in der Genesis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61527