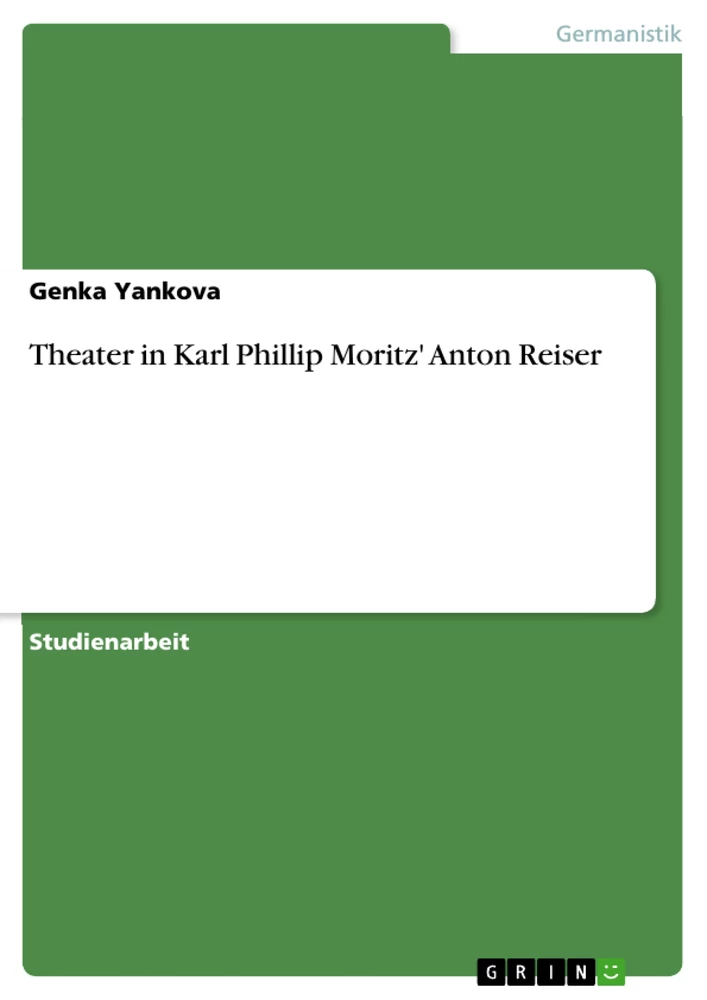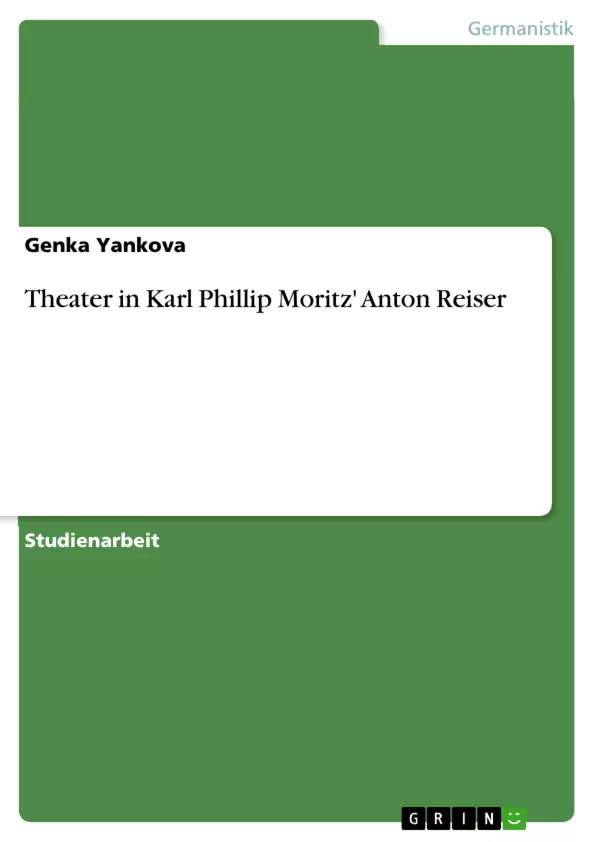Der autobiografische Roman von Karl Philip Moritz thematisiert ein typisches Phänomen der Spätaufklärung, nämlich die Ende des 18. Jahrhunderts grassierende Theatromanie und versucht sie mit den Bedingungen einer Lebensgeschichte zu verknüpfen, sodass der Roman geradezu als Zeitroman erscheint. Die Theaterleidenschaft ist sowohl ein Teil des individuellen Schicksal des Helden, als auch zeittypisches Verhalten. „Anton Reiser“ kann als ein Beispiel für Theatromanie und Lebenswirklichkeit zeitgenössischer Wandertruppen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert gelesen werden.
Ziel der vorliegenden Hausarbeit soll es sein einerseits “Anton Reiser“ als theatergeschichtliche Quelle zu analysieren, mit der theatralischen Wanderung und alle anderen Merkmale des Theaters in der Zeit, aber auch von dem individuellen Fall aus Einblicke in die Struktur der deutschen Theaterleidenschaft des 18. Jahrhunderts und ihre Ursprünge zu gewinnen. Andererseits wird versucht aus der allgemeinen Theatersituation im 18. Jahrhundert ausgegangen, Bezüge zum Roman festzustellen, sie näher zu betrachten und anhand verschiedener Fragestellungen genauer zu analysieren.
Zunächst soll jedoch ein Überblick zum Thema „Theater im 18. Jahrhundert“ gegeben werden. Zum selben Zweck werden kurz auch literaturgeschichtliche Entwicklungen skizziert. Danach werden besonders die Theaterleidenschaft Reisers und die Funktionen des Theaters im Roman behandelt. Außerdem behandle ich auch etwas ausführlicher die Identität –und Individualitätsprobleme von Anton Reiser, weil der Roman nicht zuletzt ein „psychologischer Roman“ ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theater im 18. Jh.
- Theater im Anton Reiser
- Entstehung und Entwicklung von Reisers Theatromanie
- Funktionen des Theaters im Anton Reiser
- Bildungsfunktion
- Lebensfunktion
- Theater als Ausgleich von Identität- und Individualitätsproblemen
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Karl Philipp Moritz’ autobiografischen Roman „Anton Reiser“ als theatergeschichtliche Quelle, die die grassierende Theatromanie des späten 18. Jahrhunderts mit einer individuellen Lebensgeschichte verknüpft. Die Arbeit befasst sich mit der Rolle des Theaters in der Zeit, sowohl in Bezug auf die theatralische Wanderung als auch auf die allgemeine Theaterleidenschaft, und untersucht, wie diese Themen im Roman widergespiegelt werden. Die Arbeit zielt darauf ab, Einblicke in die Struktur der deutschen Theaterleidenschaft des 18. Jahrhunderts und ihre Ursprünge zu gewinnen. Darüber hinaus soll die Arbeit die Beziehung zwischen dem Roman und der allgemeinen Theatersituation des 18. Jahrhunderts aufzeigen und diese anhand verschiedener Fragestellungen analysieren.
- Theatromanie als typisches Phänomen der Spätaufklärung
- Die Rolle des Theaters in der Lebensgeschichte des Protagonisten
- Theater als Bildungs- und Lebensfunktion
- Beziehung zwischen der Theaterlandschaft und der Zeitgeschichte
- Identität- und Individualitätsprobleme im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den autobiografischen Roman „Anton Reiser“ als ein typisches Phänomen der Spätaufklärung vor, das die Theatromanie des 18. Jahrhunderts mit einer individuellen Lebensgeschichte verbindet. Die Arbeit erläutert die Zielsetzung, den Roman als theatergeschichtliche Quelle zu analysieren und Einblicke in die deutsche Theaterleidenschaft des 18. Jahrhunderts zu gewinnen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Theater im 18. Jahrhundert und skizziert die wichtigsten Impulse der Aufklärung für die deutsche Theaterszene. Es beleuchtet die Bemühungen von Gottsched und Lessing, das Theater auf ein höheres Niveau zu bringen, und die einzigartige Theaterleidenschaft der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, die durch die Werke von Ekhof, Iffland und Schröder geprägt wurde. Die Arbeit hebt die Popularität sozialkritischer Stücke, die Veränderung der Bühne und die Durchsetzung der deutschen Sprache als Theatersprache hervor. Außerdem wird auf die Bedeutung der Sturm-und-Drang-Periode in der Theaterliteratur und auf die Rezeption von Shakespeare im deutschsprachigen Raum eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Theatromanie, Theaterleidenschaft, Theater im 18. Jahrhundert, „Anton Reiser“, Karl Philipp Moritz, autobiografischer Roman, Zeitroman, theatralische Wanderung, Bildungsfunktion, Lebensfunktion, Identität, Individualität, deutsche Theatergeschichte, Theaterliteratur, Shakespeare-Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Theatromanie“ im 18. Jahrhundert?
Theatromanie bezeichnet die grassierende Theaterleidenschaft der Spätaufklärung, die sowohl ein gesellschaftliches Phänomen als auch eine individuelle Fluchtmöglichkeit darstellte.
Warum gilt „Anton Reiser“ als psychologischer Roman?
Karl Philipp Moritz analysiert darin detailliert die Identitäts- und Individualitätsprobleme seines Helden, die durch soziale Unterdrückung und religiösen Fanatismus entstehen.
Welche Funktion hat das Theater für den Protagonisten Anton Reiser?
Das Theater dient Reiser als Kompensation für ein mangelhaftes Leben, als Bildungsort und als Mittel zur Selbstfindung außerhalb seiner bedrückenden Realität.
Wie war die Situation der Wandertruppen im 18. Jahrhundert?
Die Arbeit beschreibt die prekäre Lebenswirklichkeit der Schauspieler, die als soziale Außenseiter zwischen künstlerischem Anspruch und wirtschaftlicher Not pendelten.
Welchen Einfluss hatten Gottsched und Lessing auf das Theater?
Sie bemühten sich, das deutsche Theater von Jahrmarktsbelustigungen zu einer moralischen Anstalt und einer literarisch anspruchsvollen Kunstform zu entwickeln.
- Quote paper
- Genka Yankova (Author), 2006, Theater in Karl Phillip Moritz' Anton Reiser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61606