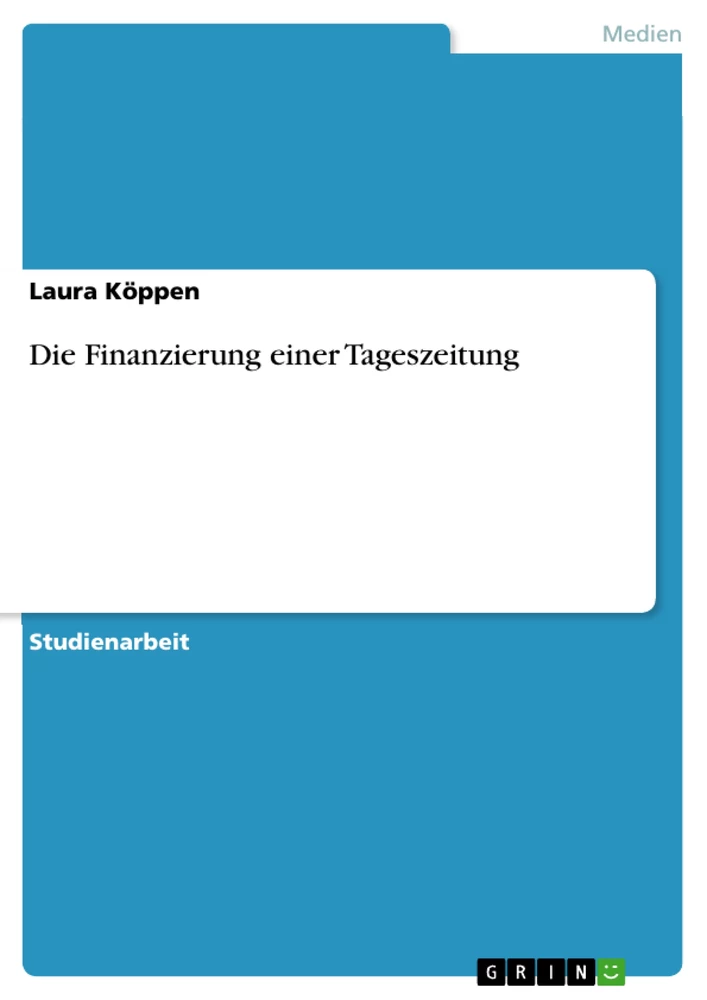Der Mediensektor ist durch Besonderheiten gekennzeichnet, die die Finanzierungsmechanismen seiner Güter maßgeblich beeinflussen. Der Zeitungsmarkt weist mit hohen First-Copy-Costs, ausgeprägter Fixkostendegression und einer Verbundproduktion für Leser- und Anzeigenmarkt Charakteristika auf, die das wirtschaftliche Vorgehen der Zeitungsverlage und deren Erlössituation entscheidend prägen. Die Arbeit geht zunächst auf Charakteristika des gesamten Mediensektors ein, bevor sie sich im Weiteren auf den Teilmarkt der Tageszeitungen konzentriert. Hierbei werden insbesondere die Daten für den Bereich der regionalen Abonnementzeitungen herausgestellt, da diese mit einem Auflagenanteil von 55,3% am gesamten Zeitungsmarkt (BDZV, „Zeitungen 2005) den bedeutendsten Sektor bilden und von aktuellen Entwicklungen am stärksten betroffen sind. Im Hauptteil dieser Arbeit werden in Form einer Wertschöpfungskette jene Produktionsprozesse vorgestellt, für welche Kosten- und Erlöspotenziale gesondert betrachtet werden können. Am Schluss zeigt die Autorin durch eine Analyse der Kosten- und Erlösstruktur deutscher Verlage deren Finanzierungsweise im Verlauf der letzten Jahre auf und gibt einen Einblick in die Gewinnsituation von Verlagen im Vergleich zu anderen Industriezweigen. Zuletzt werden Einblicke in die aktuellen Probleme der Tageszeitungen gegeben und Strategieansätze zur Auflagen- und Gewinnsteigerung beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
1) Einleitung
2) Der Mediensektor
2.1) Abgrenzung
2.2) Charakteristika des Mediensektors
2.2.1) „Öffentliches-Gut“-Problematik
2.2.2) Verbundproduktion
2.2.3) First-Copy-Costs
2.2.4) Lock-in Effekte
2.3) Marktversagen der Medienmärkte
3. Der Tageszeitungsmarkt
3.1) Abgrenzung
3.2) Charakteristika der Tageszeitungsproduktion
3.2.1) Verbundproduktion
3.2.2) Anzeigen-Auflagen-Spirale
3.3) Auflagenentwicklung
4) Finanzierung von Tageszeitungen
4.2) Kosten- und Erlösstruktur
4.2.1) Kostenstruktur
4.2.1.1) Kosten für Papier und Herstellung
4.2.1.2) Kosten für Redaktion und Verwaltung
4.2.1.3) Kosten für Vertrieb und Anzeigen
4.2.2) Erlösstruktur
4.2.2.1) Vertriebserlöse
4.2.2.2) Anzeigenerlöse
4.3) Gewinnsituation deutscher Tageszeitungsverlage
4.3.1) Umsatzrendite
5) Aktuelle Entwicklungen des deutschen Zeitungsmarktes
6) Strategische Maßnahmen zur Gewinnmaximierung
6.2) Integrationsstrategien
6.3) Neue Angebotsformen: E-Paper und Tabloidformate
6.4) Die Abonnentenkarte als Kundenbindungsinstrument am Beispiel der ABOplus-Card der Verlagsgruppe Rhein Main
7) Fazit
VIII) Anhang: Abbildungen
Abbildung 1: Auflage der deutschen Tageszeitungen 2004 - 2006
Abbildung 2: Wertschöpfungskette der Zeitungsproduktion
Abbildung 3: Kostenstruktur der deutschen Tageszeitungen 1998, 2003, 2004 (Anteil an Gesamtkosten in %)
Abbildung 4: Erlösstruktur der deutschen Tageszeitungen 1998, 2003 und 2004 in Erlösanteilen (%) und absoluten Werten (Mrd. €)
IX) Literaturverzeichnis
Die Finanzierung einer Tageszeitung
1) Einleitung
Der Mediensektor ist durch Besonderheiten gekennzeichnet, die die Finanzierungsmechanismen seiner Güter maßgeblich beeinflussen. Auch der Zeitungsmarkt als Teil des Mediensektors weist Merkmale wie hohe First-Copy-Costs, eine ausgeprägte Fixkostendegression und die Verbundproduktion für Leser- und Anzeigenmarkt auf, die das wirtschaftliche Vorgehen der Zeitungsverlage und deren Erlössituation entscheidend prägen. Ich möchte in dieser Arbeit zunächst auf Charakteristika des gesamten Mediensektors eingehen, um mich im Anschluss auf den Teilmarkt der Tageszeitungen zu konzentrieren. Hierbei werde ich insbesondere die Daten für den Bereich der regionalen Abonnementzeitungen herausstellen, da diese mit einem Auflagenanteil von 55,3% am gesamten Zeitungsmarkt (BDZV, „Zeitungen 2005) den bedeutendsten Sektor bilden und von aktuellen Entwicklungen am stärksten betroffen sind. Im Hauptteil dieser Arbeit werde ich zunächst in Form einer Wertschöpfungskette jene Produktionsprozesse herausarbeiten, für welche Kosten- und Erlöspotenziale gesondert betrachtet werden können. Am Schluss werde ich durch eine Analyse der Kosten- und Erlösstruktur deutscher Verlage deren Finanzierungsweise im Verlauf der letzten Jahre aufzeigen und einen Einblick in die Gewinnsituation von Verlagen im Vergleich zu anderen Industriezweigen geben. Für nahezu sämtliche Werte musste ich auf durchschnittliche Daten zurückgreifen, da exakte Angaben in der Regel nicht zu ermitteln sind. Bei fast allen Verlagen in Deutschland handelt es sich um Familienbetriebe, welche keiner Publizitätspflicht unterliegen und ihre genauen Kosten- und Erlösstrukturen nicht veröffentlichen. Zuletzt werde ich einen Einblick in die aktuellen Probleme der Tageszeitungen geben und Strategieansätze zur Auflagen- und Gewinnsteigerung beschreiben. Da aufgrund der gegebenen Strukturen wie der ausgeprägten Fixkostendegression und der Verbundproduktion eine Auflagensteigerung fast immer mit einer Gewinnsteigerung gleichzusetzen ist, werde ich insbesondere jene Maßnahmen gesondert beschreiben, die wie z.B. eine Abonnentenkarte zu einer Auflagensteigerung führen sollen.
2) Der Mediensektor
Der Tageszeitungsmarkt, auf den ich mich in dieser Arbeit konzentrieren möchte, ist ein Bestandteil des umfassenderen Mediensektors. Dessen Charakteristika prägen somit jene branchenspezifischen Mechanismen des Zeitungsmarktes, die dessen Finanzierungsmechanismen maßgeblich steuern.
2.1) Abgrenzung
Der Medienmarkt ist neben anderen Kommunikationsmärkten Teil des größeren Informationssektors. Gemäß den Kriterien für einen zusammengehörigen Markt nach HEINRICH bilden alle Zeitungs-, Zeitschriften-, Anzeigenblattverlage, Nachrichtenagenturen, Hör- und Rundfunkveranstalter, sowie Programm-Input-Produzenten zusammen den Mediensektor.[1]
2.2) Charakteristika des Mediensektors
Unternehmungen des Mediensektors sind durch zahlreiche spezifische Charakteristika gekennzeichnet, von denen einige seine Finanzierungsmechanismen entscheidend prägen. Auf diese soll im Folgenden näher eingegangen werden.
2.2.1) „Öffentliches-Gut“-Problematik
Eine Besonderheit liegt in der Öffentlichkeit der Güter. Im Gegensatz zu privaten Gütern sind öffentliche Güter durch Nicht-Ausschluss einzelner Teilnehmer und deren Nicht-Rivalität gekennzeichnet. Nicht-Ausschluss führt dazu, dass Preisforderungen nur schwer durchgesetzt werden können, Nicht-Rivalität dazu, dass Preisforderungen nicht sinnvoll sind. Es müssen also alternative Finanzierungsformen zur reinen Entgeltfinanzierung durch den Endverbraucher gesucht werden, welches oftmals durch eine Verbundproduktion gewährleistet wird.[2]
2.2.2) Verbundproduktion
Medienunternehmen agieren gleichzeitig auf zwei verschiedenen Märkten. Sie produzieren redaktionelle Inhalte aus Information, Bildung und Unterhaltung als Sachgut für den Rezipientenmarkt und eine Verbreitungswahrscheinlichkeit von Werbebotschaften als Dienstleistung für den Werbemarkt. Hieraus entsteht eine Verbundproduktion aus Text- und Anzeigenteil, welche sich aus Verbundvorteilen in der Produktion, im Vertrieb und im Konsum begründet.[3] Strategien, Kosten- und Erlösstrukturen müssen somit für beide Märkte getrennt betrachtet werden.
2.2.3) First-Copy-Costs
Kennzeichnend für Produkte des Mediensektors ist der hohe Fixkostenanteil, welchen allein die Produktion des ersten Exemplars verursacht. Die variablen Kosten der Vervielfältigung sind dagegen relativ gering, sodass Medienunternehmen in besonderem Maße von der Fixkostendegression profitieren können.[4]
2.2.4) Lock-in Effekte
Insbesondere bei Printmedien sind Lock-in Effekte von wesentlicher Bedeutung für das Konsumverhalten der Nachfrager. Lock-in Effekte basieren auf Wechselkosten, die aufgrund steigender Such- und Transaktionskosten für Information entstehen, wenn der Konsument das Informationsprodukt wechselt. Ausgeprägte Lock-in Effekte sind besonders bei Tageszeitungen zu beobachten. Diese Leser-Blatt-Bindung stellt eine erhebliche Marktzutrittsschranke für Neuanbieter dar und verhindert einen funktionierenden Wettbewerb. Die Folge ist ein Zeitungsmonopol in 55,5 % der Gebiete in Deutschland.[5]
2.3) Marktversagen der Medienmärkte
Die Existenz öffentlicher Güter erschwert die Durchsetzung von Eigentumsrechten, Lock-in Effekte sowie die ausgeprägte Fixkostendegression heben den Alleinanbieter in eine überlegene Situation und stellen hohe Marktzutrittsbarrieren für Neuanbieter dar. Ein funktionierender Wettbewerb wird besonders auf dem Zeitungsmarkt verhindert und eine Monopolstellung nahezu aller Zeitungsverlage ist die Folge. Die Strukturbedingungen für einen idealen Markt nach HEINRICH sind demnach nicht erfüllt.
3. Der Tageszeitungsmarkt
Die zuvor erläuterten Charakteristika von Medienmärkten treffen in unterschiedlicher Ausprägung auch auf den Zeitungsmarkt zu. Im Folgenden möchte ich auf einige der Merkmale differenziert für den Tageszeitungsmarkt eingehen.
3.1) Abgrenzung
Neben den audiovisuellen Medien bilden die Printmedien den zweiten Bestandteil des Mediensektors. Printmedien halten einen Anteil von 40 % am gesamten Sektor und lassen sich weiterhin in den Online- sowie den Pressesektor unterscheiden, welcher alle Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchverlage einschließt.[6] Ziel eines jeden Zeitungsverlages ist es, eine kommerziell vermarktbare Dienstleistung für die werbetreibende Industrie anzubieten, die zugleich den Lesern redaktionelle Inhalte bereitstellt. Demnach muss auch eine Abgrenzung innerhalb des Zeitungsmarktes für beide Teilleistungen betrachtet werden.
Auf dem Lesermarkt können Zeitungen nach Verbreitungsart (lokal, regional, überregional, international), Vertriebsart (Abonnement und Einzelverkauf), Erscheinungszeit (morgens, mittags, abends) und -häufigkeit (täglich und wöchentlich) unterschieden werden.[7] Für den Werbemarkt sind Kriterien der Zielgruppenreichweite und räumlichen Reichweite, der werblichen Eignung des Werbeträgers, sowie der Produktions- und Verbreitungskosten der Werbebotschaften entscheidend.[8] Als Informationsträger stellt die lokale und regionale Tageszeitung, welche ihre Ansprache an das Publikum einer begrenzten Region richtet, das wichtigste Medium der Lokalberichterstattung dar und auch für den regionalen Anzeigenmarkt ist sie der führende Werbeträger.
3.2) Charakteristika der Tageszeitungsproduktion
Einige der Merkmale, die für alle Mediensektoren in unterschiedlichem Ausmaß zutreffen, sind entscheidend für die Finanzierung von Tageszeitungsverlagen. Hauptsächlich die hohen „First-Copy-Costs“ und das Auftreten auf zwei Märkten in Form der Verbundproduktion prägen entscheidend das Vorgehen der Verlage. Aufgrund der Verbundproduktion bestehen erhebliche Interdependenzen zwischen Leser- und Anzeigenmarkt, welche durch den Modellzusammenhang der Anzeigen-Auflagen-Spirale beschrieben werden.
3.2.1) Verbundproduktion
Zeitungsverlage produzieren ein Verbundprodukt in Form der Zeitung als Leistungsbündel für den Leser- und den Anzeigenmarkt.[9] Beide Märkte sind miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. So rechtfertigt eine hohe Auflage auf dem Lesermarkt höhere Anzeigenpreise, welche zu höheren Anzeigenerlösen führt. Hierdurch kann durch ein verbessertes redaktionelles Angebot eine höhere Qualität der Zeitung erzielt oder die Vertriebspreise gesenkt werden.
3.2.2) Anzeigen-Auflagen-Spirale
Das durch die Verbundproduktion gegebene Erlöspotenzial auf zwei Märkten gleichzeitig sowie das erhebliche Kostensenkungspotenzial durch die Fixkostendegression bei einer Auflagensteigerung führen zu einer besonders ausgeprägten kumulativ-dynamischen Verknüpfung von Nachfrage- und Gewinnsteigerung, der Anzeigen-Auflagen-Spirale. Erhöht sich die Nachfrage auf dem Lesermarkt, steigern sich neben den Vertriebs- auch die Anzeigenerlöse. Zum einen aufgrund der vermehrten Nachfrage nach Anzeigenraum, zum anderen durch die aufgrund der höheren Auflage gestiegenen Werbegrundpreise. Da die Verleger nun qualitativ hochwertiger produzieren können, kann der Gewinnsteigerungsprozess erneut in Gang gesetzt werden.11
[...]
[1] Vgl. Heinrich (2001), S. 55 / 27 / 49
[2] Vgl. Heinrich (2001), S. 71 / 94
[3] Vgl. Mallik (2004), S. 28
[4] Vgl. Heinrich (2001), S. 74 / 96
[5] Vgl. Heinrich (2001), S. 233 / 278
[6] Vgl. Eberspächer (2002), S.9
[7] Vgl. Mallik (2004), S. 18
[8] Vgl. Heinrich (2001), S. 281
[9] Vgl. Wirtz (2006), S. 97 / 88
Häufig gestellte Fragen
Was sind „First-Copy-Costs“ bei einer Tageszeitung?
Dies sind die hohen Fixkosten, die für die Erstellung des allerersten Exemplars anfallen (Redaktion, Satz, etc.). Jedes weitere gedruckte Exemplar verursacht dann nur noch geringe variable Kosten.
Was bedeutet „Verbundproduktion“ im Zeitungsmarkt?
Zeitungen agieren auf zwei Märkten gleichzeitig: Sie verkaufen redaktionelle Inhalte an Leser (Rezipientenmarkt) und Werbeplätze an Unternehmen (Anzeigenmarkt).
Was beschreibt die „Anzeigen-Auflagen-Spirale“?
Es ist ein wechselseitiger Effekt: Eine höhere Auflage macht die Zeitung für Anzeigenkunden attraktiver, was zu mehr Erlösen führt, die wiederum in die Qualität und damit in eine höhere Auflage investiert werden können (und umgekehrt).
Warum haben regionale Abonnementzeitungen oft eine Monopolstellung?
Hohe Markteintrittsbarrieren durch Fixkosten und starke Leser-Blatt-Bindung (Lock-in-Effekte) führen dazu, dass in vielen Gebieten Deutschlands nur eine regionale Tageszeitung existiert.
Welche neuen Angebotsformen nutzen Verlage zur Gewinnmaximierung?
Verlage setzen verstärkt auf digitale Angebote wie E-Paper, Tabloid-Formate und Kundenbindungsinstrumente wie Abonnentenkarten (z.B. ABOplus-Card).
Wie sieht die Kostenstruktur einer typischen Tageszeitung aus?
Die Kosten gliedern sich hauptsächlich in Papier und Herstellung, Redaktion und Verwaltung sowie Vertrieb und Anzeigenabteilung.
- Quote paper
- Laura Köppen (Author), 2006, Die Finanzierung einer Tageszeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61712