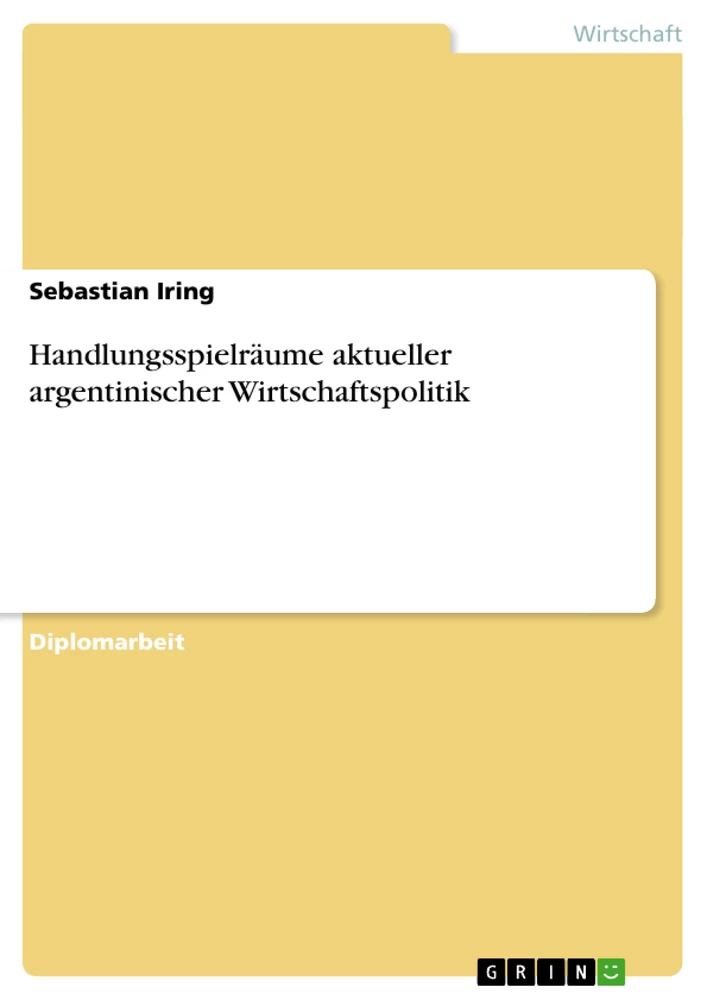„Geld ist - so heißt es bei Georg Simmel - die vielleicht konzentrierteste und zugespitzteste Form und Äußerung des Vertrauens auf die gesellschaftliche-staatliche Ordnung.“
Wer könnte dies mehr aus eigener Erfahrung in Geschichte und Gegenwart bestätigen, als die Bürger Argentiniens? Dieses Land war in den letzten 115 Jahre durch starke wirtschaftliche Turbulenzen geprägt, an deren Ende 2002 eine elementare Wirtschaftskrise stand. Die Erklärung der Zahlungsunfähigkeit war aufgrund einer konsolidierten Staatsschuld von ca. 144,4 Milliarden US-Dollar unausweichlich. Gründe und Analysen fanden sich schnell: mangelnde fiskalische Disziplin, mangelnde institutionelle Rahmenbedingungen, prozyklische Wirtschaftspolitiken, überdimensionierte Staatsbehörden mit einer Vielzahl an öffentlichen Bediensteten, unzureichende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Politikversagen (badgovernance)und letztendlich einfach Nachteile durch eine Vielzahl exogener Schocks.
Nach der Unabhängigkeit Argentiniens (18.06.1816) wurden der entstehende Nationalstaat und die Erschließung des Wirtschaftsraums durch eine expansive Geldpolitik und externe Verschuldung finanziert, infolge dessen bereits 1890 eine Zahlungsbilanzkrise entstand.360% der Exporterlöse mussten für den Schuldendienst aufgebracht werden und ein anhaltender Deflationsprozess führte zu einer Reihe von Unternehmens- und Bankenzusammenbrüchen. Im Höhepunkt der Krise musste der Hauptgläubiger Argentiniens, die englischeBaring-Gruppe,Insolvenz anmelden. Der Verschuldungskrise wurde durch ein Stabilisierungsprogramm (Verringerung des Banknotenumlaufs, Verzicht einer Budgetfinanzierung via Geldmengenausweitung etc.), einem Konsolidierungskredit in Höhe von 15 Millionen Pfund und einem Zahlungsmoratorium auf die Auslandsschulden bis 1898 entgegengetreten. Zwischen 1890-1914 erlebte Argentinien eine erste prosperierende wirtschaftliche Phase, die auch als ArgentiniensGolden Agebezeichnet wird Die Vorzeichen standen so gut, dass es mit anderen aufstrebenden Industrienationen auf gleicher Augenhöhe kommunizierte.4Entscheidend für diese Entwicklung waren neben den oben genannten Stabilisierungsmaßnahmen die Etablierung einer Geldverfassung, die die Transformation der Geldpolitik ermöglichte, sowie die Realisierung einer erfolgreichen Unterbewertungsstrategie.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Theorie der geldwirtschaftlichen Entwicklung
- 2.2 Das internationale Währungssystem
- 2.3 Schuldnerwährung und Überbewertung als „Hemmschuh“ nachhaltiger Entwicklung
- 2.4 Theorieansätze wechselkursbasierter Stabilisierung
- 2.4.1 Eine theoretische Fundierung des Systems des currency board (CB)
- 2.4.2 Eine monetärkeynesianische Antwort zur Entperipherisierung der Ökonomie
- 2.5 Das Problem des dutch disease
- 2.6 Zusammenfassung und Ausblick
- 3. Höhepunkt der Argentinienkrise und Entwicklung bis heute
- 3.1 Gründe für das Scheitern des Systems des currency board in Argentinien
- 3.2 Kritik am IWF
- 3.3 Krisenbewältigung nach der Erklärung des default
- 3.4 Schuldenverhandlungen mit privaten Gläubigern
- 3.5 Schuldenverhandlungen mit dem IWF
- 3.5.1 Makroökonomisches Rahmenkonzept 2003-2006
- 3.5.2 Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Periode 2003-2004
- 3.5.3 Steuerreformen
- 3.5.4 Reformen des Finanzsystems
- 3.6 Zusammenfassung und aktueller Stand
- 4. Handlungsspielräume der aktuellen Wirtschaftspolitik
- 4.1 Möglichkeiten einer Unterbewertungsstrategie
- 4.2 Innere Stabilität, Produktionsdiversifizierung und Wertschöpfung
- 4.3 Sojaboom und dutch disease?
- 4.4 Möglichkeiten einer monetären Kooperation innerhalb des Mercosur
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Handlungsspielräumen der aktuellen argentinischen Wirtschaftspolitik. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen der geldwirtschaftlichen Entwicklung, das internationale Währungssystem und die Folgen von Schuldnerwährungen und Überbewertungen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Argentinienkrise, den Gründen für das Scheitern des Currency Boards und der Kritik am Internationalen Währungsfonds (IWF).
- Theoretische Grundlagen der geldwirtschaftlichen Entwicklung
- Analyse der Argentinienkrise und des Scheiterns des Currency Boards
- Kritik am Internationalen Währungsfonds (IWF)
- Handlungsspielräume der aktuellen Wirtschaftspolitik
- Möglichkeiten einer Unterbewertungsstrategie und innerer Stabilität
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der argentinischen Wirtschaftspolitik ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der geldwirtschaftlichen Entwicklung, das internationale Währungssystem und die Folgen von Schuldnerwährungen und Überbewertungen. Kapitel 3 analysiert den Höhepunkt der Argentinienkrise, die Gründe für das Scheitern des Currency Boards und die Kritik am IWF. Kapitel 4 untersucht die Handlungsspielräume der aktuellen Wirtschaftspolitik, einschließlich der Möglichkeiten einer Unterbewertungsstrategie und innerer Stabilität.
Schlüsselwörter
Argentinien, Wirtschaftspolitik, Currency Board, Argentinienkrise, IWF, Schuldnerwährung, Überbewertung, Unterbewertung, Stabilisierung, innerer Stabilität, Produktionsdiversifizierung, Mercosur.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Ursachen für die schwere Argentinienkrise 2002?
Gründe waren unter anderem mangelnde fiskalische Disziplin, eine überbewertete Währung durch das Currency Board und exogene Schocks.
Warum scheiterte das System des „Currency Board“?
Die starre Bindung an den US-Dollar führte zu einer Überbewertung des Peso, was die Wettbewerbsfähigkeit der argentinischen Exportwirtschaft massiv schwächte.
Was versteht man unter dem Problem des „Dutch Disease“?
Es beschreibt die Gefahr, dass ein Rohstoffboom (z.B. Soja in Argentinien) die Währung aufwertet und dadurch andere Industriezweige verdrängt.
Welche Rolle spielte der IWF in der Krise?
Der IWF wird oft kritisiert, weil seine geforderten Sparmaßnahmen die Rezession in Argentinien verschärft und die soziale Krise vertieft haben sollen.
Welche Handlungsspielräume hat die aktuelle argentinische Wirtschaftspolitik?
Diskutiert werden Unterbewertungsstrategien, Produktionsdiversifizierung und eine verstärkte monetäre Kooperation innerhalb des Mercosur.
- Quote paper
- Diplom Volkswirt Sebastian Iring (Author), 2005, Handlungsspielräume aktueller argentinischer Wirtschaftspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61728